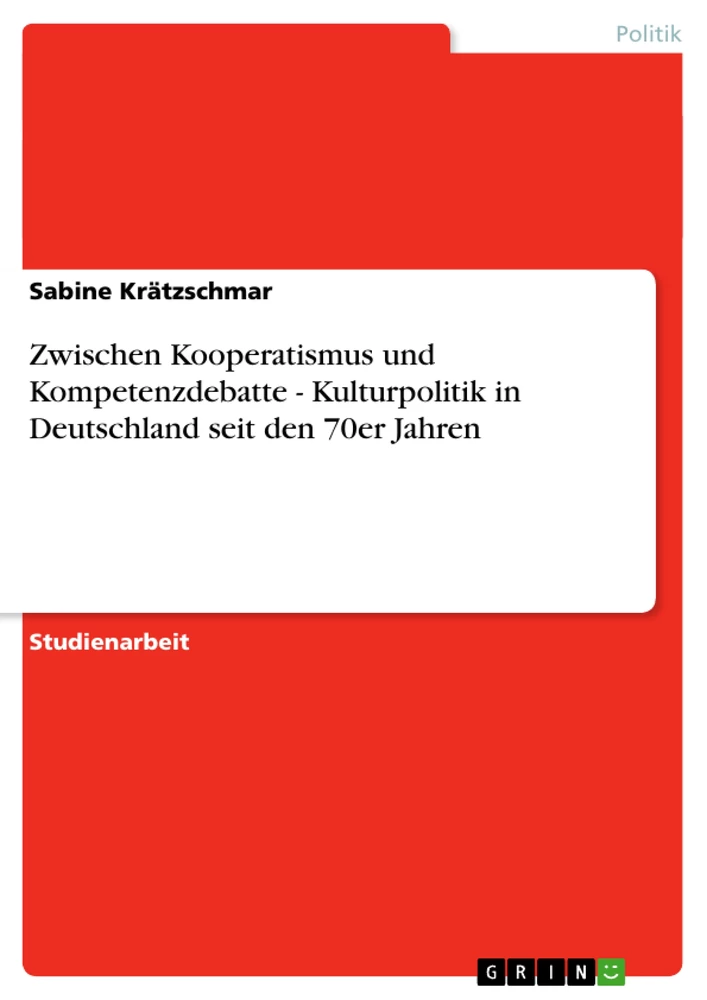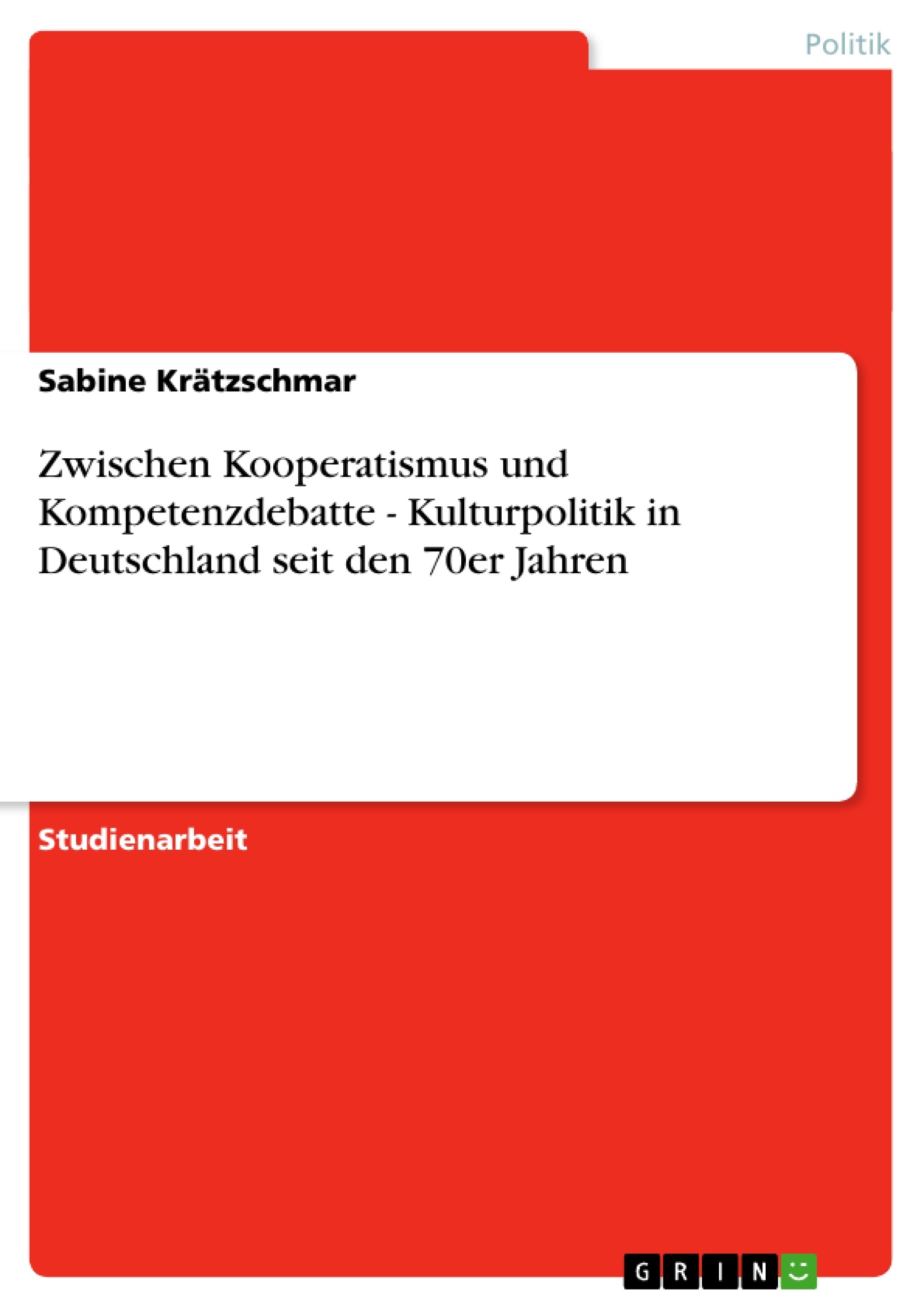„Kultur ist alles – alles ist Kultur“ skandiert einer der Leitsätze, die in den Jahren der Entwicklung des Kulturbetriebs in Deutschland eine Rolle spielten und Kulturpolitik in den verschiedenen Epochen auf unterschiedlichste Weise legimitierten. Der Kulturbegriff, der den verschiedenen Phasen und Konzepten von kulturpolitischer Aktivität in Deutschland zugrunde liegt, war und ist bis heute Veränderungen im Verständnis unterworfen, und damit auch das Verständnis vom Wesen und den Aufgaben der Kulturpolitik. Wo aber nimmt Kulturpolitik überhaupt ihren Anfang? Seit wann gibt es sie und welchen Stellenwert kann sie für sich in Anspruch nehmen? Welche Akteure sind an ihr beteiligt? Lässt sich überhaupt so etwas wie eine allgemeingültige Darstellung von Kulturpolitik finden?
Diese Arbeit unternimmt den Versuch, einen Überblick über die Entstehung eines noch jungen Politikfeldes und den ihm immanenten aktuellen Problemen zu liefern, welche nicht zuletzt durch seine komplexe Gestalt hervorgerufen werden. Diese ist insbesondere durch die heterogene Entwicklungsgeschichte von Kulturpolitik in Deutschland begründet. Grundsätzliche konzeptionelle Kulturpolitik-Programme waren bisher eher von geringer Bedeutung. Ein überkommenes Verständnis von Kulturpolitik und von Kulturstaat könnte zu dieser Blockade geführt haben. Nicht zuletzt mit der Einführung eines Bundeskulturbeauftragten scheint jedoch der politische Stellenwert von Kultur zu wachsen und sich ein eigenständiges Politikfeld der Kulturpolitik zu entwickeln. Daran schließen sich weitere Fragen an. Welche kulturpolitischen Aufgaben hat in einem föderal strukturierten Kulturbetrieb der Staat? Mit welchen Ebenen und Institutionen ist er an ihrer Erfüllung beteiligt und wie verteilen sich die Zuständigkeiten?
Woher kommt die in der aktuellen Debatte erneut aufgeworfene These von einem „Kulturzentralismus“ in Deutschland und inwieweit ist sie möglicherweise berechtigt? Wo wiederum hat die These von einer „Legitimationskrise“ der deutschen Kulturpolitik ihren Ursprung, wonach in einer Gesellschaft, in der alles Kultur ist, Kulturpolitik notgedrungen in legitimative Schwierigkeiten geraten muss? Was die so genannte „Kulturhoheit der Länder“ betrifft, so wäre zu klären, welche Bedeutung diesem Begriff tatsächlich zugerechnet werden darf.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Die Entwicklung von Kulturpolitik in Deutschland
- Erweiterung des Kulturbegriffs - Die „Neue Kulturpolitik“ der 70er Jahre
- Von Programmatik zu Pragmatismus – Die Kulturpolitik der 80er Jahre
- Die Modernitätsfalle – Die Kulturpolitik der 90er Jahre
- Was ist Kulturpolitik? – Überlegungen zum Begriff
- Kulturelle Aufgaben des Staates
- Die „Kulturhoheit“ der Länder- ein missverstandener Begriff?
- Deutschland – ein Kulturstaat?
- Das Amt des Kulturstaatsministers – neuer Stellenwert für die Kultur?
- Die Debatte um Zuständigkeiten und die kulturpolitische Rolle des Bundes
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland seit den 1970er Jahren. Sie beleuchtet den Wandel des Kulturbegriffs, die Rolle des Staates und die Debatte um Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Der Fokus liegt auf der Entstehung und den Herausforderungen eines jungen Politikfeldes, geprägt von einer heterogenen Entwicklungsgeschichte.
- Wandel des Kulturbegriffs seit den 1970er Jahren
- Rolle des Staates in der Kulturpolitik
- Zuständigkeitsfragen zwischen Bund und Ländern
- Entwicklung des Kulturbetriebs in Deutschland
- Die „Kulturhoheit“ der Länder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Entwicklung von Kulturpolitik in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland, beginnend mit der Nachkriegszeit und der Abkehr von einem zentralisierten Kulturbetrieb. Es beschreibt die Entwicklung vom traditionellen Kulturverständnis hin zu einem universelleren Begriff, der alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfasst. Die Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Phasen der Kulturpolitik, markiert durch den Wandel des Kulturverständnisses und die damit verbundenen Herausforderungen für die Gestaltung und Förderung von Kultur. Der Fokus liegt auf der Entwicklung von der „Neuen Kulturpolitik“ der 70er Jahre bis zur „Modernitätsfalle“ der 90er Jahre, die durch die unterschiedlichen Ansätze in der Programmatik und Pragmatik der jeweiligen Epochen bestimmt waren. Der Übergang vom traditionellen Verständnis von Kultur zu einem umfassenderen Begriff wird detailliert erläutert, ebenso wie die Rolle des Staates und die verschiedenen Akteure im Kulturbetrieb.
Was ist Kulturpolitik? – Überlegungen zum Begriff: Dieses Kapitel befasst sich mit grundlegenden Fragen zum Begriff der Kulturpolitik. Es untersucht, wann und wie sich dieses Politikfeld entwickelt hat und welche Akteure an ihm beteiligt sind. Das Kapitel analysiert das komplexe Wesen der Kulturpolitik und die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden. Es hinterfragt die historische Entwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen. Dabei werden die unterschiedlichen Interpretationen des Kulturbegriffs und deren Auswirkungen auf die Aufgaben der Kulturpolitik beleuchtet.
Kulturelle Aufgaben des Staates: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage der kulturellen Aufgaben des Staates in einem föderalen System. Es analysiert die „Kulturhoheit“ der Länder und deren Bedeutung für die kulturpolitische Gestaltung. Es beleuchtet die Rolle des Bundes und die Debatte um Zuständigkeiten. Das Kapitel untersucht den Stellenwert des Amtes des Kulturstaatsministers und hinterfragt kritisch die These von einem „Kulturzentralismus“ in Deutschland und die Legitimationskrise der deutschen Kulturpolitik. Es präsentiert eine fundierte Auseinandersetzung mit dem komplexen Verhältnis zwischen staatlicher Verantwortung, föderaler Struktur und der Gestaltung von Kultur im deutschen Kontext.
Die Debatte um Zuständigkeiten und die kulturpolitische Rolle des Bundes: Dieses Kapitel analysiert die anhaltende Debatte um die kulturpolitische Rolle des Bundes in Deutschland. Es befasst sich mit der Frage nach den Kompetenzen und Zuständigkeiten des Bundes im Vergleich zu den Ländern. Das Kapitel analysiert die „Föderalismusdebatte“ und stellt die unterschiedlichen Positionen und Argumente der beteiligten Akteure dar. Es beleuchtet die Herausforderungen der Kompetenzverteilung in einem föderalen System und den Versuch, eine ausgewogene Kulturpolitik zu gestalten, welche die verschiedenen staatlichen Ebenen berücksichtigt. Die Diskussion um die Berechtigung einer Bundeskulturpolitik und die Schwierigkeiten, eine gemeinsame Linie zu finden, werden kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Kulturpolitik, Deutschland, Kulturbegriff, Föderalismus, Bund, Länder, Kulturhoheit, Zuständigkeiten, Kompetenzdebatte, Kulturstaat, Bundeskulturbeauftragter, Entwicklung, Geschichte.
FAQ: Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland seit den 1970er Jahren. Sie beleuchtet den Wandel des Kulturbegriffs, die Rolle des Staates und die Debatte um Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Der Fokus liegt auf der Entstehung und den Herausforderungen eines jungen Politikfeldes mit heterogener Entwicklungsgeschichte.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Kulturbegriffs seit den 1970er Jahren, die Rolle des Staates in der Kulturpolitik, Zuständigkeitsfragen zwischen Bund und Ländern, die Entwicklung des Kulturbetriebs in Deutschland und die „Kulturhoheit“ der Länder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: „Die Entwicklung von Kulturpolitik in Deutschland“, „Was ist Kulturpolitik? – Überlegungen zum Begriff“, „Kulturelle Aufgaben des Staates“, „Die Debatte um Zuständigkeiten und die kulturpolitische Rolle des Bundes“ und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel bietet einen detaillierten Einblick in die jeweiligen Aspekte der deutschen Kulturpolitik.
Wie wird die Entwicklung der Kulturpolitik in Deutschland dargestellt?
Die Entwicklung der Kulturpolitik wird historisch von der Nachkriegszeit bis in die 1990er Jahre hinein nachgezeichnet. Es werden die Phasen der „Neuen Kulturpolitik“ der 70er, die Kulturpolitik der 80er und die Kulturpolitik der 90er Jahre mit ihren jeweiligen Herausforderungen und Ansätzen (Programmatik und Pragmatismus) beschrieben. Der Wandel vom traditionellen Kulturverständnis zu einem umfassenderen Begriff wird detailliert erläutert.
Welche Rolle spielt der Staat in der Kulturpolitik?
Die Arbeit analysiert die Rolle des Staates in der Kulturpolitik, insbesondere die „Kulturhoheit“ der Länder und die Debatte um Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern. Die Bedeutung des Amtes des Kulturstaatsministers und die Frage nach einem „Kulturzentralismus“ in Deutschland werden kritisch beleuchtet.
Wie wird der Begriff „Kulturpolitik“ definiert und diskutiert?
Das Kapitel „Was ist Kulturpolitik?“ befasst sich mit grundlegenden Fragen zum Begriff der Kulturpolitik, untersucht seine historische Entwicklung und analysiert die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden. Die unterschiedlichen Interpretationen des Kulturbegriffs und deren Auswirkungen auf die Aufgaben der Kulturpolitik werden beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kulturpolitik, Deutschland, Kulturbegriff, Föderalismus, Bund, Länder, Kulturhoheit, Zuständigkeiten, Kompetenzdebatte, Kulturstaat, Bundeskulturbeauftragter, Entwicklung, Geschichte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an ein akademisches Publikum und dient der Analyse von Themen der deutschen Kulturpolitik.
- Citation du texte
- M.A. Sabine Krätzschmar (Auteur), 2004, Zwischen Kooperatismus und Kompetenzdebatte - Kulturpolitik in Deutschland seit den 70er Jahren, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33828