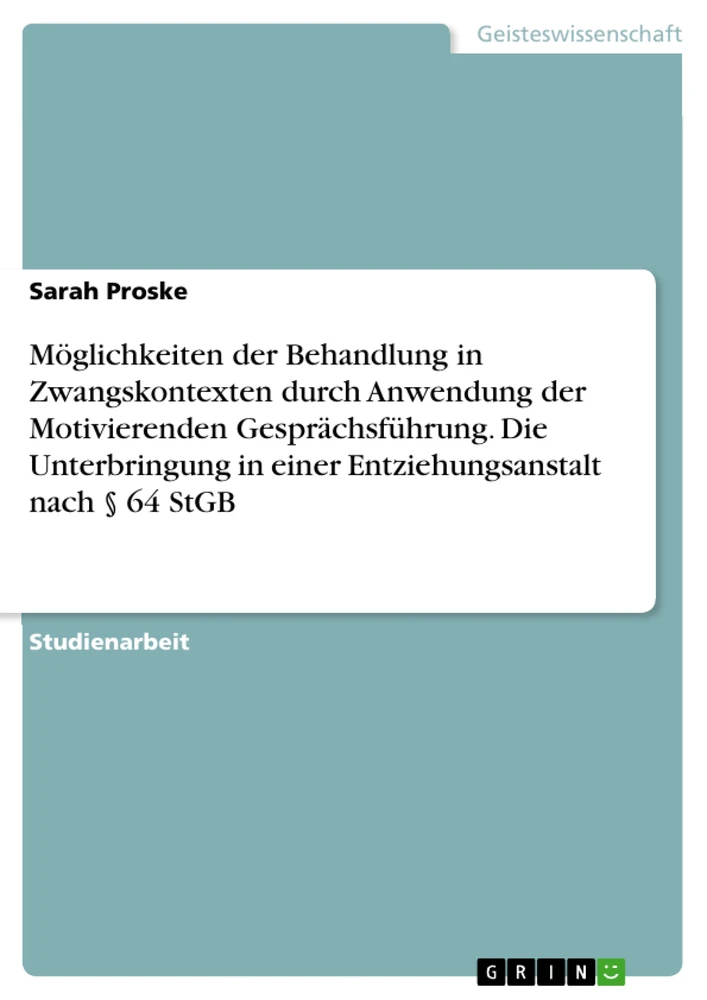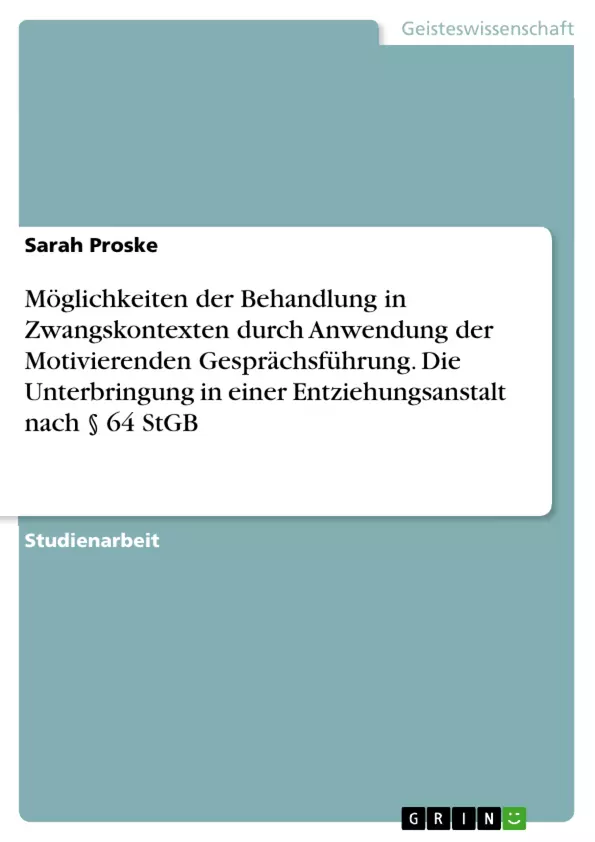Jeder Mensch hat das Recht, ohne Zwang und Einmischung Dritter sowie andere Einschränkungen zu leben. Jedoch befindet sich jeder Mensch fast täglich in Situationen, sich entscheiden zu müssen. Oft sind es nur kleine, unwichtige Entscheidungen, die wir treffen müssen: Esse ich den Apfel oder die Banane? Mache ich eine weitere Überstunde oder tue ich lieber etwas Gutes für mich? Wir stehen vielen Situationen und Entscheidungen ambivalent gegenüber. Daneben gibt es Situationen, in denen wir den inneren Zwang verspüren, etwas tun zu müssen, für das wir keine Motivation verspüren. Hier entwickeln sich innere Konflikte und der Zwang, sich trotz Ambivalenzen entscheiden zu müssen. Jedoch sind diese Konflikte und Zwänge nicht zu vergleichen mit Zwangssituationen, denen sich Klienten stellen müssen, die sich in Zwangskontexten der Sozialen Arbeit befinden. Sie kommen meist nicht mit intrinsischer Motivation zu uns, um eine Veränderung zu erzielen. Meist werden sie aufgrund Gesetzesauflagen oder unter Zwang von Angehörigen oder Freunden sowie Institutionen zu uns geschickt. In Situationen wie diesen liegt ein sogenannter Zwangskontext vor, dem sich Fachkräfte der Sozialen Arbeit stellen müssen und in dem es gilt, eine Veränderung des Klienten ‚herbeizuführen‘.
Dieser Zwangskontext soll im ersten Kapitel definiert werden. Daneben werden die Berufsfelder, in denen in Zwangskontexten gearbeitet wird, aufgeführt sowie ihr Klientel beschrieben. Außerdem werden Push- und Pullfaktoren aufgezeigt, die im Hinblick auf den Zwangskontext anziehend auf den Klienten wirken und ihn dazu bringen können, die aufgezwungene Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Rollenverständnis und den nötigen Fähigkeiten und Grundhaltungen, die eine Fachkraft in der Arbeit mit Klienten in Zwangskontexten aufweisen muss, um eine erfolgreiche Kooperation herzustellen. Als Beispiel für eine Methode, um mit Klienten in Zwangskontexten zu arbeiten, wird die Motivierende Gesprächsführung angeführt. Um die Möglichkeiten der Arbeit mit nicht-motivierten Klienten zu verdeutlichen, wird sich auf eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB konzentriert, welche im vierten Kapitel erläutert und im fünften Kapitel mit der Motivierenden Gesprächsführung in Verbindung gesetzt wird. Hier wird aufgezeigt, dass bei suchtkranken Straftätern, die keinerlei Veränderungsnotwendigkeit bei sich sehen und dadurch keine Motivation zur von Dritten gewünschten Verä
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Soziale Arbeit in Zwangskontexten
- Der Begriff „Zwangskontext“
- Berufsfelder und Klientel
- Push- und Pullfaktoren
- Vom Zwangskontext zur Freiwilligkeit
- Rollenverständnis der Fachkraft
- Fähigkeiten und Grundhaltungen der Fachkraft
- Vom Zwang zur Kooperation
- Mögliche Methoden in der Arbeit im Zwangskontext am Beispiel der Motivierenden Gesprächsführung
- Der Maßregelvollzug nach § 64 StGB – Das Beispiel eines Zwangskontextes
- § 64 StGB – „Unterbringung in einer Entziehungsanstalt“
- Veränderungsmotivation als Ziel des Maßregelvollzugs?
- Möglichkeiten der Anwendung von Motivierender Gesprächsführung bei suchtmittelabhängigen Straftätern
- Ambivalenz - Der erste Schritt zur Veränderung?!
- Veränderungsmotivation entstehen lassen
- Hilfreiche Fragen, die die Veränderungsmotivation verstärken
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert die Herausforderungen der Sozialen Arbeit in Zwangskontexten, insbesondere im Hinblick auf die Anwendung der Motivierenden Gesprächsführung. Sie untersucht, wie Fachkräfte mit Klienten umgehen können, die unter Zwang zur Teilnahme an Hilfeprogrammen stehen und keine intrinsische Motivation zur Veränderung aufweisen. Die Arbeit fokussiert sich auf den Kontext der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB, um die praktische Relevanz des Themas zu verdeutlichen.
- Definition des Zwangskontextes in der Sozialen Arbeit
- Herausforderungen und Chancen der Arbeit mit Klienten in Zwangskontexten
- Rollenverständnis und Kompetenzen der Fachkraft in der Arbeit mit nicht-motivierten Klienten
- Potenzial der Motivierenden Gesprächsführung zur Steigerung der Veränderungsmotivation bei suchtmittelabhängigen Straftätern
- Spezifische Herausforderungen und Lösungsansätze im Kontext des Maßregelvollzugs nach § 64 StGB
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert die Bedeutung des Themas Zwangskontexte in der Sozialen Arbeit und stellt die zentrale Fragestellung der Arbeit vor. Sie zeigt, dass Klienten in Zwangskontexten meist keine intrinsische Motivation zur Veränderung besitzen und die Notwendigkeit professioneller Unterstützung oft nicht erkennen.
Kapitel 1 definiert den Begriff des Zwangskontextes und beleuchtet die unterschiedlichen Berufsfelder und Klientel, die in diesen Kontexten auftreten. Es werden Push- und Pullfaktoren erörtert, die Klienten dazu bewegen können, die ihnen aufgezwungene Hilfe anzunehmen.
Kapitel 2 behandelt das Rollenverständnis und die Kompetenzen von Fachkräften, die mit Klienten in Zwangskontexten arbeiten. Es wird herausgestellt, dass die Fachkraft einen schwierigen Balanceakt zwischen Hilfestellung und Kontrolle bewältigen muss.
Kapitel 3 stellt den Maßregelvollzug nach § 64 StGB als Beispiel eines Zwangskontextes vor. Es wird die rechtliche Grundlage der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sowie die damit verbundenen Herausforderungen im Hinblick auf die Veränderungsmöglichkeit der Klienten betrachtet.
Kapitel 4 untersucht die Möglichkeiten der Anwendung der Motivierenden Gesprächsführung bei suchtmittelabhängigen Straftätern. Es wird deutlich gemacht, wie die Ambivalenz der Klienten genutzt werden kann, um eine intrinsische Motivation zur Veränderung zu fördern.
Schlüsselwörter
Zwangskontext, Soziale Arbeit, Motivierende Gesprächsführung, Maßregelvollzug, § 64 StGB, Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, Suchtmittelabhängigkeit, Straftäter, Veränderungsmotivation, Ambivalenz, Triple-Mandat, Hilfestellung, Kontrolle
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet „Zwangskontext“ in der Sozialen Arbeit?
Ein Zwangskontext liegt vor, wenn Klienten nicht aus eigenem Antrieb (intrinsisch), sondern aufgrund von Gesetzesauflagen, gerichtlichen Weisungen oder Druck durch Institutionen Hilfe in Anspruch nehmen.
Was ist das Ziel von § 64 StGB?
Dieser Paragraf regelt die Unterbringung von suchtkranken Straftätern in einer Entziehungsanstalt. Ziel ist es, die Sucht zu heilen oder eine erhebliche Zeitspanne vor Rückfällen zu bewahren, um weitere Straftaten zu verhindern.
Wie funktioniert Motivierende Gesprächsführung (MI)?
MI ist eine klientenzentrierte Methode, die darauf abzielt, Ambivalenzen beim Klienten aufzulösen und eine eigene Motivation zur Verhaltensänderung aufzubauen, anstatt Druck auszuüben.
Was sind Push- und Pullfaktoren im Zwangskontext?
Push-Faktoren sind der Druck von außen (z.B. drohende Haft), während Pull-Faktoren Anreize sind, die den Klienten zur Kooperation bewegen (z.B. Aussicht auf vorzeitige Entlassung oder Therapieerfolg).
Was ist das „Triple-Mandat“ der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Verpflichtung der Fachkraft gegenüber dem Klienten (Hilfe), dem Staat/Auftraggeber (Kontrolle) und der eigenen Profession (Ethik/Wissenschaft).
- Quote paper
- Sarah Proske (Author), 2013, Möglichkeiten der Behandlung in Zwangskontexten durch Anwendung der Motivierenden Gesprächsführung. Die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt nach § 64 StGB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338339