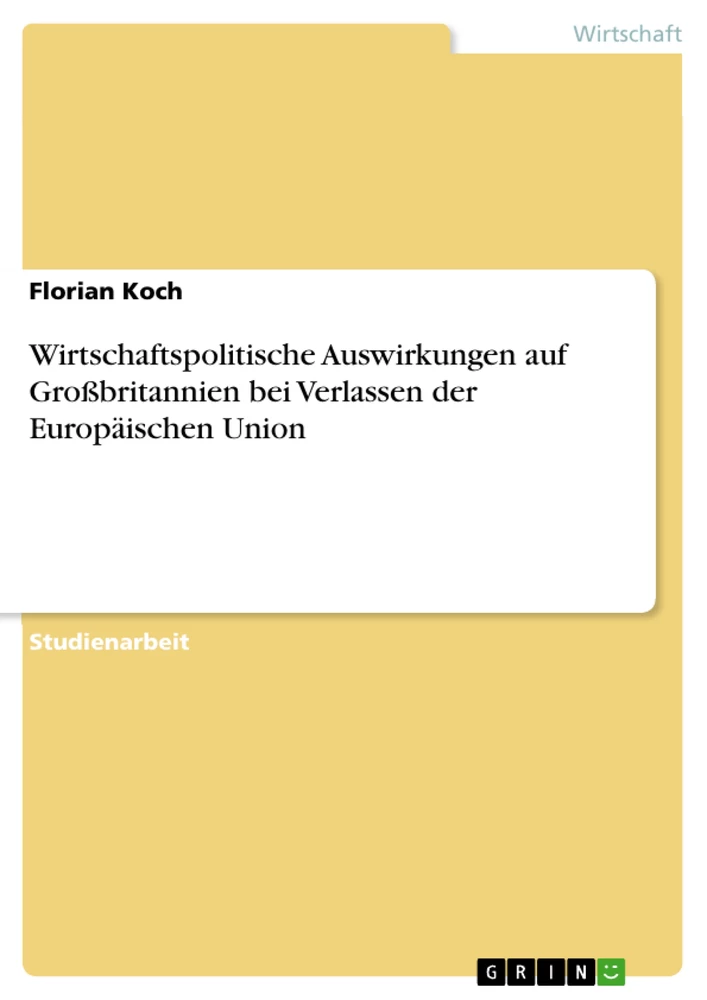Seit 01. Januar 1973 ist das Vereinigte Königreich Teil der Europäischen Union (EU). Vor allem seit der Finanzkrise im Jahr 2008 sind die Stimmen, die Union zu verlassen, immer lauter geworden. Einen möglichen Austritt Großbritanniens sprach der britische Premierminister David Cameron schließlich am 23. Januar 2013, in seiner Grundsatzrede zur allgemeinen Situation in Europa, offiziell an. Bereits vor seiner Rede ist bekannt geworden, dass eine Volksbefragung über den Verbleib in der EU entscheiden soll. Dies bestätigte David Cameron, sofern er bei den nächsten britischen Unterhauswahlen im Juni 2015 wiedergewählt werden sollte. Das EU-Referendum soll Ende 2017 stattfinden. Grundsätzlich forderte der britische Premier mehr Ausnahmen für sein Land, wobei er zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Forderungen stellte.
Dieses aktuelle und sowohl für Großbritannien als auch die Europäische Union bedeutende Thema, veranlasste mich zu dieser Seminararbeit. Unabhängig vom Ausgang des EU-Referendums im Jahr 2017, wird die Diskussion Veränderungen für beide Parteien nach sich ziehen. Die zentrale Frage der Arbeit wird sein, wie sich ein Austritt aus der EU wirtschaftspolitisch auf Großbritannien auswirken kann. Des Weiteren soll geklärt werden, wie beide Parteien aktuell zu einem EU-Austritt stehen und wie sich das Szenario in der jüngeren Vergangenheit entwickelt hat.
Ziel ist es zu beschreiben, welche konkreten Vor- und Nachteile für Großbritannien auftreten würden.
Um einen aktuellen Überblick zu erhalten, wird im zweiten Kapitel auf den politischen Kurs Großbritanniens gegenüber der EU und die themenbetreffenden Vorkommnisse in der jüngeren Vergangenheit eingegangen. Dies soll mit aktuellen Umfrageergebnissen bestätigt werden. Im Anschluss wird in Kapitel Drei beschrieben, ob ein Austritt aus der Union grundsätzlich möglich ist und in welche Stufen die regionalen bzw. europäische Integration untergliedert werden kann. Im vierten Kapitel werden die möglichen wirtschaftspolitischen Vorteile für Großbritannien behandelt. Danach wird im fünften und letzten Kapitel auf mögliche Nachteile für das Land eingegangen. Abschließend wird die Ausarbeitung kurz zusammengefasst, ein Fazit gezogen und ein Ausblick gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zentrale Frage und Ziel der Seminararbeit
- 1.3. Aufbau der Seminararbeit
- 2. Großbritannien und die Europäische Union
- 2.1. Der politische Kurs Großbritanniens im Bezug auf die EU.
- 2.2. Aktuelle Umfragewerte
- 2.3. Kapitelzusammenfassung
- 3. Europäische Integration
- 3.1. Vertragliche Regelung eines EU-Austritts
- 3.2. Stufen der regionalen Integration
- 3.3. Kapitelzusammenfassung.
- 4. Wirtschaftspolitische Vorteile eines EU-Austritts.
- 4.1. Einsparung des EU-Mitgliedsbeitrages
- 4.2. Unabhängigkeit von Brüssel...........
- 4.3. Kapitelzusammenfassung.
- 5. Wirtschaftspolitische Nachteile eines EU-Austritts
- 5.1 Verlust des freien Warenverkehrs
- 5.2 Verlust des freien Personenverkehrs.
- 5.3 Verlust der Dienstleistungs- und Kapitalfreiheit..
- 5.4 Verlust der Stimme in Europa
- 5.5 Verlust von Fördermitteln
- 5.6 Kapitelzusammenfassung ...
- 6. Schlussbetrachtung
- 6.1 Zusammenfassung....
- 6.2 Fazit...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert die potenziellen wirtschaftlichen Auswirkungen eines möglichen Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union. Das Ziel ist es, die relevanten Argumente für und gegen den EU-Austritt aus einer wirtschaftspolitischen Perspektive zu beleuchten und die möglichen Folgen für die britische Wirtschaft zu bewerten.
- Der politische Kurs Großbritanniens in Bezug auf die EU
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für einen EU-Austritt
- Die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile eines EU-Austritts
- Die potenziellen wirtschaftlichen Nachteile eines EU-Austritts
- Die Auswirkungen auf den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung, die zentrale Fragestellung und den Aufbau der Seminararbeit erläutert. Anschließend wird der politische Kurs Großbritanniens in Bezug auf die EU und die aktuellen Umfragewerte zur Austrittsfrage beleuchtet. Das dritte Kapitel befasst sich mit der europäischen Integration und den vertraglichen Regelungen für einen EU-Austritt. Im vierten Kapitel werden die potenziellen wirtschaftspolitischen Vorteile eines EU-Austritts, wie beispielsweise Einsparungen bei den EU-Mitgliedsbeiträgen und eine stärkere Unabhängigkeit von Brüssel, beleuchtet. Das fünfte Kapitel analysiert die potenziellen wirtschaftlichen Nachteile, wie beispielsweise der Verlust des freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs sowie der Verlust von Fördermitteln. Die Schlussbetrachtung fasst die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie dem Brexit, der Europäischen Union, Großbritannien, Wirtschaftspolitik, Freihandel, Wettbewerb, und den Auswirkungen eines EU-Austritts auf die britische Wirtschaft. Die Arbeit analysiert die verschiedenen wirtschaftlichen Argumente für und gegen einen EU-Austritt und beleuchtet die potenziellen Folgen für den freien Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr.
Häufig gestellte Fragen
Welche wirtschaftlichen Vorteile erhoffte sich Großbritannien von einem EU-Austritt?
Zu den genannten Vorteilen gehören die Einsparung der EU-Mitgliedsbeiträge, die Rückgewinnung der vollen Souveränität über die eigene Gesetzgebung und die Möglichkeit, eigenständige Handelsabkommen weltweit abzuschließen.
Was sind die größten wirtschaftlichen Nachteile eines EU-Austritts?
Hauptnachteile sind der Verlust des barrierefreien Zugangs zum EU-Binnenmarkt, die Einführung von Zöllen und Handelshemmnissen sowie der Wegfall der Freizügigkeit für Arbeitskräfte.
Wie wirkt sich der Austritt auf den Finanzplatz London aus?
Der Austritt gefährdet den "EU-Pass", der es Finanzdienstleistern ermöglicht, ihre Dienste in der gesamten Union anzubieten, was zu einer Abwanderung von Unternehmen führen kann.
Was bedeutet der Verlust der "Stimme in Europa"?
Großbritannien verliert sein Mitspracherecht bei der Gestaltung von EU-Standards und -Gesetzen, an die es sich im Handel mit dem Kontinent dennoch oft halten muss.
Gibt es eine vertragliche Regelung für den EU-Austritt?
Ja, Artikel 50 des Vertrags über die Europäische Union regelt das Verfahren, nach dem ein Mitgliedstaat seinen Austritt erklären und verhandeln kann.
- Quote paper
- Florian Koch (Author), 2015, Wirtschaftspolitische Auswirkungen auf Großbritannien bei Verlassen der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338428