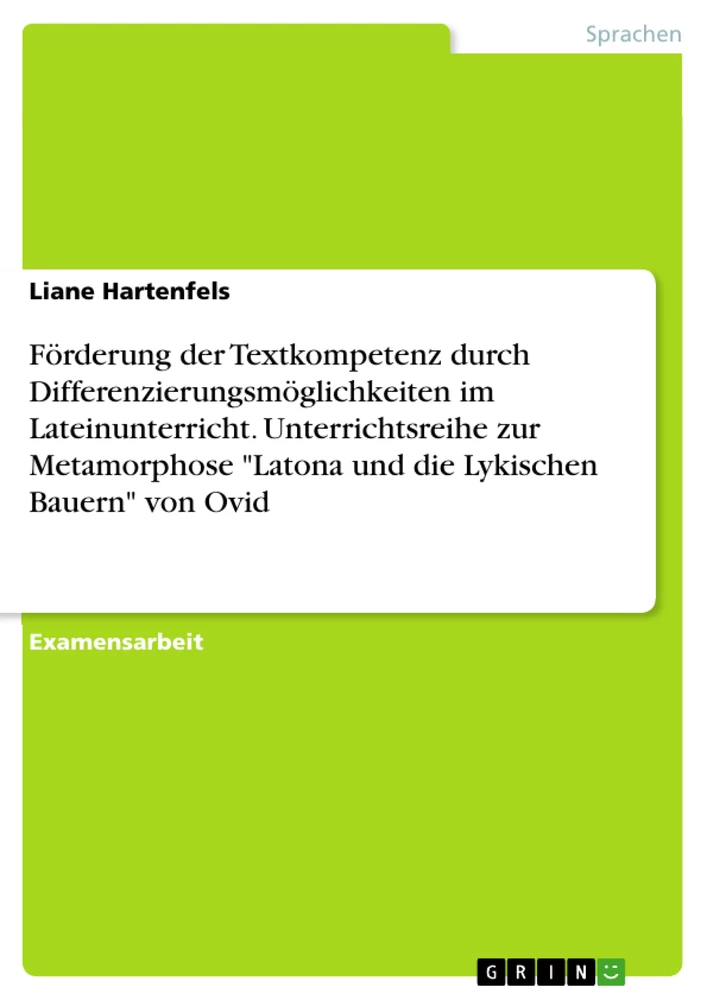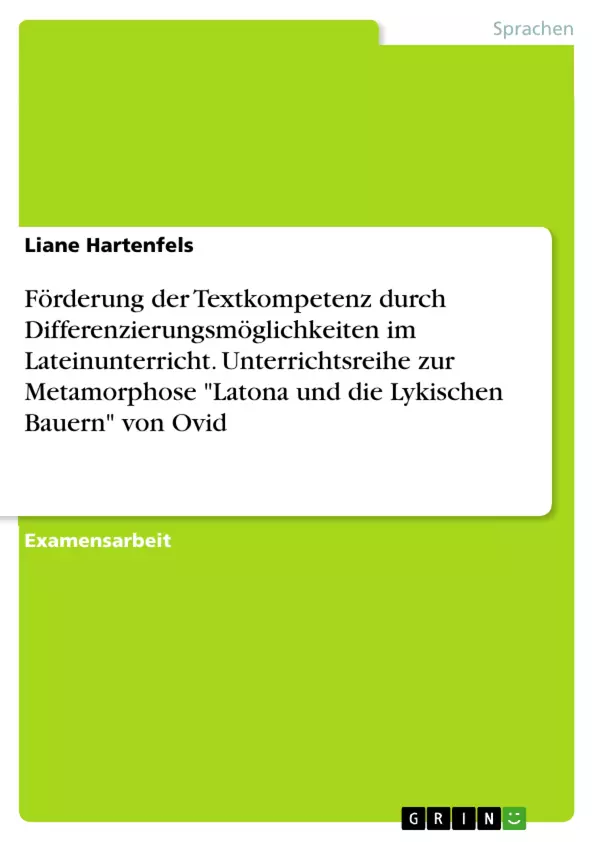Ziel meiner Arbeit ist es, verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht anhand einer durchgeführten Unterrichtsreihe zu Ovids Metamorphose „Latona und die Lykischen Bauern“ aufzuzeigen und „Rom“ somit auf verschiedenen Wegen zu erreichen. Auf diese Weise soll der Heterogenität entgegengewirkt und eine Angleichung der Arbeitstempi erreicht werden.
Da die Formen von differenziertem Unterricht in Latein noch in den Kinderschuhen stecken, möchte ich in dieser Arbeit einige ausgewählte Formen von Differenzierung erproben und auf ihre Funktionalität hin überprüfen. Dafür soll in einem ersten Schritt geklärt werden, was man unter dem theoretischen Begriff der Differenzierung versteht. Anschließend werden die beiden Ebenen der Differenzierung allgemein kurz erörtert, um daraufhin die Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht theoretisch vorzustellen.
Der Hauptteil meiner Arbeit befasst sich mit der praktischen Umsetzung dieser vorgestellten Maßnahmen. Dieser Teil umfasst eine Sachanalyse der von mir ausgewählten Metamorphose „Latona und die Lykischen Bauern“ sowie eine umfassenden Analyse der pädagogischen Situation auf der Grundlage eines Kompetenzrasters und eines Diagnosetests. Ferner werden in zwei ausgewählten Unterrichtssequenzen verschiedene Formen von Differenzierung vorgestellt, erprobt und reflektiert. Abschließend soll evaluiert werden, inwiefern die eingesetzten Maßnahmen für die SuS eine Hilfe waren und welche Fortschritte bezüglich der Textkompetenz erzielt werden konnten.
Betrachtet man den Alltag in unseren Schulen so lässt sich konstatieren, dass die so dringend notwendige Binnendifferenzierung im Lateinunterricht leider – wenn überhaupt – nur in Ansätzen erfolgt. Ebenso zeigte die Sichtung diverser Lektüreausgaben zu Ovid, dass keine Ausgabe der natürlichen Heterogenität eines Lateinkurses in der Oberstufe gerecht wird. Die gesichteten Ausgaben überzeugen zwar durch kreative Gestaltung, setzen aber voraus, dass man „Rom“ nur auf einem einzigen Weg erreichen kann. Eine differenzierte Ausgestaltung des Lateinunterrichts, bleibt somit der Initiative des Lehrers überlassen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Definition
- Differenzierungsebenen
- Äußere Differenzierung
- Innere Differenzierung
- Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht
- Differenzierung nach Lernwegen
- Differenzierung nach Interessen
- Differenzierung nach Umfang des Lernstoffes
- Differenzierung nach Anforderungsniveau
- Differenzierung nach Anforderungsniveau u. Interessen
- Differenzierung nach Unterrichts- und Sozialform
- Problembereiche der Differenzierung im Lateinunterricht
- Didaktische Vorüberlegungen
- Analyse der pädagogischen Situation
- Sachanalyse
- Praktische Umsetzung
- Durchführung Unterrichtssequenz I
- Durchführung Unterrichtsequenz II
- Evaluation und Reflexion der Unterrichtsreihe
- Auswertung des Kompetenzrasters
- Auswertung des Diagnosetests
- Auswertung des Evaluationsbogens
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Möglichkeiten der Binnendifferenzierung im Lateinunterricht anhand einer durchgeführten Unterrichtsreihe zu Ovids Metamorphose „Latona und die Lykischen Bauern“. Ziel ist es, verschiedene Differenzierungsformen vorzustellen und zu erproben, um der Heterogenität in Lateinklassen gerecht zu werden und eine Angleichung der Arbeitstempi zu erreichen. Die Arbeit beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Differenzierung sowie die praktische Umsetzung in einer konkreten Unterrichtseinheit.
- Definition und Ebenen der Differenzierung
- Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht
- Analyse der pädagogischen Situation und der Metamorphose „Latona und die Lykischen Bauern“
- Praktische Umsetzung von Differenzierungsformen in zwei Unterrichtssequenzen
- Evaluation und Reflexion der eingesetzten Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Differenzierung im Lateinunterricht ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Der zweite Teil der Arbeit befasst sich mit den theoretischen Grundlagen der Differenzierung, definiert den Begriff und erläutert die beiden Ebenen der äußeren und inneren Differenzierung. Der dritte Teil stellt verschiedene Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht vor, die in der Praxis angewandt werden können. Der vierte Teil widmet sich der didaktischen Vorüberlegung, indem er die pädagogische Situation analysiert und die Metamorphose „Latona und die Lykischen Bauern“ genauer betrachtet. Im fünften Teil werden zwei Unterrichtssequenzen vorgestellt, in denen verschiedene Differenzierungsformen in der Praxis erprobt werden. Der sechste Teil evaluiert die Unterrichtsreihe und reflektiert die eingesetzten Maßnahmen.
Schlüsselwörter
Differenzierung, Lateinunterricht, Ovid, Metamorphose, „Latona und die Lykischen Bauern“, Binnendifferenzierung, Heterogenität, Unterrichtssequenz, Kompetenzraster, Diagnosetest, Evaluation, Textkompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Differenzierung im Lateinunterricht notwendig?
Da Lateinkurse oft sehr heterogen sind, hilft Differenzierung dabei, unterschiedliche Arbeitstempi und Lernniveaus auszugleichen, sodass jeder Schüler die Lernziele erreichen kann.
Was ist der Unterschied zwischen äußerer und innerer Differenzierung?
Äußere Differenzierung erfolgt durch die Einteilung in Schulformen oder Kurse. Innere Differenzierung (Binnendifferenzierung) findet innerhalb einer Klasse statt, z.B. durch unterschiedliche Aufgabenstellungen oder Hilfsmittel.
Wie kann man Ovids Metamorphosen differenziert unterrichten?
Durch Differenzierung nach Lernwegen (z.B. verschiedene Texthilfen), Interessen (kreative vs. analytische Aufgaben) oder Anforderungsniveau (Komplexität der Interpretationsfragen).
Was ist ein Kompetenzraster im Lateinunterricht?
Ein Kompetenzraster hilft Lehrern und Schülern, den aktuellen Stand der Textkompetenz (Wortschatz, Grammatik, Interpretation) objektiv einzuschätzen und individuelle Fortschritte zu planen.
Welche Rolle spielt die Metamorphose "Latona und die Lykischen Bauern"?
Sie dient in dieser Arbeit als praktisches Beispiel, um aufzuzeigen, wie ein komplexer lateinischer Text durch differenzierte Methoden für alle Schüler zugänglich gemacht werden kann.
- Citar trabajo
- Liane Hartenfels (Autor), 2012, Förderung der Textkompetenz durch Differenzierungsmöglichkeiten im Lateinunterricht. Unterrichtsreihe zur Metamorphose "Latona und die Lykischen Bauern" von Ovid, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338494