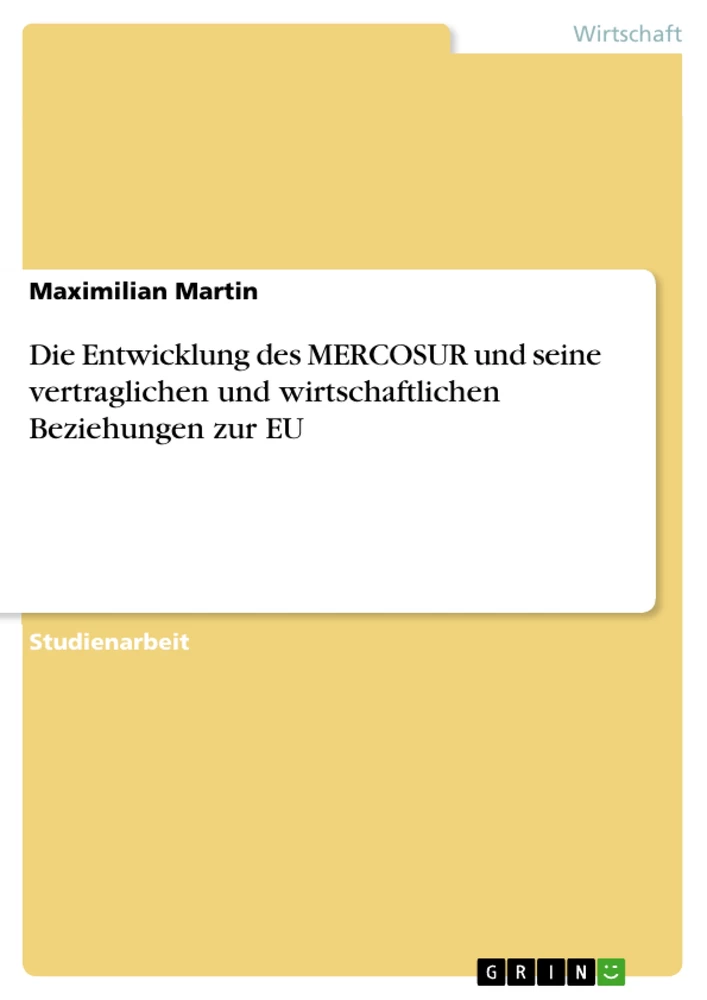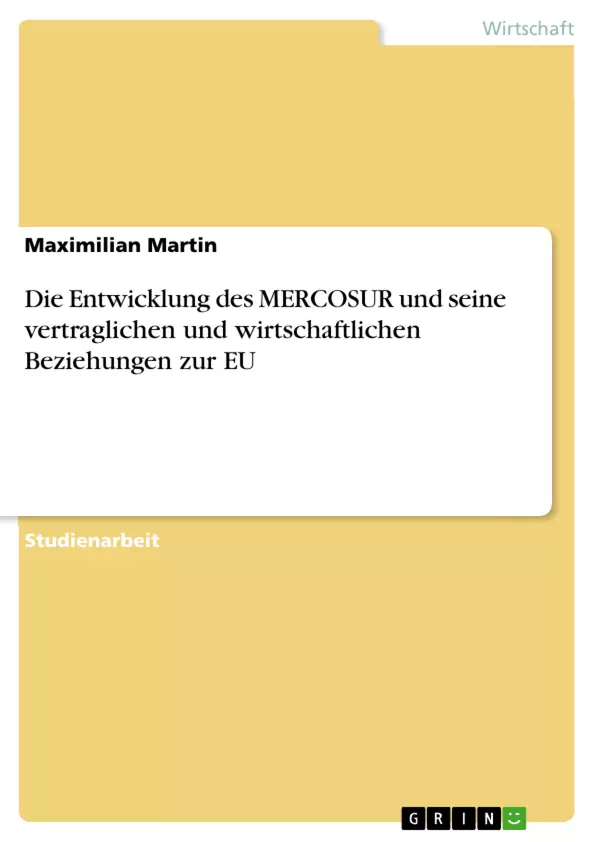In Zeiten der Globalisierung nehmen die internationalen Märkte immer mehr an Bedeutung zu. In jüngster Zeit wurden weltweit Freihandelsabkommen ausgehandelt, die die globale Wirtschaft maßgeblich beeinflussen. Eines dieser Freihandelsabkommen ist der Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Durch die Gründung des MERCOSUR im Jahr 1991 erlebte Lateinamerika einen wirtschaftlichen Umbruch. Der Außenhandel erhöhte sich rasch und die wirtschaftlichen Beziehungen zu anderen Freihandelsabkommen wurden aufgenommen.
In dieser Seminararbeit liegt der Fokus auf dem Außenhandel des MERCOSUR und den wirtschaftlichen Effekten nach seiner Gründung. Zu Beginn wird der Begriff MERCOSUR grob definiert. Anschließend wird die Gründung und die historische Entwicklung der MERCOSUR erläutert. Daraufhin werden seine Organe charakterisiert, um besser zu verstehen, wie der MERCOSUR in den internationalen Beziehungen handelt. Darauf aufbauend werden die Ziele des MERCOSUR formuliert. Schließlich werden die Probleme und Herausforderungen beschrieben, die sich aus dem Versuch ergeben, die Ziele zu erreichen.
Daraufhin wird in Kapitel drei zunächst die Integrationstheorie und folglich die Begriffe Handelsschaffung und Handelsumlenkung erklärt, um besser die zur Zeit der Gründung des MERCOSUR enstandenen wirtschaftlichen Veränderungen zu verstehen. Weiterführend wird in Kapitel vier der Außenhandel der MERCOSUR analysiert und die wirkenden Handelseffekte erläutert.
Das fünfte Kapitel umfasst die vertraglichen Beziehungen zwischen dem MERCOSUR und der EU. Hierbei werden zunächst die Erwartungen des MERCOSUR und der EU veranschaulicht. Nachdem die wirtschaftliche Entwicklung zwischen dem MERCOSUR und der EU dargestellt wird, werden schließlich die Probleme erörtert. Aufbauend auf den Problemen schließt das Kapitel fünf mit den Zukunftsperspektiven ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was ist der MERCOSUR?
- 2.1 Gründung und historische Entwicklung des MERCOSUR
- 2.2 Organe
- 2.3 Die Ziele der MERCOSUR
- 2.4 Probleme und Herausforderungen
- 3. Integrationstheorie
- 3.1 Handelsumlenkung
- 3.2 Handelsschaffung
- 4. Der Außenhandel der MERCOSUR
- 4.1 Export
- 4.2 Import
- 4.3 Handelseffekte der MERCOSUR
- 5. Die vertraglichen Beziehungen zwischen der MERCOSUR und EU
- 5.1 Erwartungen von MERCOSUR und EU
- 5.2 Entwicklung zwischen der MERCOSUR und der EU
- 5.3 Probleme zwischen der MERCOSUR und der EU
- 5.4 Perspektive
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Außenhandel des MERCOSUR und den wirtschaftlichen Effekten nach seiner Gründung. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des MERCOSUR, seine Organe und seine Ziele, sowie die Herausforderungen, die sich bei der Umsetzung dieser Ziele stellen. Des Weiteren werden die Integrationstheorie und die Begriffe Handelsschaffung und Handelsumlenkung im Kontext des MERCOSUR erläutert. Die Arbeit untersucht den Außenhandel des MERCOSUR, inklusive Export und Import sowie die resultierenden Handelseffekte. Schließlich werden die vertraglichen Beziehungen zwischen dem MERCOSUR und der EU beleuchtet, einschließlich der Erwartungen beider Seiten, der wirtschaftlichen Entwicklung, der bestehenden Probleme und der zukünftigen Perspektiven.
- Entwicklung des MERCOSUR und seine Organe
- Ziele und Herausforderungen des MERCOSUR
- Integrationstheorie, Handelsschaffung und Handelsumlenkung
- Außenhandel des MERCOSUR und seine Handelseffekte
- Vertragliche Beziehungen zwischen MERCOSUR und EU
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert eine Einleitung und führt in das Thema der Seminararbeit ein. Kapitel zwei beleuchtet den MERCOSUR, einschließlich seiner Gründung, seiner historischen Entwicklung, seiner Organe und seiner Ziele. Darüber hinaus werden die Herausforderungen diskutiert, die sich bei der Verwirklichung dieser Ziele stellen. Kapitel drei erklärt die Integrationstheorie und die Konzepte Handelsschaffung und Handelsumlenkung, um die wirtschaftlichen Veränderungen, die mit der Gründung des MERCOSUR einhergingen, besser zu verstehen. Kapitel vier analysiert den Außenhandel des MERCOSUR, einschließlich Export, Import und der Auswirkungen auf den Handel.
Schlüsselwörter
MERCOSUR, Freihandelsabkommen, Außenhandel, Integrationstheorie, Handelsschaffung, Handelsumlenkung, EU, wirtschaftliche Beziehungen, Lateinamerika, Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der MERCOSUR?
Der MERCOSUR (Mercado Común del Sur) ist ein 1991 gegründetes Freihandelsabkommen in Lateinamerika, das den Außenhandel der Region maßgeblich beeinflusst hat.
Was bedeuten die Begriffe Handelsschaffung und Handelsumlenkung?
Dies sind Begriffe aus der Integrationstheorie, die wirtschaftliche Veränderungen und Effekte beschreiben, die durch die Gründung eines regionalen Handelsbündnisses entstehen.
Welche Ziele verfolgt der MERCOSUR?
Die Ziele umfassen die wirtschaftliche Integration der Mitgliedsstaaten, die Steigerung des Außenhandels und die Stärkung der Position in internationalen Beziehungen.
Wie gestalten sich die Beziehungen zwischen MERCOSUR und der EU?
Es bestehen vertragliche Beziehungen, die von gegenseitigen Erwartungen und wirtschaftlicher Entwicklung geprägt sind, aber auch vor Problemen und Herausforderungen stehen.
Welche Herausforderungen gibt es für den MERCOSUR?
Zu den Herausforderungen gehören Probleme bei der Zielumsetzung, die Bewältigung wirtschaftlicher Effekte im Außenhandel sowie die Abstimmung der Organe.
- Citar trabajo
- Maximilian Martin (Autor), 2016, Die Entwicklung des MERCOSUR und seine vertraglichen und wirtschaftlichen Beziehungen zur EU, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338552