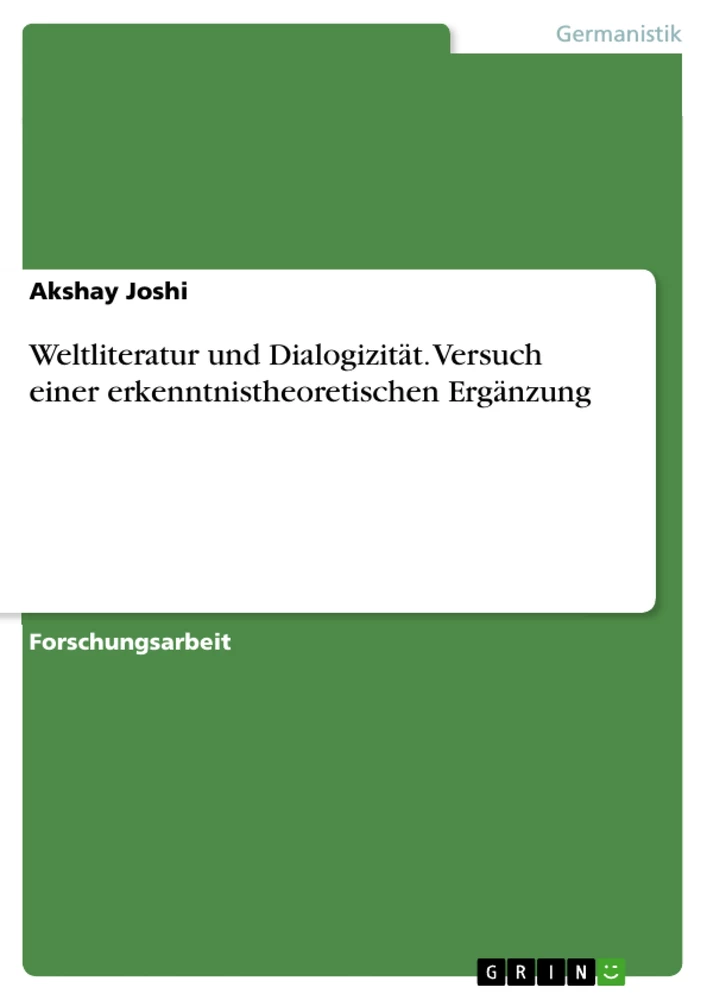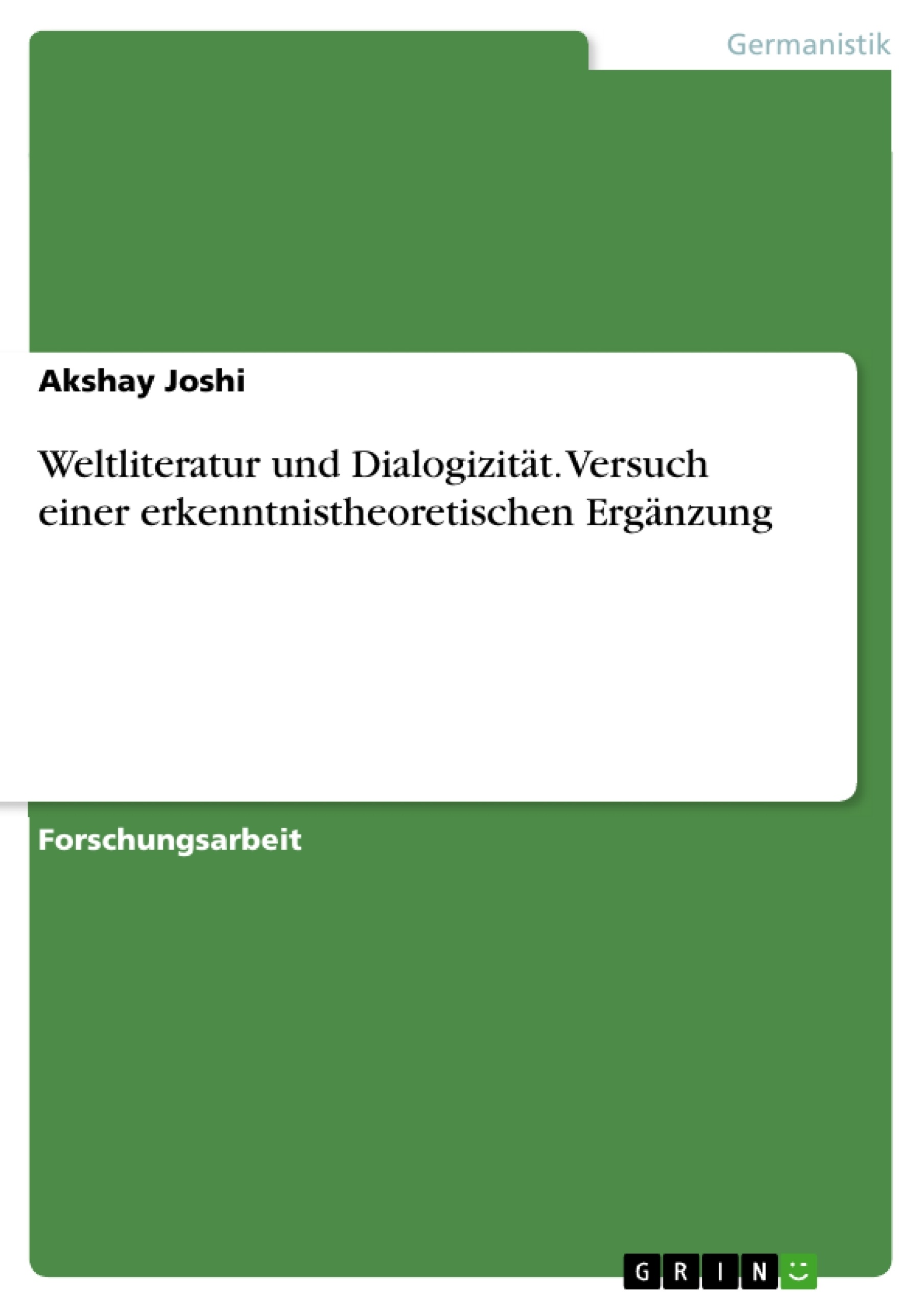In der folgenden Arbeit wird die Idee der Weltliteratur im Lichte des Diskurses über die Dialogizität und der Kommunikationsphilosophie ausgelegt. Spricht die Idee der Weltliteratur vom Gespräch zwischen der eigenen und der fremden Kultur, so wird hier versucht, den Begriff des Gesprächs im Lichte der Theorie des Dialogs und der Kommunikationsphilosophie erkenntnistheoretisch unter die Lupe zu nehmen. Darum ist der folgende Versuch als eine Ergänzungsarbeit anzusehen, in der eine Auslegung der Idee der Weltliteratur von der Perspektive der Theorie des Dialogs und der Kommuniktionsphilosophie angestrebt wird.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Hauptidee des Textes "Die Weltliteratur"?
Der Text "Die Weltliteratur" untersucht die Idee der Weltliteratur, die auf einer kosmopolitischen Vorstellung des Weltbürgertums beruht. Es geht darum, fremde Kulturen kennenzulernen und dadurch ein erneutes Verständnis über die eigene Kultur zu erreichen. Die dialektische Beschäftigung zwischen der eigenen und der fremden Kultur soll zu einem "erhabenen" Bewusstsein des Weltbürgertums führen.
Wer hat den Begriff der Weltliteratur geprägt?
Der Begriff der Weltliteratur geht auf Johann Wolfgang von Goethe zurück, der eine entscheidende Rolle bei den geistigen Strömungen des 18. und 19. Jahrhunderts in Europa spielte. Seine Idee entstand in einem politischen und technologischen Klima, in dem nationalistische Tendenzen und grenzüberschreitende Kommunikation durch technische Entwicklungen gleichzeitig präsent waren.
Welche Instrumente dienen der Weltliteratur?
Die Weltliteratur manifestiert sich durch verschiedene Instrumente, darunter literarische und wissenschaftliche Übersetzungen, Briefwechsel zwischen Autoren, Zeitschriften und Reisen. Diese Instrumente fördern die interkulturelle Kommunikation und ermöglichen die Anerkennung verschiedener Kulturen und Nationen.
In welchem historischen Kontext entstand die Idee der Weltliteratur?
Die Idee der Weltliteratur entstand im Kontext des Humanismus des 18. und 19. Jahrhunderts als eine kosmopolitische Reaktion auf den zunehmenden Nationalismus in Europa. Dabei spielten die Aufklärung, die Industrialisierung und die Moderne eine entscheidende Rolle.
Wie veränderte sich die Vorstellung von Zeit und Raum in der Moderne?
In der Moderne wurde die zirkuläre Zeit durch die lineare Zeit und damit das Fortschrittsdenken ersetzt. Das Netzwerkartige Denken entwickelte sich seit dem 18. Jahrhundert und betrat auch die Gebiete der Technik und Urbanisierung. Erfindungen wie das Dampfschiff, die Eisenbahn und der Telegraph trugen zur Veränderung der Raum-Vorstellung bei.
Welche weltliterarischen Tendenzen gab es um 1800?
Goethes Idee der Weltliteratur entstand aus einem diskursiven Klima des universiellen Denkens. Er baute seine Gedanken auf dem Boden weltliterarischer Denkrichtungen seiner Vorgänger auf, wobei die Aufklärung als Epizentrum betrachtet wurde.
Was bedeutet "Alterität" im Zusammenhang mit Weltliteratur?
Die Alterität bildet die Voraussetzung für Duldung und Toleranz. Goethe wurde der Alterität in seinem Land durch verschiedene Erfahrungen gewahr, die zu seiner Auseinandersetzung mit fremden Kulturen und Literaturen führten.
Welche Rolle spielte der Kampf gegen Einsamkeit in Goethes Idee der Weltliteratur?
Der Drang, fremde Kulturen und Literaturen kennenzulernen, diente bei Goethe dem Kampf gegen seine geistige Einsamkeit. Dabei spielte die steigende Bedeutung der Post eine wichtige Rolle, da sie zum Medium für die Verbreitung der Geschichten der eigenen Individualität und Dichtung wurde.
Welche Bedeutung hat die Zeitgenossenschaft in der Weltliteratur?
Goethe schlug die Übersetzung von zeitgenössischen Literaturen vor, um die zeitgenößische Existenz verschiedener Völker, Kulturen und Nationen anzuerkennen. Die Zeitgenossenschaft nimmt einen wichtigen methodologischen Platz in der Vorstellung der Weltliteratur ein.
Welche Bedeutung hat der Raum in Goethes Idee der Weltliteratur?
Die Idee der Weltliteratur enthält einen methodologischen Perspektivenwechsel von der Kategorie der Zeit zu der Kategorie des Raumes. Goethe unterscheidet zwischen einem politischen Territorium und dem Territorium der poetischen Kräfte.
Welche Rolle spielt das Gespräch in der Weltliteratur?
Der Weltliteratur liegt der kommunikative Ansatz zugrunde. Goethe betont die Idee des Gesprächs, das zur Bildung des Menschen dienen soll. Das transnationale Gespräch kann ohne die darin bestehenden Machtverhältnisse nicht angesehen werden.
Was bedeutet Dialogizität?
Dialogizität bezieht sich auf den Dialog als eine Lebensweise und epistemologische Grundlage, bei der der Mensch sich seiner bewusst wird, wenn er einen Dialog mit dem Fremden eingeht. Das Selbst und der Fremde werden zu grundlegenden Erkenntniskategorien.
Wie steht der Dialog im Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie?
Der Dialog steht im engen Zusammenhang mit der Erkenntnistheorie. Die Frage der Selbsterkenntnis steht im Mittelpunkt eines jeden Dialogs und es geht darum, wie der Mensch die Wahrheit über sich selbst und seine Existenz in der Welt erkennt.
Wie werden das Selbst und der Fremde im Dialog betrachtet?
Nach der Krise der cartesianischen Metaphysik geht es nicht um das selbstständige Bewusstsein des Subjekts, das einen Fremden braucht, sondern es entsteht eine neue Ontologie, nämlich die Fremdheit des Fremden selbst als das Bewusstsein.
Welchen Zusammenhang gibt es zwischen dem Dialog und der Kommunikationsphilosophie?
Es gibt enge Verbindungen zwischen dem Dialog und der Kommunikationsphilosophie. Die menschliche Kommunikation ist ein Kunstgriff, dessen Absicht es ist, uns die brutale Sinnlosigkeit eines zum Tode verurteilten Lebens vergessen zu lassen.
Was ist das Verhältnis zwischen Weltliteratur und Dialogizität?
Die Idee der Weltliteratur lehnt die cartesianische Zentrum-Peripherie Struktur ab und betont die Bedeutung der Gleichzeitigkeit und der Zeitgenossenschaft. Die Wende zum Raum zersplittert das Subjekt und stellt es als eine intersubjektive Pluralität dar.
- Arbeit zitieren
- Akshay Joshi (Autor:in), 2016, Weltliteratur und Dialogizität. Versuch einer erkenntnistheoretischen Ergänzung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338583