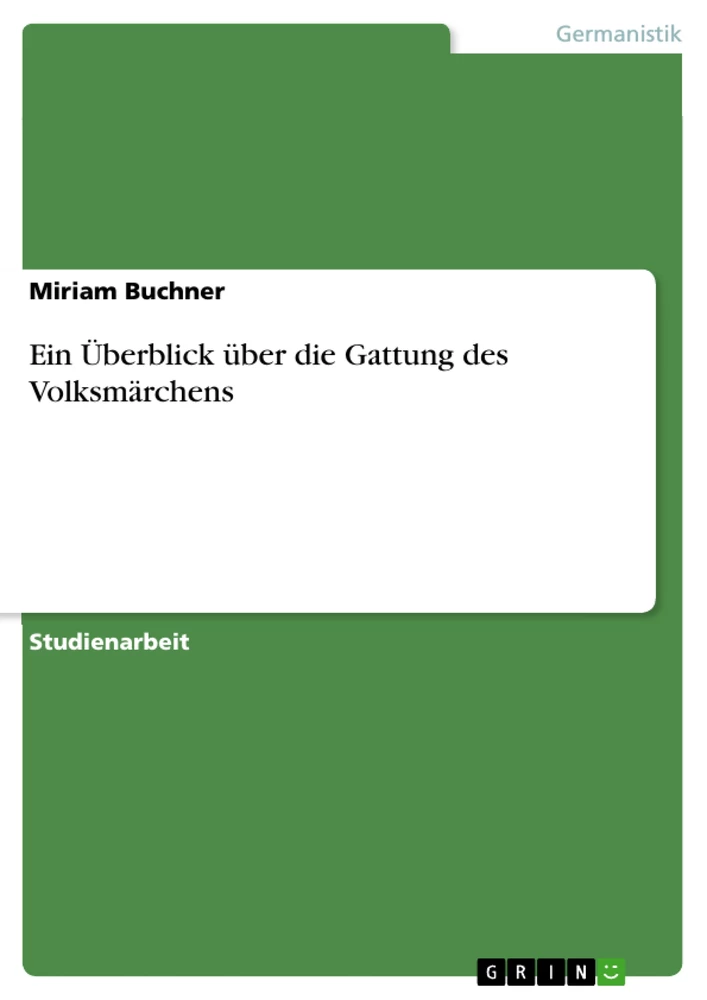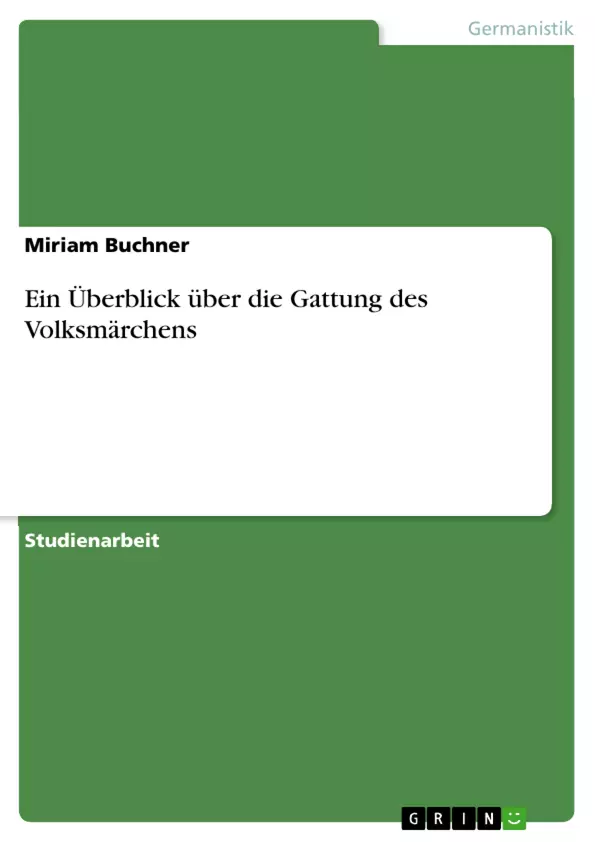Diese Arbeit gibt einen Einblick in verschiedene Aspekte der Gattung Volksmärchen. Neben Gattungsmerkmalen und einem idealtypischen Aufbau wird unter anderem auch auf Protagonisten und Requisiten eingegangen.
Zudem wird der Aspekt der Adressaten behandelt, welche ursprünglich nicht, wie häufig angenommen, Kinder sind. Die Ausführungen werden anschließend am Beispiel eines bekannten Volksmärchens veranschaulicht.
„Märlein“ oder „Märchen“ sind Verkleinerungsformen zum Wort „Mär“, welches ursprünglich ein Begriff für eine kleine Geschichte war. Dieser Begriff erfuhr im Laufe der Zeit eine Bedeutungsverschlechterung, sodass er schließlich nicht mehr nur allgemein für „Geschichte“ stand. Er wurde von nun an für erfundene, unwahre Geschichten verwendet. In der Literatur finden sich oft die Begriffe „eigentliche (Zauber)Märchen“ und „Märchen im eigentlichen Sinn“, welche Geschichten bezeichnen, in denen Übernatürliches, Zauber und Wunder vorkommen. (vgl. Lüthi 2004, S. 1 f.)
Inhaltsverzeichnis
- Begriff
- Gattungsmerkmale
- Grober Aufbau eines idealtypischen Volksmärchens
- Protagonisten und Requisiten
- Märchensammlungen
- Adressaten
- Verdeutlichung am Beispiel Schneewittchen
- Kurze Zusammenfassung des Märchens
- Analyse
- Zusammenfassung und persönliches Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Volksmärchen und untersucht deren Gattungsmerkmale, Protagonisten, Requisiten, Handlungsstrukturen und Adressaten. Die Analyse von „Schneewittchen“ dient als konkretes Beispiel, um die verbreitete Annahme zu beleuchten, dass Volksmärchen Geschichten für Kinder sind.
- Analyse von Gattungsmerkmalen des Volksmärchens
- Untersuchung der Hauptfiguren und Requisiten
- Erörterung des Handlungsaufbaus und der typischen Elemente
- Diskussion der Adressaten und ihrer Interpretation von Volksmärchen
- Kritik der verbreiteten Annahme von Volksmärchen als Kinderliteratur
Zusammenfassung der Kapitel
- Das Kapitel „Begriff“ definiert den Begriff „Märchen“ und unterscheidet zwischen „eigentlichen (Zauber)Märchen“ und Volksmärchen. Es wird die Entstehung des Begriffs beleuchtet und auf die Rolle mündlicher Traditionen im Kontext der Volksmärchen eingegangen.
- Das Kapitel „Gattungsmerkmale“ untersucht die charakteristischen Merkmale von Volksmärchen, wie die Einsträngigkeit der Handlung, die Ort- und Zeitlosigkeit, die Flächenhaftigkeit der Figuren, die Eindimensionalität des Wunderbaren und die Sublimation der Wirklichkeit.
- Das Kapitel „Grober Aufbau eines idealtypischen Volksmärchens“ beschreibt den typischen Handlungsaufbau von Volksmärchen, der sich in der Regel auf das Schema „Schwierigkeiten und ihre Bewältigung“ reduziert. Es werden die Rolle des Helden, die Ausgangssituation, die Handlungsmotive und die typischen Abschlüsse von Volksmärchen beleuchtet.
- Das Kapitel „Protagonisten und Requisiten“ analysiert die Hauptfiguren und Requisiten des Volksmärchens. Es wird auf die Charakterisierung der Figuren durch Rollenzuschreibungen und Attribute eingegangen, sowie auf die Bedeutung der Requisiten für die Handlung.
- Das Kapitel „Märchensammlungen“ befasst sich mit der Entstehung und Bedeutung von Märchensammlungen, insbesondere mit den „Kinder- und Hausmärchen“ der Brüder Grimm. Es werden bedeutende Werke vor den „Kinder- und Hausmärchen“ genannt und die Entwicklung der Märchensammlungen im 19. Jahrhundert beleuchtet.
Schlüsselwörter
Volksmärchen, Gattungsmerkmale, Protagonisten, Requisiten, Handlungsaufbau, Adressaten, Einsträngigkeit, Flächenhaftigkeit, Sublimation, „Kinder- und Hausmärchen“, Brüder Grimm, mündliche Tradition, Schneewittchen.
Häufig gestellte Fragen
Waren Volksmärchen ursprünglich für Kinder geschrieben?
Nein, Volksmärchen basieren auf mündlichen Traditionen, die sich ursprünglich an ein erwachsenes Publikum richteten. Erst später wurden sie als Kinderliteratur adaptiert.
Was sind die typischen Gattungsmerkmale eines Volksmärchens?
Dazu gehören Einsträngigkeit der Handlung, Ort- und Zeitlosigkeit, die Flächenhaftigkeit der Figuren und die Selbstverständlichkeit des Wunderbaren.
Was bedeutet "Flächenhaftigkeit" bei Märchenfiguren?
Es bedeutet, dass die Figuren keine psychologische Tiefe, keine innere Entwicklung und oft keine individuellen Namen haben (z.B. "der Müller", "die Prinzessin").
Welche Rolle spielen die Brüder Grimm in der Geschichte des Märchens?
Sie sammelten und überarbeiteten mündlich überlieferte Geschichten und veröffentlichten sie als "Kinder- und Hausmärchen", was die Gattung weltweit prägte.
Wie ist der idealtypische Aufbau eines Volksmärchens?
Die Handlung folgt meist einem Schema: Ein Held zieht aus, muss Prüfungen bestehen (oft mit magischer Hilfe) und erreicht am Ende ein glückliches Ziel.
- Arbeit zitieren
- Miriam Buchner (Autor:in), 2014, Ein Überblick über die Gattung des Volksmärchens, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338594