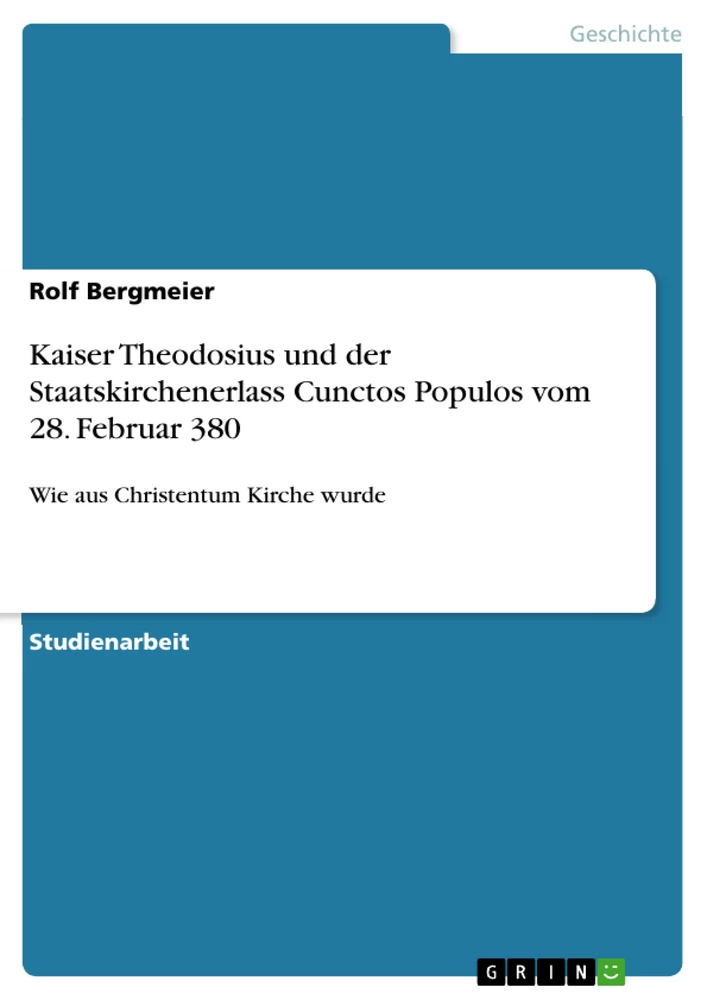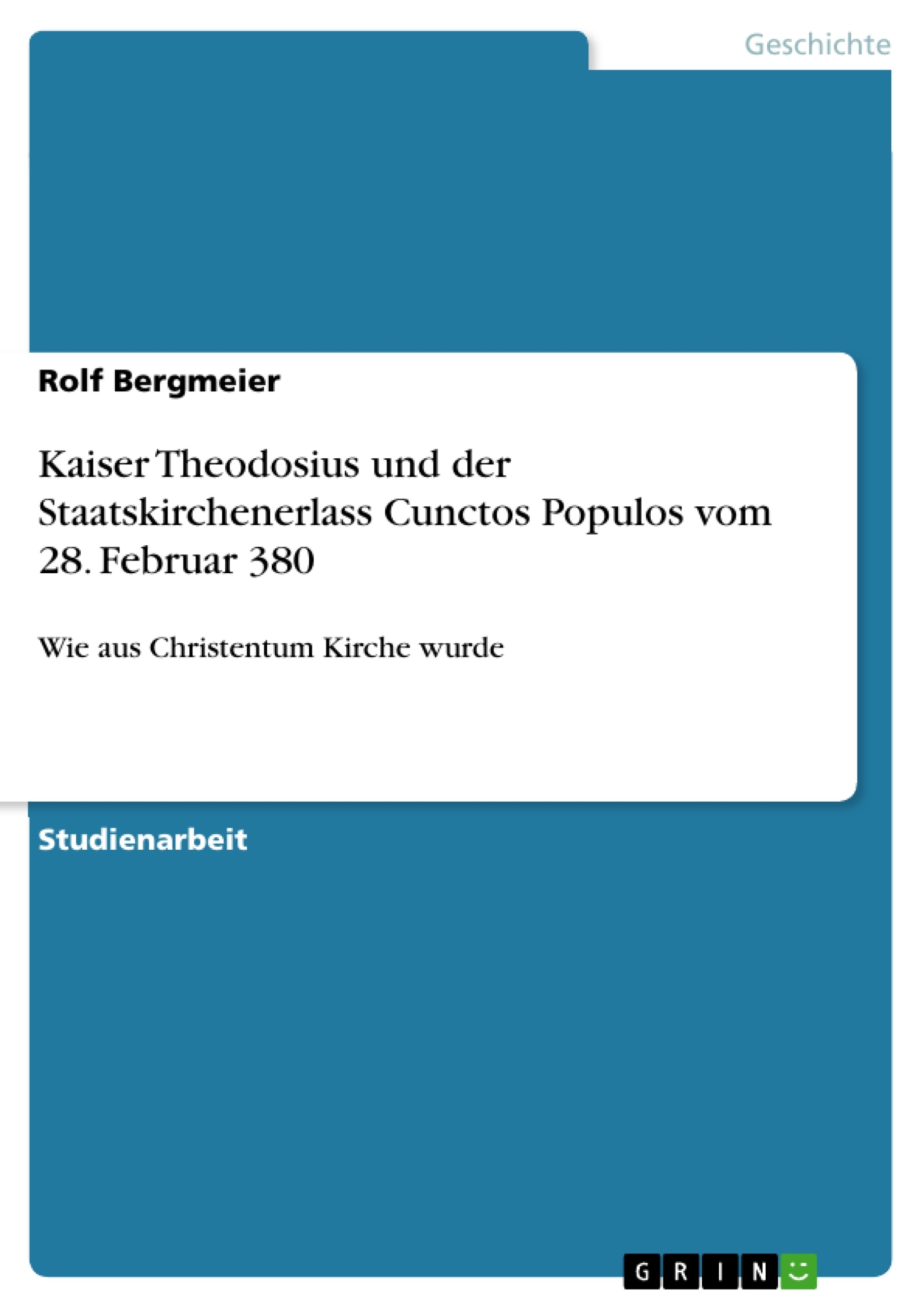Theodosius macht 380 Tabula rasa. Er verbietet mit dem Erlass Cunctos populos „aus eigener Initiative und ohne Konsultation kirchlicher Stellen“ alle heidnischen Religionen und schaltet die vom Katholizismus abweichenden christlichen Varianten mit Zwangsmaßnahmen aus. „Nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen, so gebieten wir, katholische Christen heißen dürfen; die übrigen, die wir für wahrhaft toll und wahnsinnig erklären, haben die Schande ketzerischer Lehre zu tragen“.
Damit beginnt unter dem Patronat des später zum Divus erhobenen Theodosius der Siegeszug eines zur Staatsreligion geeinten Christentums, das meist als „christliche“ Staats/Reichsreligion bezeichnet wird, aber in Wirklichkeit nur den katholischen Anteil der christlichen Bewegungen kennzeichnet.
Unter der Dominanz der allmächtigen, allwissenden, jeder menschlichen Macht turmhoch überlegenen Gottheit erhebt die Kirche einen Herrschaftsanspruch über alle Menschen: „Wer wird sich der Einsicht verschließen“, schreibt Bischof Ambrosius von Mailand an Kaiser Valentinian II., „dass in Glaubensangelegenheiten die Bischöfe über dem Kaiser, nicht aber die Kaiser über die Bischöfe Recht sprechen können“. Schließlich wird der Mensch an sich, gleich welcher Abstammung und Position, dem Urteil der Kirche unterworfen: „So erklären wir, dass jedes menschliche Geschöpf dem Bischof von Rom unterworfen sein muss, weil dies ganz und gar heilsnotwendig ist“, erklärt Papst Bonifaz VIII. im Jahre 1302. Kaum ein Ereignis hat die Geschichte so geprägt wie dieser Erlass. Und kaum ein paradigmatischer Wandel ist in der althistorischen Geschichtsforschung so wenig beachtet und gewürdigt worden.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Cunctos Populos. Der Staatskirchenerlass
- Folgen
- Der Staat unterwirft sich
- Bischöfe als neue Führungsschicht in den Städten
- Innerkirchliche Folgen: Hierarchie statt Gemeindechristentum
- Verlust der kulturellen und religiösen Vielfalt
- Die Umwertung aller Werte
- Eine Entscheidung, die die Welt bewegt
- Anlage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studie untersucht den Staatskirchenerlass Cunctos Populos von Kaiser Theodosius aus dem Jahr 380 und dessen weitreichende Folgen. Der Fokus liegt auf der Analyse der politischen und religiösen Umwälzungen, die durch diesen Erlass ausgelöst wurden, und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Kirche.
- Die politische Instrumentalisierung des Christentums durch Kaiser Theodosius
- Die Auswirkungen des Erlasses auf die soziale und politische Ordnung des römischen Reiches
- Die Veränderungen innerhalb der christlichen Kirche nach dem Erlass
- Der Verlust religiöser und kultureller Vielfalt
- Die Transformation der Wertevorstellungen im römischen Reich
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einführung skizziert den langen Prozess der theologischen Einigung innerhalb des Christentums, der im 5. Jahrhundert mit dem Konzil von Chalkedon seinen Höhepunkt findet. Sie hebt die Bedeutung der Konzilien von Nicäa (325) und Konstantinopel (381) hervor, die die dogmatische Definition des christlichen Gottes entscheidend prägten. Der Abschnitt beschreibt die innerkirchlichen Auseinandersetzungen und die Vielfalt der frühen christlichen Bewegungen, die im 4. Jahrhundert noch weit verbreitet waren, bevor der Staatskirchenerlass diese Vielfalt maßgeblich reduzierte. Die widersprüchliche Rolle von Kaiser Julian, der vorübergehend die alten Götter wiederbelebte, wird als Indiz dafür gewertet, dass die Bevölkerung die Monotheisierung nicht unbedingt erwünscht hatte.
Cunctos Populos. Der Staatskirchenerlass: Dieses Kapitel analysiert den Erlass Cunctos Populos selbst, seinen Inhalt und seine historischen Umstände. Es untersucht die Motive Kaiser Theodosius' und die politischen und religiösen Konsequenzen des Erlasses für das Römische Reich. Es wird detailliert untersucht, wie der Erlass die Stellung des Christentums im Reich veränderte und welche Machtstrukturen er beeinflusste. Die Analyse wird sich auf die konkrete Ausgestaltung des Erlasses sowie seinen rechtlichen und gesellschaftlichen Kontext konzentrieren.
Folgen: Dieses Kapitel beschreibt die weitreichenden Folgen des Cunctos Populos-Erlasses. Es wird aufgezeigt, wie der Staat sich dem Christentum unterwarf und die Bischöfe zu einer neuen Führungsschicht in den Städten aufstiegen. Die innerkirchlichen Folgen, der Wandel von einem Gemeindechristentum hin zu einer hierarchischen Kirchenstruktur, wird ebenso behandelt wie der Verlust kultureller und religiöser Vielfalt. Der Abschnitt endet mit einer Analyse der tiefgreifenden Umwertung von Werten, die dieser Prozess mit sich brachte. Die Transformation der Gesellschaft unter dem Einfluss der neuen Staatskirche wird anhand von konkreten Beispielen erläutert.
Schlüsselwörter
Kaiser Theodosius, Cunctos Populos, Staatskirche, Christentum, Arianismus, Religionspolitik, Römisches Reich, Konzil von Nicäa, Konzil von Konstantinopel, politische Macht, religiöse Toleranz, kulturelle Vielfalt, Hierarchie, Gemeindechristentum, Wertwandel.
Häufig gestellte Fragen zu "Cunctos Populos. Der Staatskirchenerlass"
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie analysiert den Staatskirchenerlass Cunctos Populos von Kaiser Theodosius I. aus dem Jahr 380 und dessen weitreichende Folgen für das Römische Reich. Der Fokus liegt auf den politischen und religiösen Umwälzungen und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Kirche.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Studie untersucht die politische Instrumentalisierung des Christentums durch Theodosius, die Auswirkungen des Erlasses auf die soziale und politische Ordnung, die Veränderungen innerhalb der christlichen Kirche (vom Gemeindechristentum zur Hierarchie), den Verlust religiöser und kultureller Vielfalt und die Transformation der Wertevorstellungen im römischen Reich.
Welche Kapitel umfasst das Werk?
Das Werk beinhaltet eine Einführung, ein Kapitel über den Staatskirchenerlass Cunctos Populos selbst, ein Kapitel über die Folgen des Erlasses und einen abschließenden Anlagenteil. Die Einführung beleuchtet den Prozess der theologischen Einigung im Christentum und die Bedeutung der Konzilien von Nicäa und Konstantinopel. Das Kapitel zu den Folgen beschreibt die Unterwerfung des Staates unter das Christentum, den Aufstieg der Bischöfe, den Wandel der Kirchenstruktur und den Verlust kultureller und religiöser Vielfalt.
Was wird in der Einführung erläutert?
Die Einführung skizziert den langen Prozess der theologischen Einigung im Christentum bis zum Konzil von Chalkedon. Sie betont die Bedeutung der Konzilien von Nicäa und Konstantinopel und beschreibt die innerkirchlichen Auseinandersetzungen und die Vielfalt der frühen christlichen Bewegungen vor dem Staatskirchenerlass. Die Rolle Kaiser Julians wird als Indiz für die nicht unbedingt erwünschte Monotheisierung der Bevölkerung betrachtet.
Wie wird der Staatskirchenerlass "Cunctos Populos" analysiert?
Das Kapitel zu Cunctos Populos analysiert den Inhalt und die historischen Umstände des Erlasses, die Motive Kaiser Theodosius', und die politischen und religiösen Konsequenzen für das Römische Reich. Es untersucht die Veränderung der Stellung des Christentums und die beeinflussten Machtstrukturen, wobei die konkrete Ausgestaltung, der rechtliche und gesellschaftliche Kontext im Detail betrachtet werden.
Welche Folgen des Erlasses werden beschrieben?
Das Kapitel zu den Folgen beschreibt die Unterwerfung des Staates unter das Christentum, den Aufstieg der Bischöfe zu einer neuen Führungsschicht, den Wandel vom Gemeindechristentum zu einer hierarchischen Kirchenstruktur, den Verlust kultureller und religiöser Vielfalt und die tiefgreifende Umwertung von Werten. Konkrete Beispiele erläutern die Transformation der Gesellschaft unter dem Einfluss der neuen Staatskirche.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Studie?
Schlüsselwörter sind: Kaiser Theodosius, Cunctos Populos, Staatskirche, Christentum, Arianismus, Religionspolitik, Römisches Reich, Konzil von Nicäa, Konzil von Konstantinopel, politische Macht, religiöse Toleranz, kulturelle Vielfalt, Hierarchie, Gemeindechristentum, Wertwandel.
- Citar trabajo
- Rolf Bergmeier (Autor), 2016, Kaiser Theodosius und der Staatskirchenerlass Cunctos Populos vom 28. Februar 380, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338674