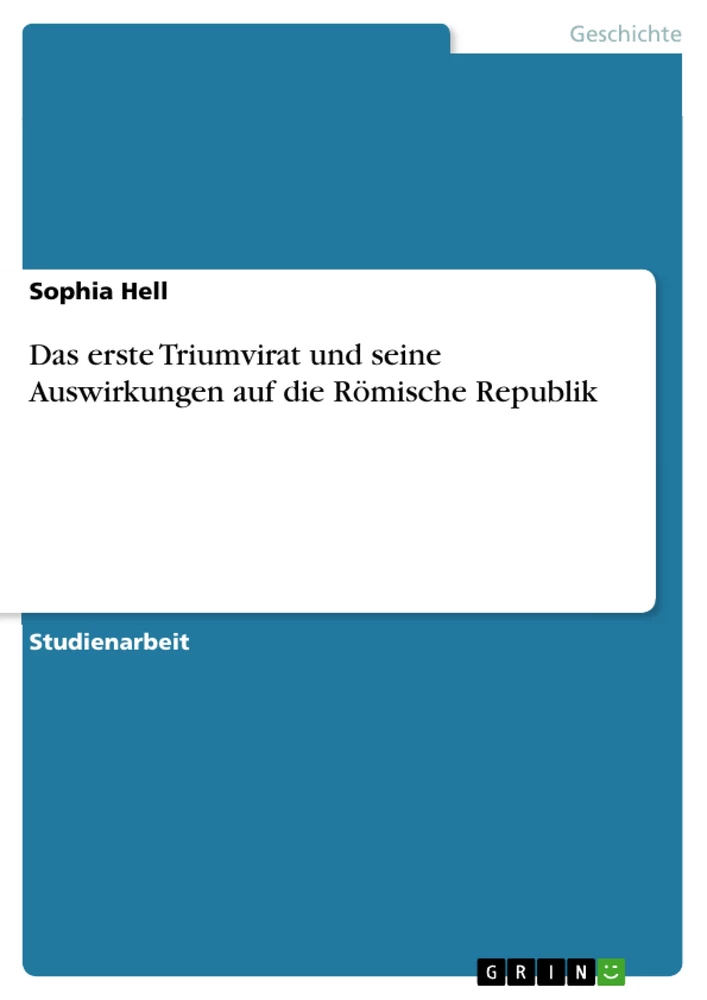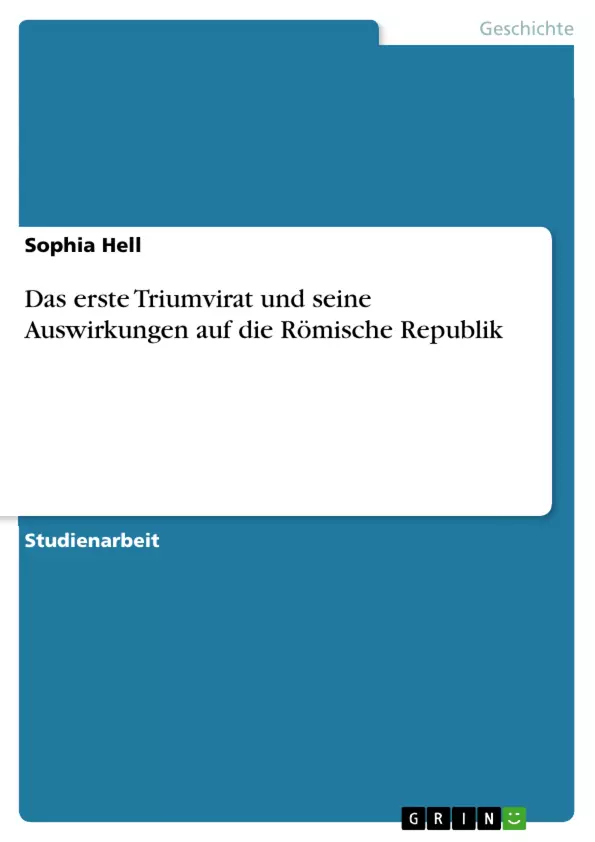„Wie sich aus dem Rückblick zeigt, führte in Rom der Weg zu Diktatur und Principat über die Triumvirate“ - so meint Karl Christ den Untergang der römischen Republik erklären zu müssen. Offensichtlich hatte die res publica vor allem im letzten Jahrhundert vor Christus mit vielen Krisen, Aufständen und Problemen zu kämpfen. Circa fünfhundert Jahre hatte diese Republik bereits hinter sich, als sie in diesen letzten hundert Jahren nach und nach aufgerieben wurde. Wie konnte es dazu kommen?
Die Geschichtsschreibung hat unterschiedliche Sichten auf die Epoche. E. Gruen beispielsweise ist der Meinung, die römische Republik sei bis in die Zeit Caesars durchaus funktionsfähig gewesen, während Hegel die Ansicht vertritt, ein Fortbestand der Republik zu Zeiten Ciceros sei „unmöglich“ gewesen, da es in ihr keinen Halt mehr gegeben habe .
Das Ziel dieser Arbeit wird es sein, hinter den Wahrheitsgehalt dieser Feststellung zu kommen durch eine konkrete Analyse der Vorgeschichte, die zunächst von dem Diktator Sulla geprägt wurde, der bereits einige Schritte in Richtung Fortgang der Republik versuchte. Dann wird insbesondere auf das Jahr 70 v. Chr. eingegangen werden, welches durch das Konsulat des Pompeius und Crassus und deren Bestimmungen eine wichtige Rolle einnimmt. Darauf folgend werden die einzelnen Akteure des Triumvirats vorgestellt und näher beleuchtet, bevor das eigentliche Bündnis von 60 v. Chr. thematisiert wird. Im Anschluss werden die Änderungen, die durch dasselbe hervorgerufen wurden, sowie die Folgen betrachtet, um zum Schluss zu einer endgültigen Feststellung bezüglich der oben genannten These zu kommen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Vorgeschichte des 1. Triumvirats
- II. 1. Die Krisen der Römischen Republik bis Sulla
- II. 2. Sullas,,res publica restituenda“ - die Reformen
- II. 3. Die nachsullanischen Krisen
- II. 4. 70 v. Chr. : Das Konsulat des Pompeius und Crassus
- III. Die Akteure
- III. 1. Crassus
- III. 2. Pompeius
- III. 3. Caesar
- IV. Das Erste Triumvirat
- V. Das 1. Triumvirat als Zerstörung oder Hilfe für die res publica?
- VI. Schlussbetrachtung
- VII. Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beleuchtet die Entstehung und die Auswirkungen des Ersten Triumvirats auf die Römische Republik. Sie untersucht die Vorgeschichte des Triumvirats, die durch die Krisen der Republik und die Reformen Sullas geprägt wurde, und analysiert die Rolle der einzelnen Akteure, insbesondere Crassus, Pompeius und Caesar. Des Weiteren werden die Ziele und die Folgen des Triumvirats für die Res Publica erörtert.
- Die Krisen der Römischen Republik im späten 2. Jahrhundert v. Chr.
- Die Reformen Sullas und deren Auswirkungen auf die politische Ordnung
- Die Rolle der führenden Persönlichkeiten des Triumvirats (Crassus, Pompeius, Caesar)
- Die Entstehung und die Ziele des Ersten Triumvirats
- Die Folgen des Triumvirats für die Römische Republik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung stellt die Problematik des Ersten Triumvirats vor und beleuchtet verschiedene Perspektiven auf die Epoche. Sie führt den Leser in die Thematik ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit.
II. Zur Vorgeschichte des 1. Triumvirats: Dieses Kapitel beleuchtet die Krisen der Römischen Republik vor dem Hintergrund der Agrar-, Heeres- und Versorgungskrisen. Es thematisiert die lex agraria von Tiberius Gracchus und den Aufstieg des Feldherrn Gaius Marius.
II. 1. Die Krisen der Römischen Republik bis Sulla: Dieses Unterkapitel behandelt die Krisen der Römischen Republik vom Jahr 133 v. Chr. bis zum Aufstieg Sullas. Es analysiert die lex agraria von Tiberius Gracchus, die Jugurthinischen Kriege und die Heeresreform von Marius.
II. 2. Sullas,,res publica restituenda“ - die Reformen: Dieses Unterkapitel untersucht die Reformen Sullas, die er mit dem Ziel der „res publica restituenda“ durchführte.
II. 3. Die nachsullanischen Krisen: Dieses Unterkapitel analysiert die Krisen der Römischen Republik in der Zeit nach Sulla.
II. 4. 70 v. Chr. : Das Konsulat des Pompeius und Crassus: Dieses Unterkapitel behandelt das Konsulat von Pompeius und Crassus im Jahr 70 v. Chr. und deren Bedeutung für die weitere Entwicklung der Republik.
III. Die Akteure: Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Akteure des Ersten Triumvirats - Crassus, Pompeius und Caesar - vor und beleuchtet deren Lebensläufe und politische Ambitionen.
IV. Das Erste Triumvirat: Dieses Kapitel analysiert die Entstehung und die Ziele des Ersten Triumvirats, das sich aus Crassus, Pompeius und Caesar zusammensetzte.
Schlüsselwörter
Römische Republik, Triumvirat, Krisen, Reformen, Sulla, Marius, Pompeius, Crassus, Caesar, Politik, Macht, Militär, Expansion, Bürgerkrieg, Res Publica
- Quote paper
- Sophia Hell (Author), 2016, Das erste Triumvirat und seine Auswirkungen auf die Römische Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338676