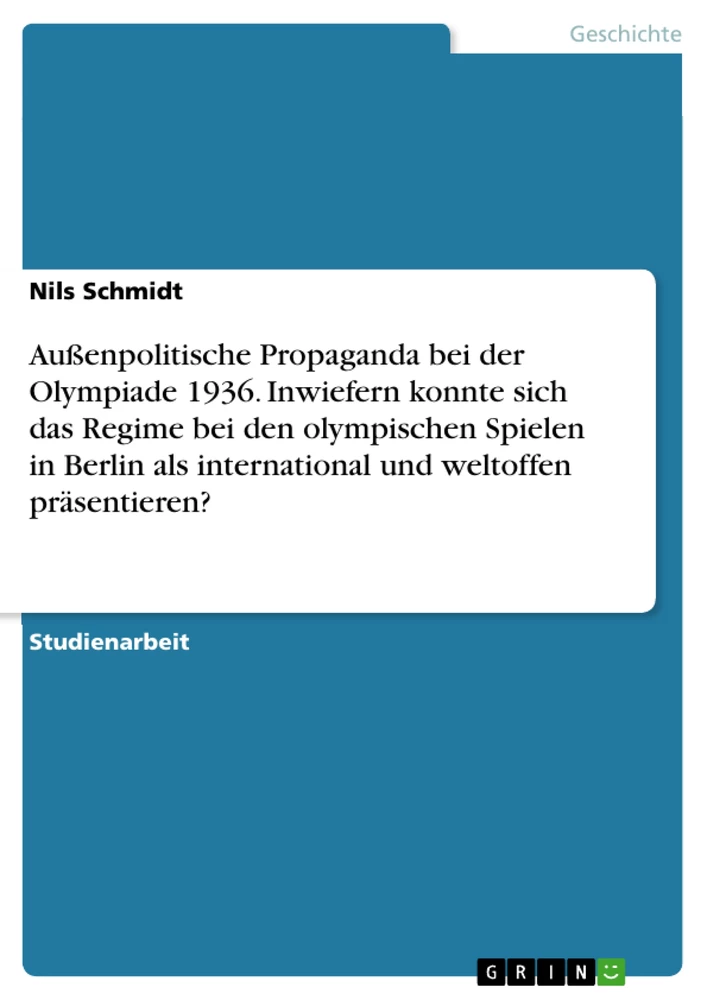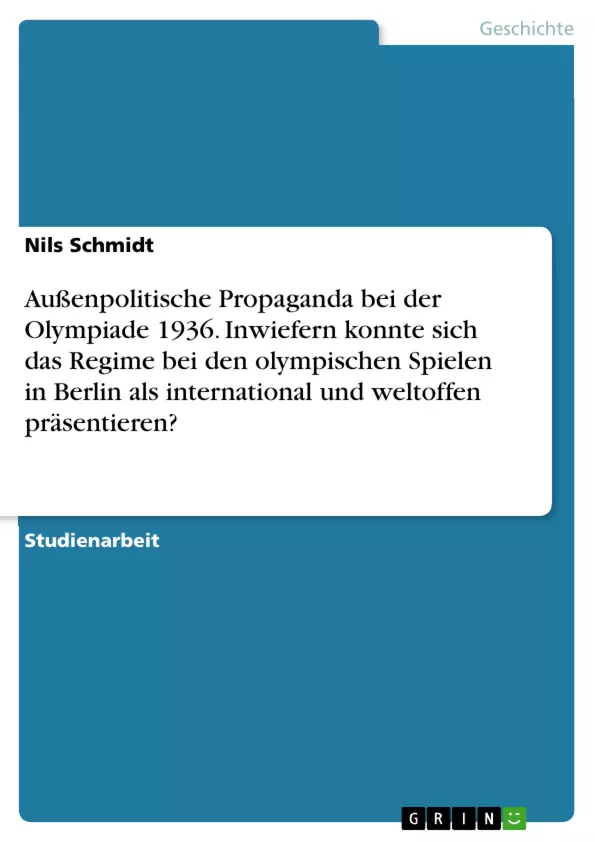Am 13. Mai 1931 vergab das IOC die Olympischen Winter- und Sommerspiele 1936 an die deutsche Reichshauptstadt, genauer gesagt an Berlin. Diese Entscheidung deutete auf die Wiedereingliederung der Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg hin. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 wurde die Bedeutung der olympischen Bewegung in Deutschland zunächst jedoch immer schwächer, da für die nationalsozialistische Regierung aus rassistischer Sicht einige Bedenken an dieser Bewegung zu erkennen waren.
Nach und nach wurden Adolf Hitler und seinem Regime jedoch die Möglichkeiten bewusst, die mit der Austragung der Spiele einher gingen. Insbesondere die in Aussicht stehende außenpolitische Aufwertung setzte einen Einstellungswandel der Nationalsozialisten in Gang.
„Das pro-olympische Verhalten sollte gleichzeitig der politischen Isolierung entgegenwirken“ und so wurde es zum Ziel „das Bild eines unbeschwerten, friedlichen und neuen Deutschlands zu präsentieren“ (Gajek 2013).
Nun gibt es aus heutiger Forschungssicht verschiedene Perspektiven, welche die Frage nach der Rolle der olympischen Spiele in der nationalsozialistischen Propaganda durchleuchten. Zum einen werden die Spiele als „ein, wenn nicht gar das Musterbeispiel für die Instrumentalisierung des Sports“ (Grothe 2008) gesehen. In der Forschungsliteratur lassen sich aber auch Gegenthesen entdecken welche von der Position ausgehen, dass die Spiele 1936 nur teilweise als Propagandaerfolg ausgelegt werden können. Arnd Krüger vertritt in seiner Dissertation zum Thema „Die Olympischen Spiele 1936 und die Weltmeinung“ beispielsweise die These, dass dort, wo in der ausländischen Presse vor den Spielen schon eine Boykottbewegung, beziehungsweise eine dem nationalsozialistischem Regime gegenüber kritische Haltung zu erkennen war, auch nach den Spielen eine erhalten blieb.
Diese Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, inwieweit das nationalsozialistische Regime den Sport, genauer gesagt die olympischen Spiele dazu nutzen konnte, sich außenpolitisch als weltoffenes und internationales Volk zu inszenieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vor den Spielen
- Wahl und Entstehung des olympischen Dorfes nach dem Willen des Führers
- Propaganda vor den Spielen
- Wirkung und Reaktion aus dem Ausland
- Die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen: Ein Probelauf.
- Die Olympischen Sommerspiele 1936
- Verhalten des Regimes und der Presse während den Spielen
- Die Rolle Berlins
- Reaktionen aus dem Ausland
- Eine zentrale Rolle in der Nachbereitung: Leni Riefenstahl und ihre Filme.
- Die Entstehung der Filme
- Leni Riefenstahl: Fest der Völker
- Wirkung auf das Ausland
- Forschungsperspektiven
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, inwieweit das nationalsozialistische Regime die Olympischen Spiele 1936 dazu nutzen konnte, sich außenpolitisch als weltoffenes und internationales Volk zu inszenieren. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Propagandaaktivitäten des Regimes vor und während der Spiele, sowie auf den Reaktionen der internationalen Presse und der Weltöffentlichkeit.
- Die Rolle der Olympischen Spiele in der nationalsozialistischen Propaganda
- Die Inszenierung eines "neuen" und "friedlichen" Deutschlands
- Die Auswirkungen der Spiele auf die Weltmeinung
- Die Bedeutung der Medien und Filmproduktionen in der Propaganda
- Die kontroverse Rolle von Leni Riefenstahl und ihren Filmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die historische und politische Situation vor den Olympischen Spielen 1936 dar und erläutert die Ziele und Fragestellungen der Arbeit. Kapitel 2 beleuchtet die Vorbereitungen der Spiele, insbesondere die Wahl und Gestaltung des olympischen Dorfes unter dem Einfluss von Adolf Hitler, sowie die Propagandaaktivitäten des Regimes vor den Spielen. Kapitel 3 analysiert die Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen als Probelauf für die Sommerspiele. Kapitel 4 befasst sich mit den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin, inklusive der Propaganda des Regimes und der internationalen Reaktionen. Kapitel 5 untersucht die Rolle von Leni Riefenstahl und ihren Filmen in der Nachbereitung der Spiele. Abschließend bietet Kapitel 6 eine Zusammenfassung der Ergebnisse und Erkenntnisse der Arbeit.
Schlüsselwörter
Olympische Spiele 1936, nationalsozialistische Propaganda, Sportpolitik, Außenpolitik, Weltmeinung, Leni Riefenstahl, Fest der Völker, Medien, Propagandafilme, Internationale Reaktionen, Boykottbewegung, Antisemitismus, Rassismus, Hitler, Olympiastadion, Berlin.
Häufig gestellte Fragen
Wie nutzten die Nationalsozialisten die Olympiade 1936 für Propaganda?
Das Regime inszenierte Deutschland als friedliches, weltoffenes und modernes Land, um von der rassistischen Ideologie und Aufrüstung abzulenken.
War die Vergabe der Spiele an Berlin eine politische Entscheidung?
Die Vergabe durch das IOC erfolgte bereits 1931 als Zeichen der Wiedereingliederung Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg, wurde aber ab 1933 instrumentalisiert.
Welche Rolle spielte Leni Riefenstahl?
Sie schuf mit dem Film „Fest der Völker“ ein ästhetisiertes Dokument der Spiele, das weltweit zur positiven Selbstdarstellung des NS-Regimes beitrug.
Gab es internationalen Widerstand gegen die Spiele?
Ja, es gab Boykottbewegungen, besonders in den USA, aufgrund der Diskriminierung jüdischer Athleten in Deutschland.
Waren die Spiele ein vollständiger Propagandaerfolg?
In der Forschung ist dies umstritten; während viele Besucher beeindruckt waren, blieb die ausländische Presse gegenüber dem Regime oft weiterhin kritisch.
- Quote paper
- Nils Schmidt (Author), 2016, Außenpolitische Propaganda bei der Olympiade 1936. Inwiefern konnte sich das Regime bei den olympischen Spielen in Berlin als international und weltoffen präsentieren?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338726