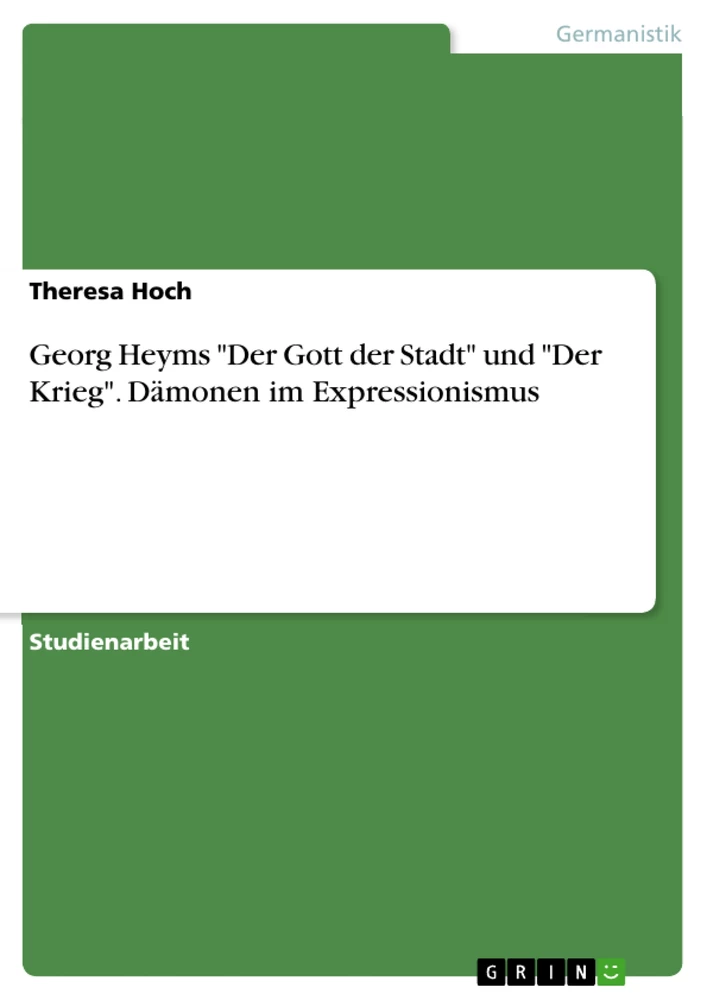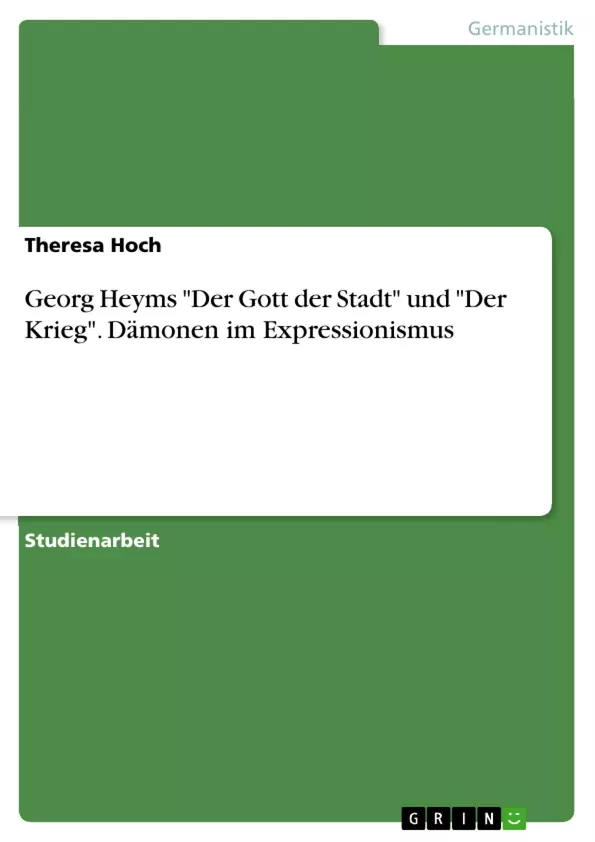Welche expressionistischen Mittel lassen sich in Heyms Gedichten "Der Gott der Stadt" und "Der Krieg" finden, die einen Bezug zur Thematik des Dämonischen vermuten lassen? Dieser Frage soll nachfolgend nachgegangen werden.
Zunächst bietet die Arbeit diesbezüglich eine kurze Einleitung zur Thematik des Expressionismus, um einige Hintergründe aufzuzeigen, die die Untersuchung des Dämonischen verdeutlichen. Genauer eingegangen wird dann, zunächst anhand von einigen Unterpunkten, auf die Aspekte von Gewalt, Anthropomorphisierung und Chaos, die eine wesentliche Rolle in der expressionistischen Lyrik in Bezug zum Dämonischen spielen. Dies soll nachfolgend anhand der Beispiele der ausgewählten Gedichte Heyms verdeutlicht werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Über das Dämonische im Umfeld des Expressionismus
- Gewalt
- Anthropomorphisierung
- Chaos
- Über das Dämonische in Heyms Gedichten
- Der Gott der Stadt
- Der Krieg
- Vergleich und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Einfluss des „Dämonischen“ in der expressionistischen Literatur, insbesondere in der Lyrik. Der Fokus liegt auf der Analyse dieser Aspekte in zwei ausgewählten Gedichten von Georg Heym, „Der Gott der Stadt“ und „Der Krieg“. Ziel ist es, expressionistische Mittel zu identifizieren, die auf eine Verbindung zur Thematik des Dämonischen hindeuten.
- Die Rolle des Dämonischen in der expressionistischen Lyrik
- Die Darstellung von Gewalt, Anthropomorphisierung und Chaos in expressionistischen Gedichten
- Die Beziehung zwischen dem Dämonischen und der Großstadterfahrung
- Die Bedeutung von Fortschritt und Technik in der expressionistischen Literatur
- Die Auswirkungen des Dämonischen auf das Individuum und die Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Expressionismus und die Rolle des Dämonischen in der expressionistischen Lyrik ein. Sie beleuchtet die Hintergründe und die Bedeutung des Dämonischen im Kontext der expressionistischen Bewegung.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit dem Dämonischen im Umfeld des Expressionismus. Es analysiert die Aspekte von Gewalt, Anthropomorphisierung und Chaos, die eine zentrale Rolle in der expressionistischen Lyrik spielen.
Das dritte Kapitel widmet sich der Analyse des Dämonischen in Heyms Gedichten „Der Gott der Stadt“ und „Der Krieg“. Es untersucht, wie Heym in seinen Werken die Themen von Gewalt, Anthropomorphisierung und Chaos behandelt.
Das vierte Kapitel bietet eine vergleichende Schlussbetrachtung der beiden Gedichte und fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Expressionismus, Dämonisches, Gewalt, Anthropomorphisierung, Chaos, Großstadt, Industrialisierung, Fortschritt, Technik, Georg Heym, „Der Gott der Stadt“, „Der Krieg“, Lyrik.
- Quote paper
- Theresa Hoch (Author), 2016, Georg Heyms "Der Gott der Stadt" und "Der Krieg". Dämonen im Expressionismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338804