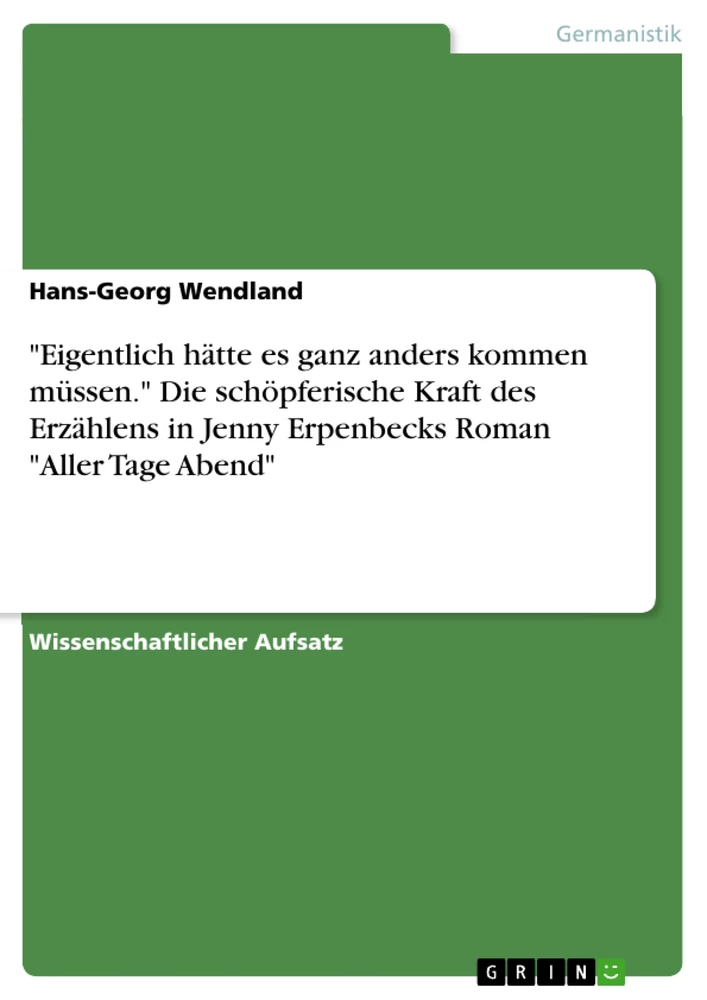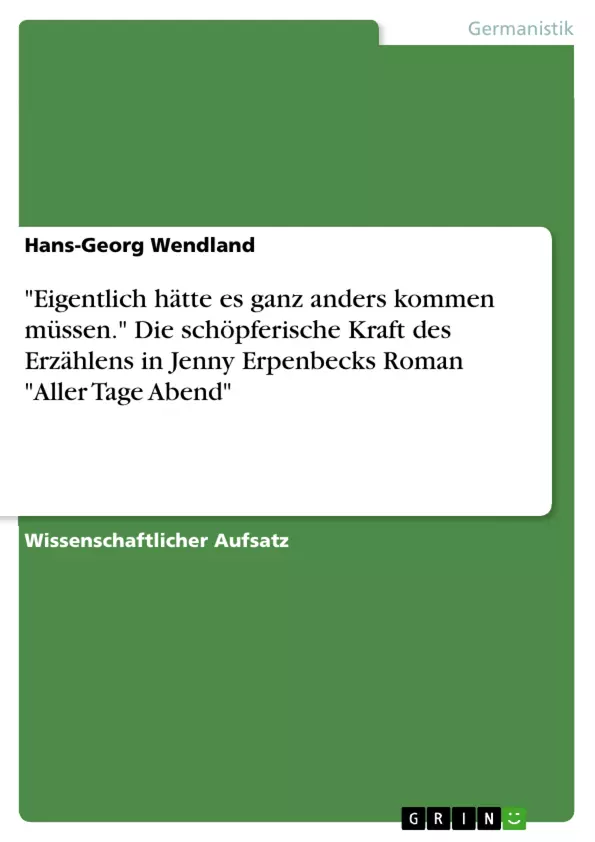In „Aller Tage Abend“ werden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als ineinandergreifende, sich überlappende und gegenseitig beeinflussende zeitliche Dimensionen aufgefasst. Dieser Sichtweise liegt ein Denkmodell zugrunde, in dem die Vergangenheit nicht als abgeschlossener, sondern als offener Raum verstanden wird, der in die Gegenwart hineinwirkt und auch zukünftiges Geschehen entscheidend mitbestimmt. Mit ihrem Roman unternimmt Jenny Erpenbeck ein erzählerisches Experiment, dessen Versuchsanordnung es ihr ermöglicht, sich auf einer gedanklichen Zeitleiste hin- und her- bzw. vor- und zurückzubewegen. Auf diese Weise erprobt sie verschiedene Möglichkeiten, bereits erzähltes Geschehen wieder aufzurufen, es aus anderen Blickwinkeln zu betrachten, neue Seiten daran zu entdecken, es neu zu ordnen und zu strukturieren, abzuwandeln, zu erweitern und zu ergänzen.
Dieses Verfahren unterscheidet sich grundlegend von einer Erzählmethode, mit der das Geschehen an den Gesetzen der Logik, der Kausalität und der zeitlichen Abfolge ausgerichtet wird. Erpenbeck betont demgegenüber die schöpferische Kraft des Schreibens, mit der die Regulierung durch solche Vorgaben aufgebrochen und neue erzählerische Wege beschritten werden können. Folgt der Leser der ungenannten Erzählerfigur in „Aller Tage Abend“ auf diesen Wegen, so macht er die verblüffende Erfahrung, dass auch der Tod eines Menschen nicht das Ende seiner Geschichte bildet, sondern dass es Möglichkeiten gibt, an diesem Scheidepunkt die Zeit gleichsam rückwärts laufen zu lassen, das Geschehen neu aufzurollen und zu untersuchen, wie es sich (unter vielleicht nur geringfügig geänderten Voraussetzungen) auch hätte entwickeln können. Auf eine leicht fassliche Formel gebracht, folgt das erzählerische Verfahren von „Aller Tage Abend“ der Erkenntnis: „Am Ende eines Tages, an dem gestorben wurde, ist längst noch nicht aller Tage Abend.“
Der auf diese Weise entstandene Roman bildet somit eine vielschichtige, komplexe Erzählung vom Schicksal „einer einzelnen Figur, deren Lebensgeschichten fast das gesamte 20. Jahrhundert umfassen.“ Explizit wird dieses Erzählverfahren in den als Scharnier- oder Gelenkstücke zwischen die fünf „Bücher“ des Romans eingefügten „Intermezzi“ durchgespielt. Um konkret zu überprüfen, wie ein solches Verfahren funktioniert, werden hier die symmetrisch angeordneten Bausteine des Romangeschehens genauer untersucht und kommentiert.
Inhaltsverzeichnis
- Erläuternde Einführung in den Text
- Kommentierender Überblick über die Bausteine des Romangeschehens
- Buch I (A 9 - 68)
- Intermezzo (A 71 - 76)
- Buch II (A 79 – 132)
- Intermezzo (A 135 - 138)
- Buch III (A 141 – 193)
- Intermezzo (A 197 - 207)
- Buch IV (A 211 - 238)
- Intermezzo (A 241 - 245)
- Buch V (A 249 - 283)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
In „Aller Tage Abend“ erforscht Jenny Erpenbeck die komplexe Beziehung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und wie diese Dimensionen sich gegenseitig beeinflussen. Durch ein erzählerisches Experiment wird das Geschehen nicht linear, sondern in Schleifen und Rückblenden dargestellt, wobei die Perspektive des Lesers immer wieder verschoben wird.
- Die Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart und Zukunft
- Die Kraft des Erinnerns und Vergessens
- Die Auswirkungen von Gewalt und Trauma auf Familien und Generationen
- Die Suche nach Identität und Zugehörigkeit
- Die Rolle des Zufalls und der Entscheidungen im menschlichen Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Erläuternde Einführung in den Text
Die Einführung beleuchtet die einzigartige Zeitstruktur des Romans. Die Vergangenheit wird nicht als abgeschlossen betrachtet, sondern als offener Raum, der die Gegenwart prägt. Die Autorin nutzt dieses Konzept, um die Geschichte der Protagonistin in verschiedenen Perspektiven zu erforschen und das Geschehen neu zu ordnen.
Buch I (A 9 - 68)
Der Roman beginnt mit dem Tod der Protagonistin im Kindesalter, der jedoch nicht das Ende, sondern den Ausgangspunkt der Erzählung darstellt. Die Mutter des Kindes spult in einer inneren Vorschau die möglichen Lebensstationen ihrer Tochter ab, die in den folgenden Büchern des Romans im Detail erzählt werden. Die Geschichte entfaltet sich im Kontext einer Familie, die von Spannungen und Konflikten geprägt ist. Die Perspektive liegt hauptsächlich auf den Eltern des Kindes, während das Kind selbst erst in Buch II wieder in Erscheinung tritt.
Intermezzo (A 71 - 76)
Das erste Intermezzo dient als Übergang zum zweiten Buch und stellt die Figur des Großvaters in den Mittelpunkt. Es wird ein entscheidendes Ereignis aus seiner Vergangenheit erzählt, das die Familie nachhaltig prägte.
Buch II (A 79 – 132)
In Buch II tritt die Protagonistin als junge Erwachsene wieder in Erscheinung. Die Erzählung folgt nun ihrem Leben und ihren Erfahrungen, wobei die Vergangenheit und die Auswirkungen der familiären Konflikte weiterhin eine Rolle spielen. Es werden wichtige Stationen ihrer Lebensgeschichte vorgestellt, die in den folgenden Büchern weiter ausgearbeitet werden.
Intermezzo (A 135 - 138)
Das zweite Intermezzo setzt die Geschichte des Großvaters fort und beleuchtet seine Beziehung zu seinem Sohn, dem Vater der Protagonistin.
Buch III (A 141 – 193)
Buch III konzentriert sich auf die Protagonistin in ihrer mittleren Lebenszeit. Es werden ihre Entscheidungen, Herausforderungen und die Auswirkungen der Vergangenheit auf ihr Leben dargestellt. Die Erzählung zeigt, wie sie mit den Folgen der Vergangenheit umgeht und sich ihren Weg in der Gegenwart bahnt.
Intermezzo (A 197 - 207)
Das dritte Intermezzo erzählt von der Protagonistin in ihrer Jugend und ihren ersten Erfahrungen mit Liebe und Verlust.
Buch IV (A 211 - 238)
Buch IV folgt der Protagonistin in ihrer späteren Lebenszeit. Es werden ihre Erfahrungen mit Alter, Krankheit und Verlust dargestellt. Die Erzählung zeigt, wie sie mit dem Ende ihres Lebens umgeht und ihre Vergangenheit reflektiert.
Intermezzo (A 241 - 245)
Das vierte Intermezzo stellt die Protagonistin als junge Frau dar und erzählt von ihrer ersten Liebe und ihrem Entschluss, ein eigenes Leben zu führen.
Buch V (A 249 - 283)
In Buch V lebt die Protagonistin im hohen Alter in einem Pflegeheim. Die Erzählung zeigt, wie sie mit ihrem Leben abschließt und ihre Vergangenheit in einer neuen Perspektive betrachtet. Es werden die Themen Verlust, Erinnerung und die Bedeutung von Beziehungen in der letzten Lebensphase beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter des Romans sind: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Erinnerung, Vergessen, Familie, Identität, Trauma, Gewalt, Verlust, Liebe, Tod, Zeit, Geschichte, Judentum, Antisemitismus, Migration.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Erzählmethode in „Aller Tage Abend“?
Jenny Erpenbeck nutzt ein Experiment, bei dem die Zeit rückwärts laufen kann. Der Tod eines Menschen bildet nicht das Ende, sondern das Geschehen wird unter geänderten Voraussetzungen neu aufgerollt.
Welche Rolle spielen die „Intermezzi“ im Roman?
Die Intermezzi fungieren als Scharnierstücke zwischen den fünf Büchern. In ihnen wird das Erzählverfahren explizit durchgespielt und die Weichen für alternative Lebensgeschichten gestellt.
Welchen Zeitraum umfasst die Geschichte der Protagonistin?
Die Lebensgeschichten der einzelnen Figur umfassen fast das gesamte 20. Jahrhundert, von der Kindheit bis zum hohen Alter im Pflegeheim.
Welche zentralen Themen werden im Roman reflektiert?
Zentrale Themen sind Vergangenheit, Identität, Trauma, Gewalt, Verlust sowie die Auswirkungen von Judentum, Antisemitismus und Migration.
Wie wird die Vergangenheit im Buch verstanden?
Die Vergangenheit wird nicht als abgeschlossener, sondern als offener Raum betrachtet, der in die Gegenwart hineinwirkt und zukünftiges Geschehen mitbestimmt.
Was bedeutet die Formel „Am Ende eines Tages ist längst noch nicht aller Tage Abend“?
Sie symbolisiert die schöpferische Kraft des Erzählens, die logische Kausalitäten aufbricht und zeigt, dass Geschichten immer wieder neu beginnen können.
- Quote paper
- Hans-Georg Wendland (Author), 2016, "Eigentlich hätte es ganz anders kommen müssen." Die schöpferische Kraft des Erzählens in Jenny Erpenbecks Roman "Aller Tage Abend", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338846