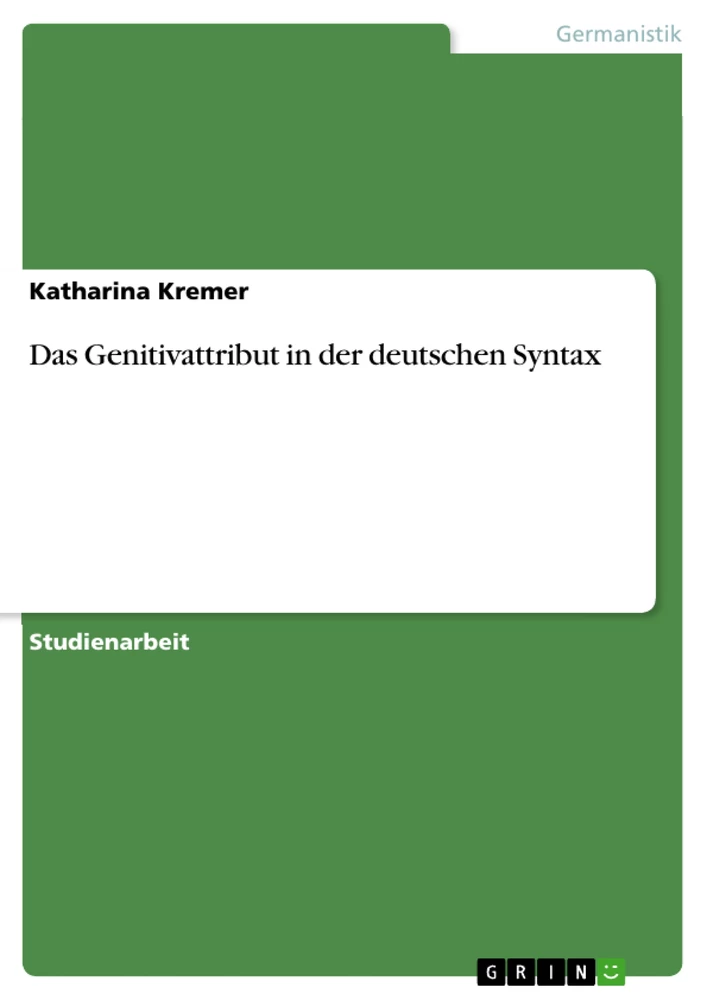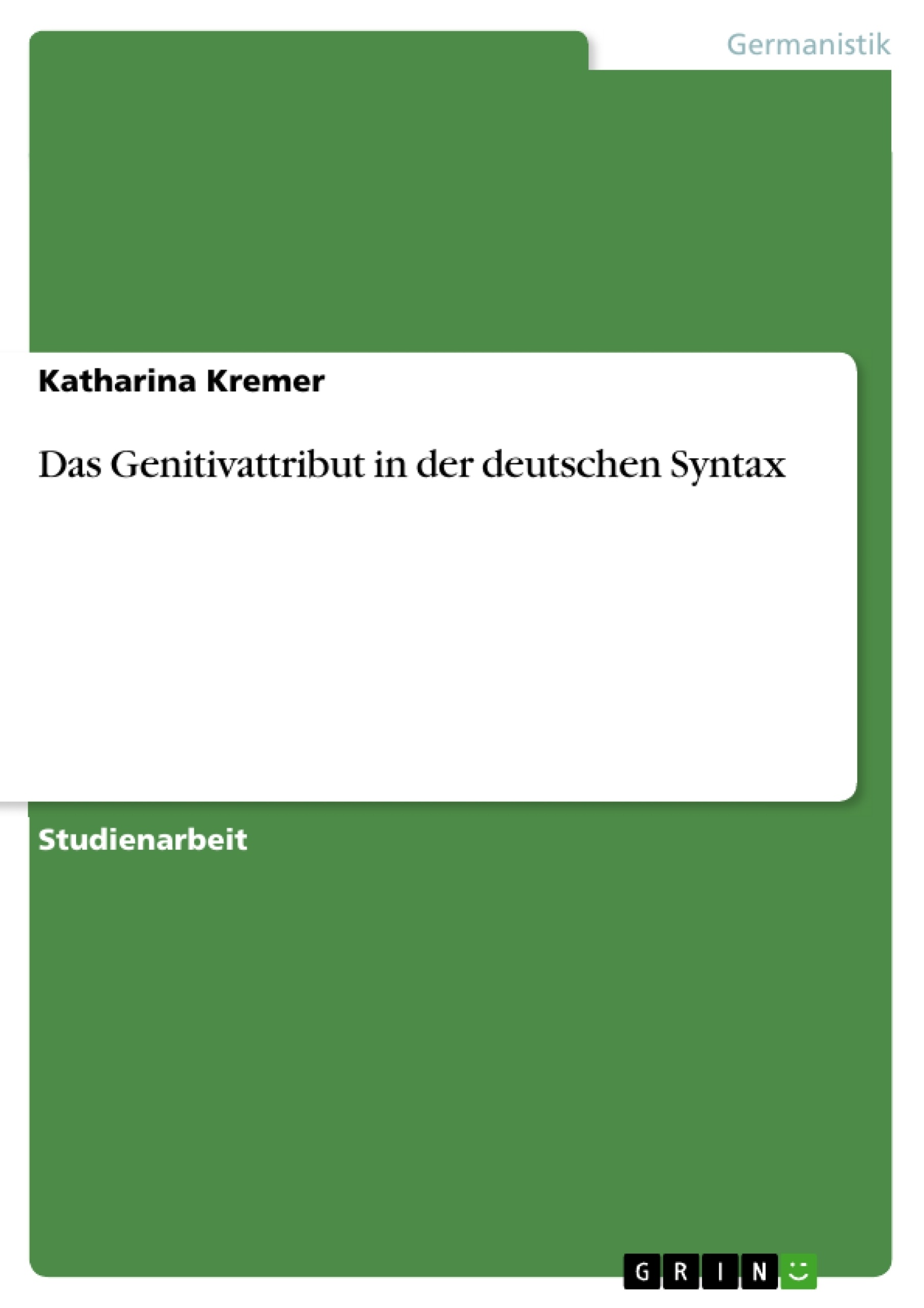Ziel dieser Hausarbeit ist es, die Stellung des Genitivattributs in der deutschen Syntax zu verdeutlichen. Der Begriff Attribut leitet sich von dem lateinischen Verb attribuere ab, welches mit „zuteilen“ oder „als Eigenschaft beilegen“ übersetzt wird. Attribute sind keine selbstständigen Satzglieder, sondern Beifügungen, die abgesehen von dem Prädikat jedes Satzglied erweitern können und von diesem abhängig sind. Sie sind somit nicht spitzenstellungsfähig und ebenfalls in fast allen Fällen alleine nicht frei verschiebbar, sondern nur mit dem Gliedteil, auf das sie sich beziehen. Daher werden sie in vielen Grammatiken als „Stellungsglied“ oder „sekundäres Satzglied“ bezeichnet.
Wolfgang Boettcher verweist darauf, dass nach seiner Auffassung der Begriff „Beifügung“, gemessen an den Möglichkeiten des Ausbaus eines Satzes durch das Attribut, zu unbedeutend klingen würde. Da Nominalgruppen als Attribute zu anderen Nominalgruppen hinzutreten können, können sie einen Satz in seiner Komplexität erheblich steigern. Zudem können diese Attribute wiederum Attribute mit sich führen. Boettcher nennt als Alternative die Begriffe „Gliedteil“ oder „Satzglied-Teil“, den Begriff „Konstituente“ hält er für zu unspezifisch.
Syntaktisch gelten alle Erweiterungen zu einem Nomen als Attribute, semantisch nur die Satzgliedteile, „die sich auf ein prädikatives Verhältnis zurückführen lassen“. Nach dieser Einleitung und einem allgemeinen Überblick über das Attribut in Teil II dieser Hausarbeit bezieht sich Teil III auf das Genitivattribut und seine Unterarten. Dabei werden sowohl die allgemeinen als auch die zusätzlich von Gerhard Helbig und Joachim Buscha definierten Attributarten benannt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Allgemeines über das Attribut
- 1. Die Attributarten
- 2. Das Attribut als Satzglied 2. Ordnung
- 3. Die Bezugswörter des Attributs
- 4. Die Stellung des Attributs
- III. Das Genitivattribut
- 1. Die verschiedenen Genitivattributarten
- 2. Außerdem bei Helbig/Buscha aufgeführt
- IV. Abschließende Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Genitivattribut und seiner Position in der deutschen Syntax. Ziel ist es, die verschiedenen Arten und Funktionen des Genitivattributs zu erläutern und seine Bedeutung für die Satzstruktur zu verdeutlichen.
- Definition und Abgrenzung des Genitivattributs
- Unterscheidung der Genitivattributarten
- Stellung des Genitivattributs im Satz
- Bedeutung des Genitivattributs für die Satzstruktur
- Vergleich mit anderen Attributarten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und definiert den Begriff des Attributs. Teil II bietet einen Überblick über allgemeine Eigenschaften des Attributs, einschließlich seiner verschiedenen Arten und seiner Funktion als Satzglied zweiter Ordnung.
Teil III konzentriert sich auf das Genitivattribut und seine Unterarten. Hier werden die verschiedenen Arten von Genitivattributen erläutert und die Definitionen von Helbig/Buscha vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe der Hausarbeit sind: Genitivattribut, Attributarten, Satzstruktur, deutsche Syntax, Satzglied zweiter Ordnung, Helbig/Buscha, Prädikatives Verhältnis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Attribut in der deutschen Grammatik?
Attribute sind Beifügungen zu Satzgliedern, die diese näher bestimmen. Sie sind keine selbstständigen Satzglieder, sondern Teil einer Nominalgruppe.
Welche Besonderheit hat das Genitivattribut?
Es steht meist nach dem Bezugswort (postponiert) und drückt oft Besitz oder Zugehörigkeit aus, kann aber auch andere semantische Rollen einnehmen.
Was bedeutet „Satzglied zweiter Ordnung“?
Dieser Begriff verdeutlicht, dass Attribute von einem Kernwort (Nomen) abhängen und nicht direkt vom Prädikat des Satzes gesteuert werden.
Welche Unterarten des Genitivattributs gibt es?
Es gibt unter anderem das Genitivus possessivus (Besitz), subiectivus (Urheber) und obiectivus (Ziel einer Handlung).
Sind Attribute im Satz frei verschiebbar?
Nein, sie können in der Regel nur zusammen mit dem Satzgliedteil verschoben werden, auf den sie sich beziehen.
- Quote paper
- Katharina Kremer (Author), 2016, Das Genitivattribut in der deutschen Syntax, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338864