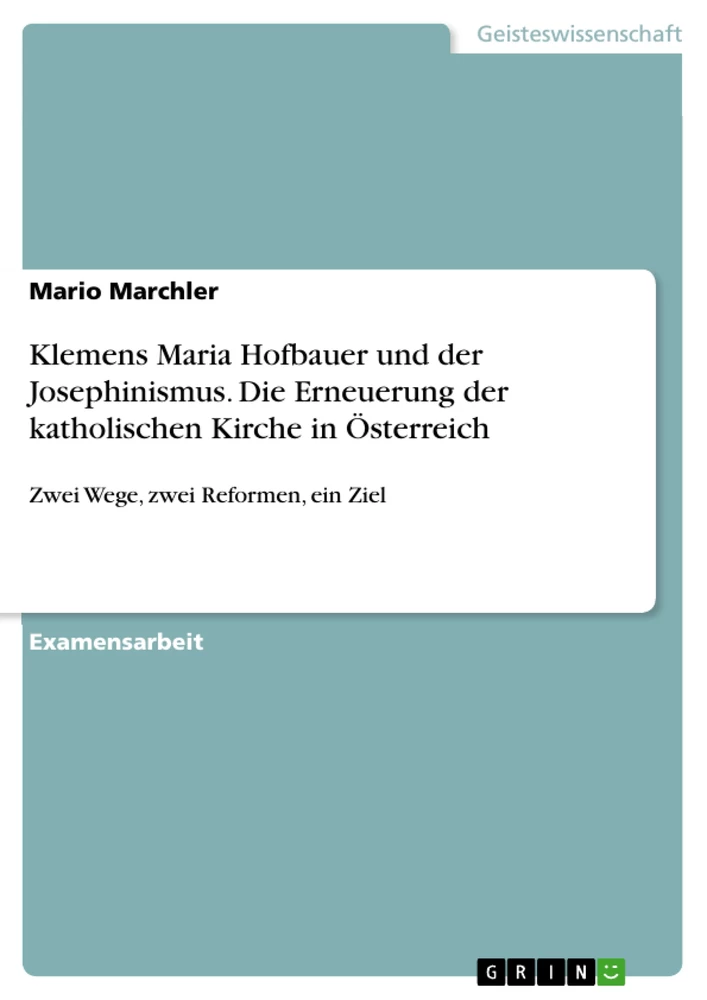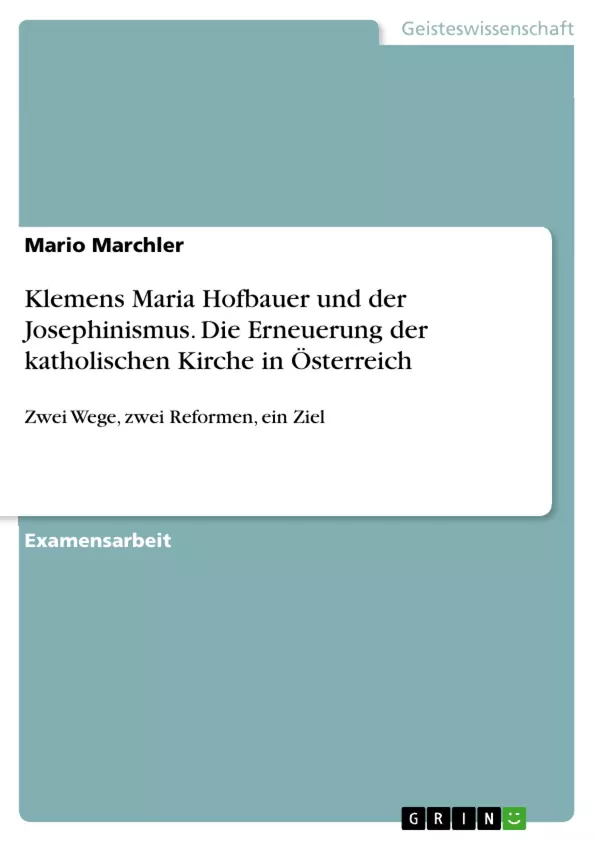Der Apostel von Wien, Klemens Maria Hofbauer, und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, Joseph II., hatten das gleiche Ziel: die Erneuerung der katholischen Kirche. Auf den ersten Blick unfassbar und unglaublich. Ein armer Ordensmann und ein glanzvoller Kaiser, ein Gegensatz in sich, doch bekanntlich ziehen sich Gegensätze an. Ein Ziel, aber nicht der gleiche Ursprung. So wollte Joseph II die Erneuerung der katholischen Kirche durch den Staat, was zum Josephinismus führte. Klemens wollte die Erneuerung der Kirche, die durch den Josephinismus schwer geschädigt war. Der Kaiser hatte das Wohl seines Volkes vor Augen, das unter vielen Gegebenheiten zu leiden hatte, auch unter der Kirche, und diesen negativen und belastenden Umständen rückte Joseph II. mit aller Kraft zu Leibe – so sehr, dass die Reform in seinem Reich sein ganzes Leben beanspruchte und verbrauchte. ‚Alles für das Volk und nichts durch das Volk‘ – so sein inoffizieller Wahl- und Lebensspruch. Klemens hingegen ging es um das Heil der Seelen, um die Menschen, die nach dem ewigen Leben lechz-ten. So schrieb er 1793 an seinen General in Rom: „Gedenkt vor allem jener Seelen, die in diesen Gegenden in unglaublicher Zahl ei-ne Beute der Hölle werden. Ich glaube, dass der Libertinismus nirgends so eine Herrschaft ausübt wir hier. Dieses Übel beherrscht vom Priester bis zum geringsten Bettler fast alle Herzen, und es besteht keine Hoffnung auf Besserung. In dieser Furcht muss man nur beten, dass der Herr den Leuchter nicht wegrücke.“
Diese Arbeit hat zum Ziel, Leben und Wirken des heiligen Klemens Maria Hofbauer im josephinischen Wien aufzuzeigen. Sie gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil wird der Lebenskontext von Klemens Hofbauer und Kaiser Joseph II. aufgeführt. Der zweite Teil ist der Biographie des heiligen Klemens gewidmet. Hier wird sein Leben entfaltet, sein langer Weg zum Priestertum, sein Weg und Wirken als Missionar. Das Leben Kaiser Josephs II. und sein Lebenswerk, der Josephinismus, werden im dritten Teil ausführlich geschildert. Die Arbeit endet mit dem vierten Teil, wo Klemens in Wien und als Kämpfer gegen den Josephinismus beschrieben wird. Auch das Erbe Hofbauers wird kurz behandelt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, eine Übersicht über die Reformen und Wege Hofbauers und Josephs II. zu geben, die beide danach strebten, die katholische Kirche in Österreich zu erneuern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Klemens Maria Hofbauer und Kaiser Joseph II. im Kontext des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts
- 1.1. Das Ende der spanischen Habsburgerlinie und der Spanische Erbfolgekrieg
- 1.2. Die Pragmatische Sanktion
- 1.3. Gründung der Kongregation des Heiligsten Erlösers (Redemptoristen)
- 1.4. Die Französische Revolution (1789-1799) und ihre Folgen
- 1.5. Die Gründung des Erbkaiserreiches Österreich und der Untergang des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation
- 1.6. Der Wiener Kongress
- 2. Klemens Maria Hofbauer
- 2.1. Vom Bäckerlehrling zum Ordensmann
- 2.2. St. Benno in Warschau - Die erste Station Klemens Maria Hofbauers als Redemptorist
- 2.3. Gründungsversuche von Klemens Hofbauer in Süddeutschland
- 2.4. Das Ende von St. Benno in Warschau
- 3. Kaiser Joseph II.
- 3.1. Ein Lebensbild des „,Reformer auf dem Kaiserthron”
- 3.2. Der Josephinismus
- 3.2.1. Grundlagen (Geistesströmungen) des Josephinismus
- 3.2.2. Die josephinische Reform
- 3.2.3. Die Gottesdienstreform unter Kaiser Joseph II.
- 3.2.4. Der Klerus in der Zeit des Josephinismus
- 4. Klemens Maria Hofbauer und die Kaiserstadt Wien
- 4.1. Hofbauers Mission in Wien
- 4.2. Der Tod und das Erbe Klemens Maria Hofbauers
- Zusammenfassung und Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die parallelen Reformbemühungen von Klemens Maria Hofbauer und Kaiser Joseph II. im 18. und 19. Jahrhundert mit dem Ziel, die Erneuerung der katholischen Kirche in Österreich zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die beiden unterschiedlichen Ansätze und die Auswirkungen ihrer Reformbestrebungen auf die Kirche und die Gesellschaft.
- Die Reformen von Klemens Maria Hofbauer und Kaiser Joseph II. im Kontext ihrer Zeit
- Die unterschiedlichen Ziele und Methoden der beiden Reformer
- Die Auswirkungen der Reformen auf die katholische Kirche in Österreich
- Die Bedeutung von Klemens Maria Hofbauer für die Entwicklung der Kirche in Wien
- Der Einfluss des Josephinismus auf die österreichische Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die beiden Protagonisten, Klemens Maria Hofbauer und Kaiser Joseph II., sowie ihre gemeinsamen Ziele vor. Kapitel 1 beleuchtet den historischen Kontext des 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts, in dem die Reformen von Hofbauer und Joseph II. stattfanden. Dabei werden wichtige Ereignisse wie das Ende der spanischen Habsburgerlinie, die Pragmatische Sanktion, die Französische Revolution und die Gründung des Erbkaiserreiches Österreich behandelt. Kapitel 2 befasst sich mit dem Leben und Wirken von Klemens Maria Hofbauer. Es werden seine Anfänge als Bäckerlehrling, seine Zeit als Redemptorist in Warschau und seine Gründungsversuche in Süddeutschland dargestellt. Kapitel 3 widmet sich dem Leben und der Reformpolitik von Kaiser Joseph II. Es werden seine Ziele, seine Methoden und die Auswirkungen seiner Reformen auf die Kirche und die Gesellschaft beleuchtet. Kapitel 4 untersucht die Mission von Klemens Maria Hofbauer in Wien und seine Bedeutung für die Entwicklung der Kirche in der Stadt. Das Schlusswort fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und zieht ein Fazit.
Schlüsselwörter
Klemens Maria Hofbauer, Josephinismus, katholische Kirche, Österreich, Reform, Erneuerung, Redemptoristen, Gottesdienstreform, Klerus, Wien, Habsburger, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Klemens Maria Hofbauer?
Hofbauer war ein Redemptorist und der „Apostel von Wien“, der sich für die religiöse Erneuerung und das Seelenheil der Menschen einsetzte.
Was versteht man unter Josephinismus?
Der Josephinismus bezeichnet die Reformpolitik Kaiser Josephs II., der die katholische Kirche dem Staat unterordnete und rein zweckorientiert reformieren wollte.
Hatten Hofbauer und Joseph II. das gleiche Ziel?
Beide wollten die Kirche erneuern, aber mit unterschiedlichen Ansätzen: Joseph II. durch staatliche Kontrolle, Hofbauer durch lebendigen Glauben und Seelsorge.
Was kritisierte Hofbauer am Josephinismus?
Er sah die Kirche durch die staatlichen Eingriffe schwer geschädigt und kämpfte gegen den „Libertinismus“ und die Verflachung des religiösen Lebens.
Welches Erbe hinterließ Klemens Maria Hofbauer in Wien?
Er belebte das katholische Leben in der Kaiserstadt neu und legte den Grundstein für das Ende der josephinischen Kirchenpolitik in Österreich.
- Citation du texte
- Mario Marchler (Auteur), 2016, Klemens Maria Hofbauer und der Josephinismus. Die Erneuerung der katholischen Kirche in Österreich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338941