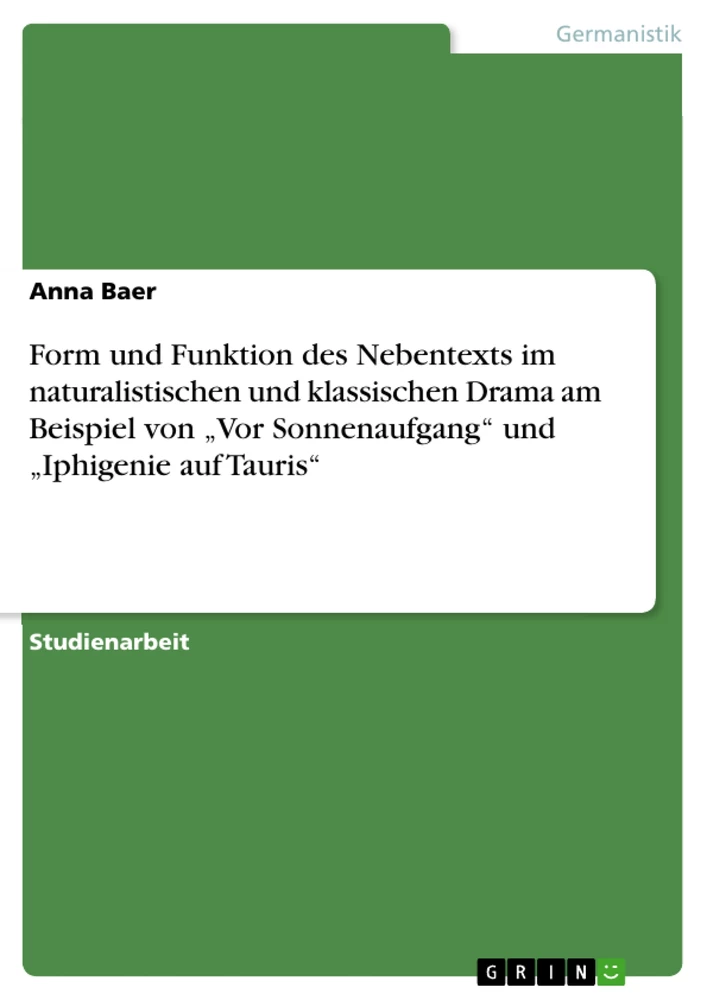Das Drama zählt, neben der Lyrik und der Epik, zu einer der drei literarischen Gattungen. Da Dramen Handlungen von Personen schriftlich fixieren, die für die Aufführung vor einem Publikum bestimmt sind – Ausnahmen bilden beispielsweise Lesedramen – werden im Drama Angaben zu der Umsetzung auf der Bühne gemacht. Dieses geschieht durch den Nebentext. Welche Funktionen der Nebentext noch besitzt, werde ich im folgenden Kapitel detaillierter darlegen.
Ab dem achtzehnten Jahrhundert tendierte der Nebentext dazu, mehr Platz im Drama einzunehmen. In dieser Hausarbeit soll deshalb der Frage nachgegangen werden, welche Gründe es für die sogenannte Episierung des Dramas gibt. Dafür werde ich mich mit einer Epoche genauer beschäftigen, in der die Nebentexte im Drama teilweise ganze Seiten eingenommen haben – die Epoche des Naturalismus (3.). Beweggründe für die Länge der Nebentexte sollen einerseits durch die generellen Ansichten der Autoren ausgemacht werden, die durch verschiedene Forschungsliteratur zusammengetragen werden. Andererseits wird durch den konsequenten Naturalismus von Holz und Schlaf versucht, weitere Gründe für dieses Phänomen zu finden (3.1.).
Anhand des Dramas von Hauptmann „Vor Sonnenaufgang“ soll exemplarisch gezeigt werden, wie sich das Verhältnis von Haupt- und Nebentext gestaltet (3.2.). Dieses Drama wurde ausgewählt, da der Autor Gerhart Hauptmann „als der größte Praktiker naturalistischer Ideen“ und sein Drama als Vorzeigewerk des Naturalismus gilt . Nach einer kurzen inhaltlichen Vorstellung des Dramas (3.2.1.) wird das zuvor durch die theoretischen Schriften erworbene Wissen über die Gründe der langen Nebentexte und die generelle Form dieser auf das Drama angewandt werden (3.2.2.).
Am Ende wird ein Drama vorgestellt, das im Gegensatz zu „Vor Sonnenaufgang“ sehr wenig Nebentext enthält – „Iphigenie auf Tauris“ (4.). Es wurde mit Absicht ein Drama aus der Epoche der Weimarer Klassik ausgewählt, da sich die Naturalisten bewusst von den Vertretern dieser Epoche absetzen wollten, wie auch später genauer ausgeführt wird. Da „Iphigenie auf Tauris“ als ein Musterbeispiel des klassischen Dramas zählt, fiel die Wahl auf dieses Werk.
In der Forschung gibt es zahlreiche Arbeiten, die sich mit dem Nebentext im Naturalismus beschäftigen. Die Forschungslage zu dem Nebentext in Dramen der Weimarer Klassik ist relativ schlecht. Welche Gründe könnte das haben? War der Nebentext für Dramenautoren der Weimarer Klassik unbedeutend? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Haupt- und Nebentext im Drama generell
- 2.1. Haupttext
- 2.2. Nebentext
- 3. Die Epoche des Naturalismus
- 3.1. Der konsequente Naturalismus nach Holz und Schlaf
- 3.2. Konkretes Beispiel: Hauptmanns soziales Drama „Vor Sonnenaufgang“
- 3.2.1. Vorstellung des Dramas
- 3.2.2. Der Nebentext konkret im Drama „Vor Sonnenaufgang“ – Textbeispiele
- 4. Der Nebentext im Naturalismus im Vergleich zu einem klassischen Drama
- 4.1. Konkretes Beispiel: „Iphigenie auf Tauris“
- 4.1.1. Vorstellung des Dramas
- 4.1.2. Der Nebentext konkret im Drama „Iphigenie auf Tauris“ – Textbeispiele
- 4.1. Konkretes Beispiel: „Iphigenie auf Tauris“
- 5. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Form und Funktion des Nebentextes im naturalistischen und klassischen Drama. Sie untersucht die Entwicklung des Nebentextes im Drama seit dem 18. Jahrhundert und analysiert anhand von Beispielen, wie sich die Länge und der Inhalt des Nebentextes in den verschiedenen Epochen unterscheiden.
- Die Entwicklung des Nebentextes im Drama
- Der Einfluss des Naturalismus auf die Funktion und Form des Nebentextes
- Der Vergleich des Nebentextes im naturalistischen Drama mit dem klassischen Drama
- Die Bedeutung des Nebentextes für die Inszenierung und Interpretation des Dramas
- Die Rolle des Nebentextes in der Dramenanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Bedeutung des Nebentextes im Drama. Kapitel 2 behandelt die allgemeine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebentext im Drama und beschreibt die Funktionen des Nebentextes. Kapitel 3 widmet sich der Epoche des Naturalismus und analysiert den Einfluss des Naturalismus auf den Nebentext anhand von Gerhart Hauptmanns Drama „Vor Sonnenaufgang“. Kapitel 4 stellt den Nebentext im klassischen Drama am Beispiel von Goethes „Iphigenie auf Tauris“ vor und vergleicht ihn mit dem Nebentext im Naturalismus. Die Zusammenfassung und das Fazit fassen die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Nebentext, Drama, Naturalismus, Weimarer Klassik, „Vor Sonnenaufgang“, Gerhart Hauptmann, „Iphigenie auf Tauris“, Johann Wolfgang von Goethe, Dramenanalyse, Inszenierung, Regiebemerkungen, Haupttext, Figurenrede.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Haupttext und Nebentext im Drama?
Der Haupttext besteht aus der Figurenrede (Dialoge, Monologe). Der Nebentext umfasst alle anderen Angaben wie Regiebemerkungen, Szenenbeschreibungen und Personenverzeichnisse.
Warum ist der Nebentext im naturalistischen Drama so umfangreich?
Im Naturalismus (z. B. bei Gerhart Hauptmann) sollte die Realität exakt abgebildet werden. Lange Nebentexte beschreiben Milieu, Mimik und Geräusche detailgetreu, um eine wissenschaftlich exakte Illusion der Wirklichkeit zu schaffen.
Was versteht man unter der „Episierung“ des Dramas?
Es bezeichnet den Trend, dass erzählende (epische) Elemente wie ausführliche Beschreibungen im Nebentext zunehmen und das eigentliche dramatische Handeln dominieren.
Wie unterscheidet sich Goethes „Iphigenie auf Tauris“ von Hauptmanns Werk?
In der Weimarer Klassik ist der Nebentext minimal. Der Fokus liegt auf der Sprache und den zeitlosen Ideen, während der Naturalismus das konkrete soziale Milieu durch lange Beschreibungen betont.
Welche Funktion hat der Nebentext für die Inszenierung?
Er gibt dem Regisseur und den Schauspielern präzise Anweisungen zur Gestaltung der Bühne, zur Kleidung und zur Art und Weise, wie Sätze gesprochen werden sollen.
Warum wehrten sich Naturalisten gegen die klassische Dramenform?
Sie empfanden die klassische Form als künstlich und realitätsfern. Ihr Ziel war es, die „Wahrheit“ des einfachen Lebens und soziale Missstände ungeschönt darzustellen.
- Citar trabajo
- Anna Baer (Autor), 2015, Form und Funktion des Nebentexts im naturalistischen und klassischen Drama am Beispiel von „Vor Sonnenaufgang“ und „Iphigenie auf Tauris“, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338958