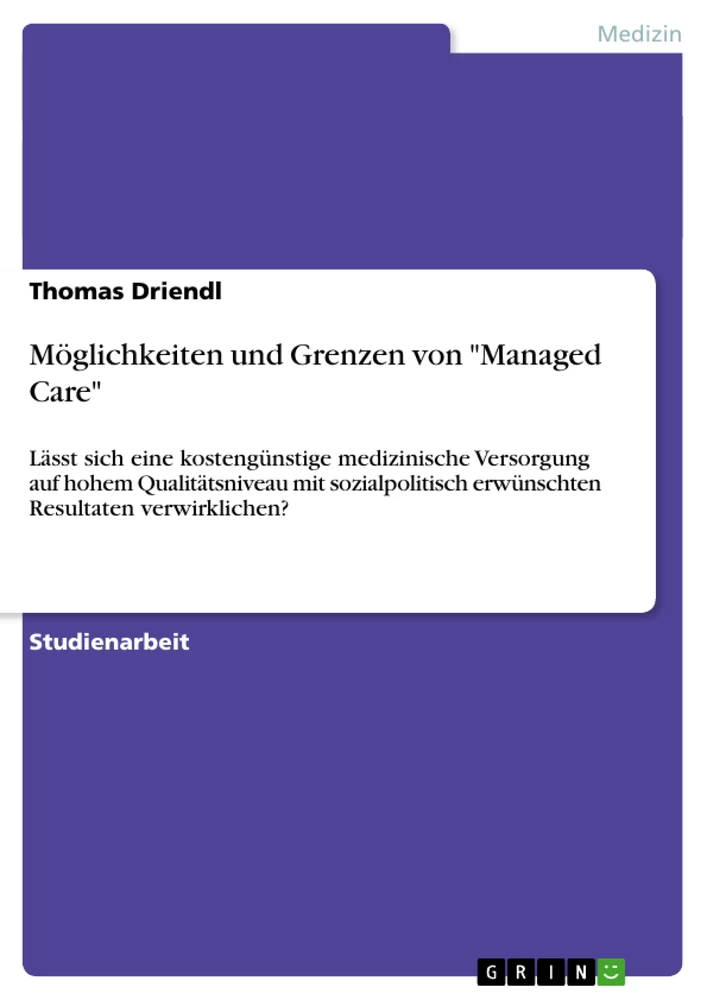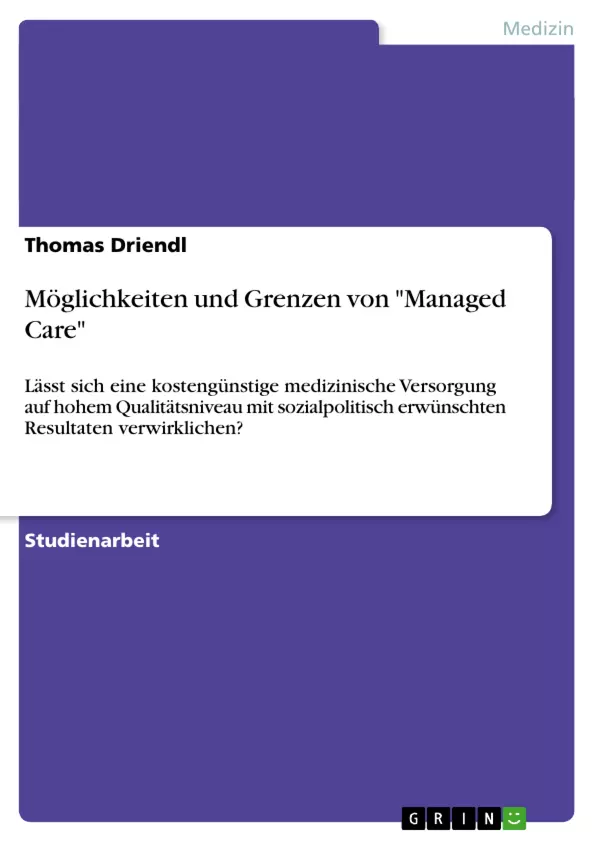Der Begriff „Managed Care“ stammt aus den USA kann aufgrund der Verschiedenheit der Gesundheitssysteme nicht so ohne weiteres auf europäische, insbesondere deutsche oder österreichische Verhältnisse übertragen werden.
Auch ist eine einheitliche Definition für „Managed Care“ so gut wie nicht vorhanden (Vgl. Puke 2000, S. 4) und der Begriff beschreibt auch kein geschlossenes Theoriekonzept, sondern ist vielmehr als Oberbegriff für Organisationsformen und Management-Instrumente im Gesundheitswesen zu verstehen. Volker Amelung (1999, S. 52) definiert es als Konzept, das „die Anwendung von Managementprinzipien auf die medizinische Versorgung und die Integration der Funktionen Versicherung und Versorgung“ umfasst, „wobei das selektive Kontrahieren mit Leistungserstellern (providern) als weiteres konstitutives Element hinzugefügt werden soll.“
Der Ärzteverein Zürcher Limmattal wiederum versteht unter „Managed Care“ „das Angebot von medizinischen Leistungen in einem begrenzten Netzwerk von Leistungserbringern, die für die Betreuung der Versicherten verantwortlich sind und eine qualitätskontrollierte und kosteneffektive Medizin betreiben. (...) Managed Care ist ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von Massnahmen mit dem Ziel, Angebot und Nachfrage in der medizinischen Versorgung in den Griff zu bekommen und eine qualitativ gute und kostengünstige Medizin für alle zu garantieren. Es geht also vor allem, aber nicht nur, um Kostensenkungs- maßnahmen.“ (Ärzteverein Zürcher Limmattal 2001) Damit wird die dieser Definition innewohnende Problematik aufgezeigt: lässt sich eine „qualitativ gute“ mit einer „kostengünstigen“ Medizin vereinbaren, die noch dazu „für alle“ garantiert werden soll?
Inhaltsverzeichnis
- Was ist „Managed Care“?
- Warum überhaupt „Managed Care“?
- Die „Krise“ des Gesundheitssystems.
- „Managed Care“ in den USA - eine „Erfolgsstory“?
- Das Problem der Übertragbarkeit von Konzepten.
- Organisationsformen von „Managed Care“
- Ziele von „Managed Care“
- Strategien von „Managed Care“
- Ökonomische Anreize durch neue Vergütungsmechanismen
- Kosteneffizienz durch Integration der medizinischen Behandlungskette
- Nachfragesteuerung durch Selbstbehalte
- Einschränkung des freien Leistungszugangs durch „gatekeeping“
- Steuerung und Kontrolle des Leistungsgeschehens
- Disease Management.
- Case Management......
- Managed Competition
- Möglichkeiten und Grenzen von „Managed Care“
- Möglichkeiten – empirische Ergebnisse
- Grenzen von „Managed Care“
- Zusammenfassung der Vor- und Nachteile von „Managed Care“
- Erfahrungen aus der Schweiz.........
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Konzept des „Managed Care“ im Gesundheitswesen und untersucht seine Möglichkeiten und Grenzen, insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von Kosteneffizienz und qualitativ hochwertiger medizinischer Versorgung. Die Arbeit analysiert die Ursachen der „Krise“ des Gesundheitssystems und beleuchtet die Entstehung und Entwicklung von „Managed Care“ in den USA. Im Fokus stehen die Organisationsformen und Ziele von „Managed Care“ sowie die verschiedenen Strategien, die eingesetzt werden, um die Versorgung zu steuern und zu kontrollieren.
- Kosteneffizienz und Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen
- „Managed Care“ als Konzept zur Bewältigung der „Krise“ des Gesundheitssystems
- Organisationsformen, Ziele und Strategien von „Managed Care“
- Möglichkeiten und Grenzen von „Managed Care“ in Bezug auf die Gestaltung des Gesundheitswesens
- Erfahrungen mit „Managed Care“ in verschiedenen Ländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Managed Care“ und beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Übertragung des Konzepts auf europäische Gesundheitssysteme. Kapitel 2 untersucht die Ursachen der „Krise“ des Gesundheitssystems, insbesondere die demographischen Herausforderungen und systemimmanenten Faktoren, die zu einem Anstieg der Gesundheitsausgaben führen. Kapitel 2.2 beleuchtet die Entwicklung von „Managed Care“ in den USA und präsentiert die vermeintlichen Erfolge in Bezug auf Kostensenkung.
Kapitel 3 analysiert verschiedene Organisationsformen von „Managed Care“, während Kapitel 4 die Ziele des Konzepts, wie z.B. Kosteneffizienz und Qualitätssteigerung, darlegt. In Kapitel 5 werden die verschiedenen Strategien des „Managed Care“ beleuchtet, darunter ökonomische Anreize durch neue Vergütungsmechanismen, Integration der Behandlungskette, Nachfragesteuerung und Steuerung des Leistungsgeschehens.
Kapitel 6 widmet sich den Möglichkeiten und Grenzen von „Managed Care“, analysiert empirische Ergebnisse und diskutiert die Risiken des Konzepts. Erfahrungen aus der Schweiz werden in Kapitel 7 vorgestellt.
Schlüsselwörter
„Managed Care“, Gesundheitssystem, Kostensenkung, Qualitätssteigerung, Gesundheitsausgaben, Organisationsformen, Strategien, Disease Management, Case Management, Managed Competition, empirische Ergebnisse, Grenzen, Erfahrungen, Schweiz.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Managed Care"?
Managed Care ist ein Oberbegriff für Organisationsformen im Gesundheitswesen, die Managementprinzipien auf die medizinische Versorgung anwenden, um Qualität zu sichern und Kosten zu kontrollieren.
Woher stammt das Konzept Managed Care?
Das Konzept stammt ursprünglich aus den USA und wurde dort als Reaktion auf stark steigende Gesundheitsausgaben entwickelt.
Was ist "Gatekeeping"?
Gatekeeping bedeutet, dass Patienten zuerst einen Hausarzt (den Gatekeeper) aufsuchen müssen, der über die Überweisung zu Spezialisten entscheidet, um unnötige Behandlungen zu vermeiden.
Kann Managed Care die Qualität der Medizin garantieren?
Kritiker hinterfragen, ob kostengünstige Medizin immer qualitativ hochwertig sein kann. Befürworter sehen durch Programme wie Disease Management eine bessere Koordination und damit höhere Qualität.
Welche Erfahrungen gibt es in der Schweiz mit Managed Care?
In der Schweiz gibt es verschiedene Modelle (z.B. HMO-Modelle), die zeigen, dass durch integrierte Versorgungsketten und Netzwerke Effizienzgewinne möglich sind.
Was ist Disease Management?
Disease Management ist ein systematisches Behandlungsprogramm für chronisch Kranke, das auf evidenzbasierten Leitlinien basiert, um den Behandlungsverlauf zu optimieren.
- Quote paper
- Mag. Thomas Driendl (Author), 2003, Möglichkeiten und Grenzen von "Managed Care", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33907