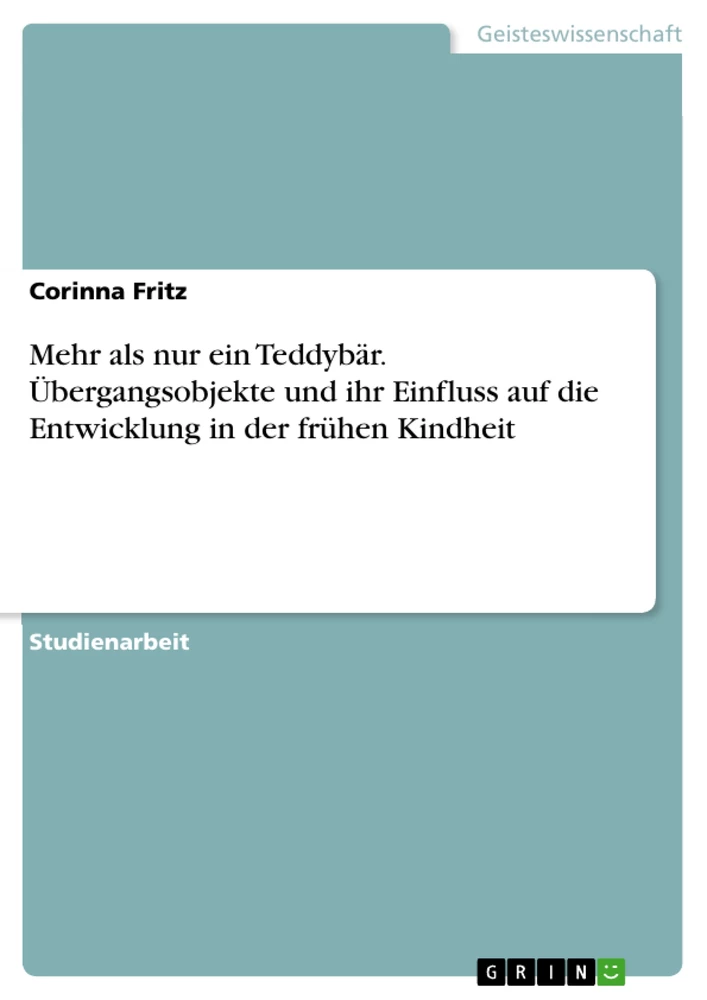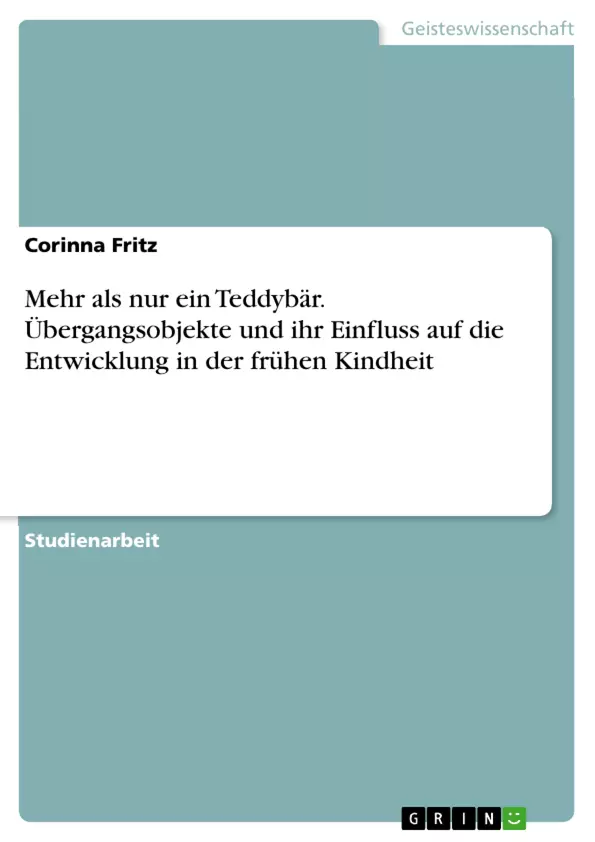Das Thema der vorliegenden Arbeit eröffnete sich der Verfasserin im Rahmen ihrer erzieherischen Tätigkeit innerhalb einer Kinderkrippe. Denn die meisten Kinder starten ihre Eingewöhnungszeit mit einem Elternteil und einem Kuscheltier. Ist die Eingewöhnungszeit abgeschlossen, verabschieden sich die Eltern am Morgen und gehen zur Arbeit, aber das Kuscheltier bleibt.
In der heutigen Zeit, in der außerfamiliäre Kinderbetreuung immer früher beginnt, ist das Kuscheltier als Wegbegleiter ein aktuelles Thema. Bei der Betrachtung vieler Diskussionen in Online-Foren philosophiert eine Vielzahl von Eltern über das Kuscheltier. Folglich lohnt es sich danach zu forschen, ob nicht doch mehr hinter diesen geliebten Objekten steckt.
Es ergeben sich mehrere Fragen. Kann das Kuscheltier den Ablöseprozess des Kindes erleichtern? Wie bewältigt ein Kind mit Kuscheltier den Alltag in der Kinderkrippe im Vergleich zu einem Kind ohne dieses? Bietet es dem Kind Sicherheit um sich selbstständig entwickeln zu können? Im Rahmen dieser Ausarbeitung soll daher folgende Leitfrage bearbeitet werden. Sind Übergangsobjekte für die Entwicklung in der frühen Kindheit hilfreich?
Die Theorie von WINNICOTT beschäftigte sich schon in den 50er Jahren mit der Funktion des Kuscheltiers und gab einen Denkanstoß für weitere Ansichten, wie auch für die Theorie von BOWLBY. Im Abschnitt zwei sollen daher diese zwei Theorien dargestellt und in Beziehung gesetzt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärung und Vorstellung der Theorien
- 2.1 Definition Übergangsobjekte
- 2.2 Funktionen der Beziehung zum Übergangsobjekt
- 2.3 Objektbeziehungstheorie nach Donald Winnicott
- 2.4 Grundlagen der Bindungstheorie nach John Bowlby
- 2.5 Bezug zu Übergangsobjekten in John Bowlbys Bindungstheorie
- 3. Fallbeispiele aus der Praxis und Interviews
- 3.1 Fallbeispiel I: Kind mit Übergangsobjekt
- 3.2 Interview mit Jonahs Mutter
- 3.3 Falleispiel II: Kind ohne Übergangsobjekt
- 3.4 Interview mit Pauls Mutter
- 4. Ergebnisse
- 4.1 Vergleich der Fallbeispiele
- 4.2 Darstellung der Ergebnisse und kritische Analyse
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Übergangsobjekten, wie z.B. Kuscheltieren, für die soziale Entwicklung von Kindern in der frühen Kindheit. Sie analysiert, ob diese Objekte den Ablöseprozess des Kindes von der Mutter erleichtern und wie sie dem Kind Sicherheit und Unterstützung in der Kinderkrippe bieten können.
- Definition und Funktionen von Übergangsobjekten
- Objektbeziehungstheorie nach Winnicott und Bindungstheorie nach Bowlby
- Fallbeispiele von Kindern mit und ohne Übergangsobjekten
- Vergleich der Fallbeispiele und Analyse der Ergebnisse
- Bedeutung von Übergangsobjekten für die Entwicklung des Kindes
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und beschreibt die Entstehung der Forschungsfrage im Kontext der erzieherischen Praxis. Kapitel zwei definiert den Begriff des Übergangsobjektes und stellt die relevanten Theorien von Winnicott und Bowlby vor. Die Kapitel drei und vier präsentieren Fallbeispiele von Kindern mit und ohne Übergangsobjekten, analysieren die Ergebnisse und vergleichen die beiden Fälle. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen und beantwortet die Leitfrage der Arbeit.
Schlüsselwörter
Übergangsobjekte, Kuscheltiere, soziale Entwicklung, frühkindliche Entwicklung, Objektbeziehungstheorie, Winnicott, Bindungstheorie, Bowlby, Ablöseprozess, Sicherheit, Kinderkrippe.
- Quote paper
- Corinna Fritz (Author), 2016, Mehr als nur ein Teddybär. Übergangsobjekte und ihr Einfluss auf die Entwicklung in der frühen Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339154