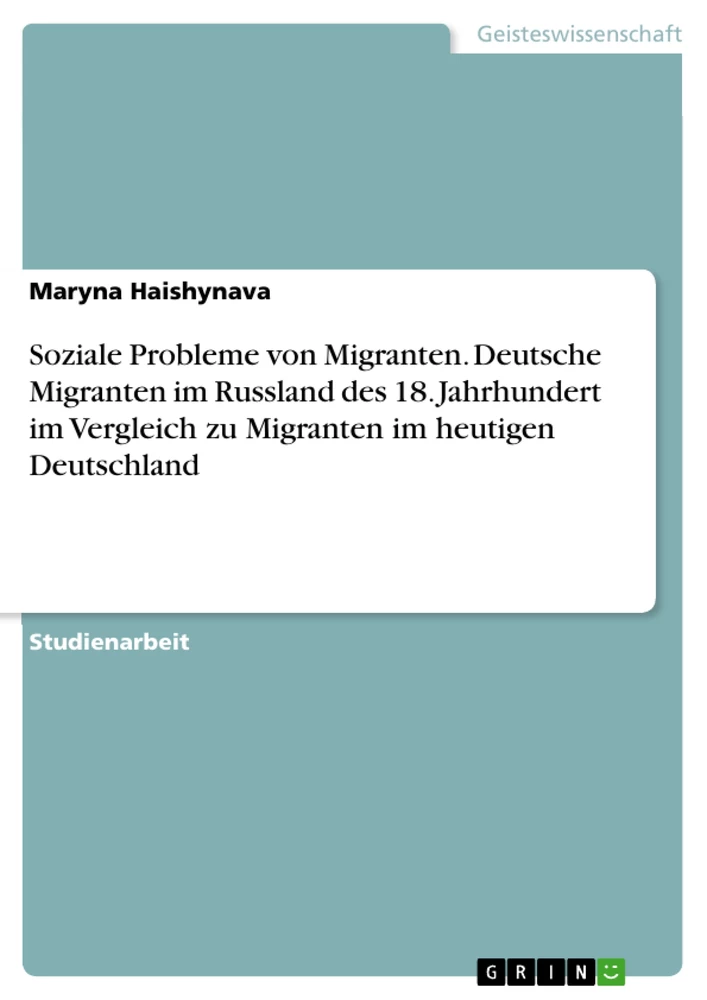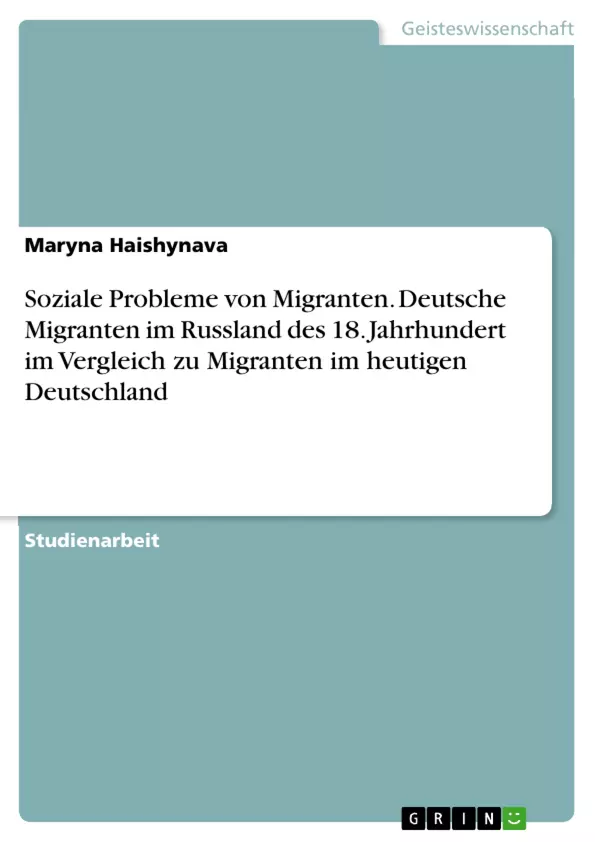Soziale Probleme sind immer aktuell für die moderne Gesellschaft. Die Verschärfung vieler sozialer Probleme in unserer Gesellschaft, die Notwendigkeit ihrer Erforschung und Lösung verursachen die in letzter Zeit wachsende Aufmerksamkeit der Soziologen zu den konzeptionellen Entwicklungen in diesem Gebiet.
Im Alltag werden damit solche Beispiele wie Armut, Drogenkonsum, Arbeitslosigkeit, Gewalt oder Diskriminierung assoziiert. Der Begriff „soziales Problem“ ist mittlerweile in die Alltagssprache eingegangen und die damit bezeichneten Bedingungen oder Verhaltensweisen sind Bestandteil öffentlicher Diskussion, politischer Maßnahmen und wissenschaftlicher Untersuchungen.
Soziale Probleme der im 18. Jahrhundert nach Russland emigrierten Deutschen im Vergleich zu den sozialen Problemen der Migranten im heutigen Deutschland stellen zentrale Handlungsfelder meiner Arbeit. Das Thema ist besonders wichtig, weil sie ein zunehmendes gesellschaftliches Problem darstellt.
Der Text klärt die Frage nach der Definition des Begriffes „Soziale Probleme“ und gibt eine kurze Charakteristik aus Sicht eines soziologen. Weiterhing gibt er einen historischen Einblick in die Migration von Deutschen nach Russland und schildert deren damalige Probleme. Zuletzt werden die soziale Probleme der Migranten im heutigen Deutschland aufgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1. Soziale Probleme im wissenschaftlichen Kontext
- 1.1. Soziale Probleme. Begriffserklärung.
- 1.2. Soziale Probleme aus der Sicht der Soziologen.
- Kapitel II. Soziale Probleme der im 18 Jh. nach Russland emigrierten Deutschen.
- 2.1. Einladungsmanifest von Katharina II.
- 2.2. Auswanderung nach Russland.
- 2.3. Soziale und gesellschaftliche Probleme.
- 2.4. Die Nachkriegszeit.
- Kapitel III. Soziale Probleme der Migranten im heutigen Deutschland.
- 3.1. Migration. Begriffserklärung.
- 3.2. Häufigste Probleme bei Migranten.
- Kapitel IV. Integrationsprobleme und derer Lösung.
- 4.1. Integrationsprobleme bei den Spätaussiedler.
- 4.2. Integrationsprobleme. Hitergründe. Meine Sichtweise als Migrantin.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den sozialen Problemen der im 18. Jahrhundert nach Russland emigrierten Deutschen im Vergleich zu den sozialen Problemen der Migranten im heutigen Deutschland. Der Fokus liegt auf der Analyse der historischen und aktuellen Herausforderungen der Migration und Integration, sowie auf der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen den beiden Gruppen.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs „Soziale Probleme“
- Soziale Probleme der deutschen Emigranten nach Russland im 18. Jahrhundert
- Soziale Probleme der Migranten im heutigen Deutschland
- Integrationsprobleme und deren Lösungen
- Die Rolle von Politik und Gesellschaft bei der Integration von Migranten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas "Soziale Probleme" in modernen Gesellschaften dar und führt in die Thematik der Arbeit ein. Kapitel 1 definiert den Begriff „Soziale Probleme“ und betrachtet die wissenschaftliche Perspektive auf dieses Thema. Kapitel 2 beleuchtet die Auswanderung von Deutschen nach Russland im 18. Jahrhundert und die damit verbundenen sozialen Probleme. In Kapitel 3 werden die sozialen Probleme von Migranten im heutigen Deutschland analysiert. Kapitel 4 beschäftigt sich mit Integrationsproblemen und deren Lösungen, insbesondere im Kontext von Spätaussiedlern.
Schlüsselwörter
Soziale Probleme, Migration, Integration, Auswanderung, Deutschland, Russland, Spätaussiedler, Migranten, Integrationsprobleme, Gesellschaft, Politik, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was vergleicht diese Arbeit im Hinblick auf Migration?
Die Arbeit vergleicht die sozialen Probleme deutscher Emigranten im Russland des 18. Jahrhunderts mit den Herausforderungen von Migranten im heutigen Deutschland.
Wie wird der Begriff „soziales Problem“ in der Soziologie definiert?
Soziale Probleme werden mit Bedingungen oder Verhaltensweisen assoziiert, die gesellschaftlich als belastend wahrgenommen werden, wie Armut, Arbeitslosigkeit, Diskriminierung oder Gewalt.
Warum wanderten Deutsche im 18. Jahrhundert nach Russland aus?
Ein zentraler Auslöser war das Einladungsmanifest von Katharina II., das deutschen Siedlern Land und Privilegien in Russland versprach.
Welche sozialen Probleme hatten deutsche Emigranten in Russland?
Neben den harten Lebensbedingungen in der neuen Heimat befasst sich die Arbeit auch mit gesellschaftlichen Spannungen und den langfristigen Folgen bis in die Nachkriegszeit.
Was sind die häufigsten Integrationsprobleme heutiger Spätaussiedler?
Thematisiert werden sprachliche Barrieren, die Anerkennung von Berufsabschlüssen sowie Identitätskonflikte und die gesellschaftliche Akzeptanz in Deutschland.
Welche Rolle spielen Politik und Gesellschaft bei der Integration?
Die Arbeit betont, dass Integration eine gemeinsame Aufgabe ist, die sowohl politische Maßnahmen als auch die Offenheit der aufnehmenden Gesellschaft erfordert.
- Quote paper
- Maryna Haishynava (Author), 2014, Soziale Probleme von Migranten. Deutsche Migranten im Russland des 18. Jahrhundert im Vergleich zu Migranten im heutigen Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339362