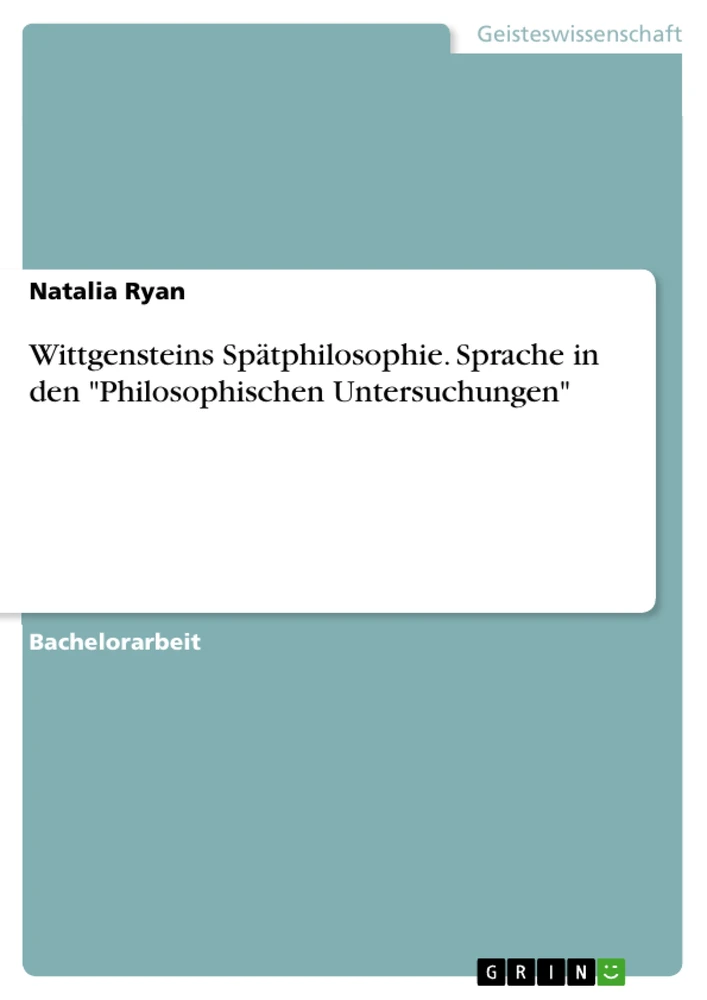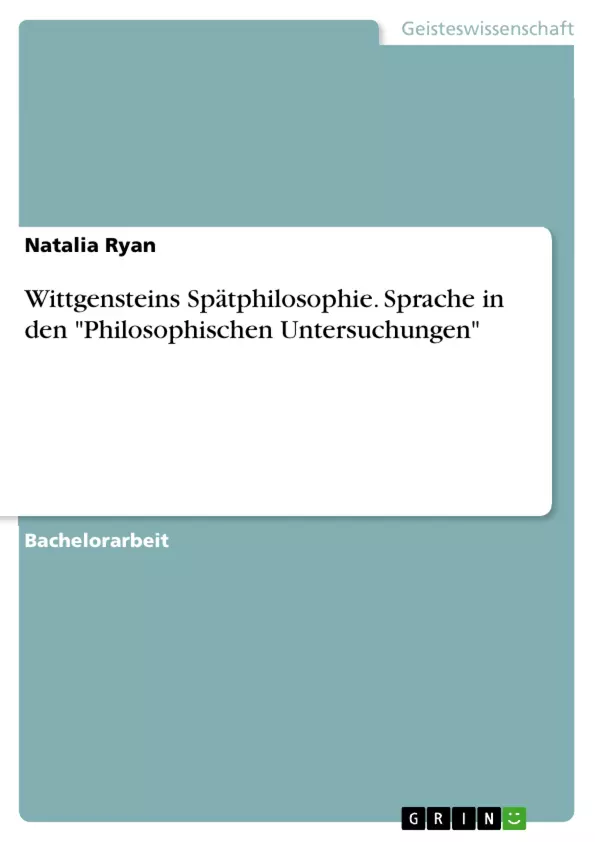Wittgenstein ist im wahrsten Sinne des Wortes ein einzigartiger Philosoph, ein Denker wie kein anderer. Geboren 1889 in Wien, gestorben 1951 in Cambridge, durchläuft er kein typisches Leben, er stammt aus einem reichen Haus und genoss viele Privilegien. Im Laufe seines Lebens änderte sich sehr Vieles, seine Art und Weise zu leben, wie auch seine Besonderheit in Bezug auf seine Philosophiestandpunkte.
Man unterscheidet im Nachhinein zwei Schaffensperioden bei Wittgenstein. Die erste Phase steht unter dem Titel seines ersten Hauptwerkes, den „Tractatus logico-philosophicus“(1921) und handelt hauptsächlich von der logischen Theorie, worin er die Schranken der Sprache zeigt und die Philosophie vom Unsinn und Verwirrung bereinigen möchte. Eigentlich hat Wittgenstein Ingenieurswesen studiert, daher sein Interesse an der mathematischen Logik, die ihn später zur Zusammenarbeit mit Bertrand Russel in Cambridge führt. Die zweite Periode ist gekennzeichnet durch sein späteres Werk, den „Philosophischen Untersuchungen“(veröffentlicht 1953) und weist eine radikale Wendung zum vorherigen Werk auf. Er entwickelt eine Sprachtheorie und übt darin seine Kritik aus. Um einige Teile Wittgensteins Spätphilosophie wird es im Folgenden hier gehen.
Gegenstand dieser Arbeit ist ein Bereich von der späteren Philosophie Wittgensteins, also aus den späten Dreißigern bis zu seinem Tod im Jahre 1951. Davor hatte Wittgenstein eine Periode gehabt, in der sich ein Wandel vollzog vom Tractatus zu seiner Spätphilosophie. Mit anderen Worten, er gewinnt zu seinem ersten Hauptwerk Abstand und entwickelt sich neu bzw. weiter. Im Folgenden werden zentrale Gedanken aus seinem Spätwerk näher betrachtet und untersucht. Seine Philosophie der Mathematik bleibt hierbei aber außen vor. Ebenso seine kürzeren Schriften, die posthum veröffentlich wurden. In diesen kurzen Werken vertritt Wittgenstein letztendlich die gleichen Thesen wie in seinen Philosophischen Untersuchungen, Zettel und Über Gewissheit.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1.) Einleitung
- 2.) Die Übergangszeit
- 3.) Wittgensteins Spätphilosophie
- 4.) Über die Sprache
- 5.) Die Regelbefolgung als sprachliches Muster
- 6.) Zusätzliche Kriterien
- 7.) Wittgensteins,,philosophische Psychologie“
- 8.) Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit einem Bereich der späteren Philosophie Ludwig Wittgensteins, insbesondere mit seinen Schriften aus den späten 1930er Jahren bis zu seinem Tod im Jahr 1951. Der Fokus liegt auf der Analyse seiner Spätphilosophie, insbesondere der Sprachtheorie, die er im Gegensatz zu seinem ersten Hauptwerk, dem „Tractatus logico-philosophicus“, entwickelte.
- Wittgensteins Spätphilosophie als Abkehr vom Tractatus
- Analyse von Wittgensteins Sprachtheorie und Kritik an traditionellen philosophischen Ansätzen
- Untersuchung des Begriffs der Regelbefolgung und seine Bedeutung für die Sprachphilosophie
- Exploration von Wittgensteins „philosophischen Psychologie“ und ihrer Relevanz für die Philosophie des Geistes
- Die Bedeutung von Wittgensteins Spätwerk für die heutige Philosophie
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Dieses Kapitel stellt den Gegenstand der Arbeit vor und skizziert den historischen Kontext von Wittgensteins Spätphilosophie. Es hebt die Abkehr von seinem frühen Werk, dem „Tractatus“, hervor und definiert den Fokus der Analyse auf zentrale Aspekte seiner Spätphase.
- Die Übergangszeit: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung von Wittgensteins Gedanken in der Zeit zwischen dem „Tractatus“ und seinen späteren Werken. Es beschreibt seine Auseinandersetzung mit dem Wiener Kreis, seine Rückkehr nach Cambridge und die Entstehung wichtiger Schriften, die den Weg zu seiner Spätphilosophie ebneten.
Schlüsselwörter
Wittgensteins Spätphilosophie, Sprachtheorie, Regelbefolgung, „Philosophische Untersuchungen“, Familienähnlichkeit, Sprachspiel, Bedeutung als Gebrauch, „Philosophische Psychologie“, „Geistige Prozesse“, Wissen, Verstehen, Tractatus logico-philosophicus
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Merkmale von Wittgensteins Spätphilosophie?
Die Spätphilosophie, vor allem in den "Philosophischen Untersuchungen" dargelegt, zeichnet sich durch die Abkehr von einer rein logischen Abbildtheorie der Sprache hin zu einer Betrachtung der Sprache als Gebrauch und sozialen Praxis (Sprachspiele) aus.
Was bedeutet der Begriff "Sprachspiel"?
Ein Sprachspiel beschreibt die Einheit aus Sprache und den Handlungen, mit denen sie verwoben ist. Es verdeutlicht, dass die Bedeutung eines Wortes durch seine Verwendung in einem bestimmten Kontext entsteht.
Wie unterscheidet sich das Spätwerk vom "Tractatus logico-philosophicus"?
Während der Tractatus die Logik als das Wesen der Sprache sieht, betont das Spätwerk die Vielfalt und Flexibilität der Sprache im Alltag und kritisiert die Suche nach einer universellen logischen Struktur.
Was versteht Wittgenstein unter "Regelbefolgung"?
Regelbefolgung ist für Wittgenstein eine soziale Praxis. Eine Regel zu befolgen bedeutet nicht, eine private Interpretation zu haben, sondern in einer Weise zu handeln, die innerhalb einer Gemeinschaft als korrekt anerkannt wird.
Was ist die "philosophische Psychologie" bei Wittgenstein?
Es handelt sich um eine Untersuchung psychologischer Begriffe (wie Verstehen, Wissen oder Meinen), bei der Wittgenstein zeigt, dass diese keine inneren geistigen Prozesse beschreiben, sondern durch äußere Kriterien und Sprachgebrauch definiert sind.
- Quote paper
- Natalia Ryan (Author), 2013, Wittgensteins Spätphilosophie. Sprache in den "Philosophischen Untersuchungen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339365