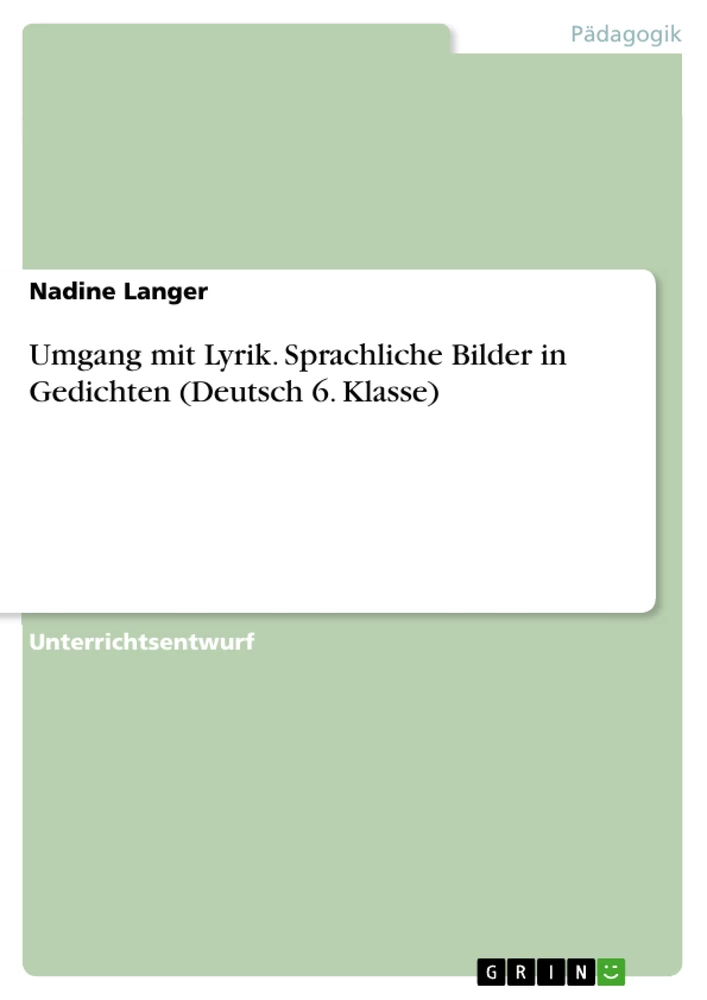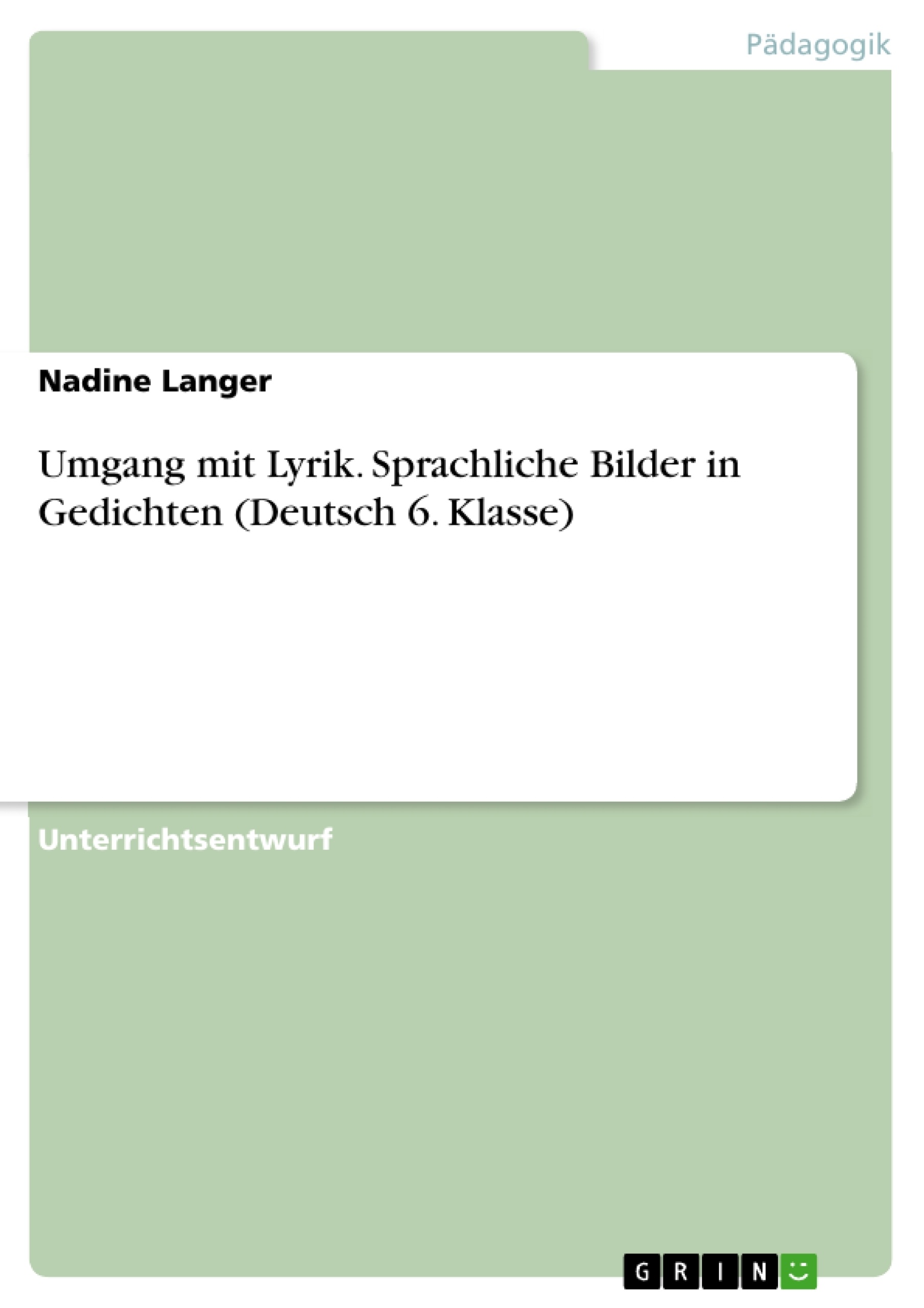In der Unterrichtsstunde zum Thema „sprachliche Bilder“ lernen die Kinder stilistische Mittel im Bereich der Lyrik kennen. Sie sollen ein Bild beschreiben und darüber hinaus sprachliche Bezüge erfassen können. Die Schülerinnen und Schüler lernen drei sprachliche Bilder (Metapher, Vergleich, Personifikation) kennen und können diese unterschiedlichen Beispielen zuordnen beziehungsweise sie in einem Gedicht erkennen und erklären. Sie sollen die Fähigkeit erwerben die Bedeutung der sprachlichen Bilder aktiv zu reflektieren und sie anschließend in kreativer Eigenarbeit künstlerisch-visuell wiederzugeben. Dabei wird neben Lesen und Schreiben auch der aktive und intensive Umgang mit Texten gefördert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Bedingungsanalyse
- 2. Sachanalyse
- 3. Didaktische Analyse
- 4. Methodische Analyse
- 5. Tabellarischer Unterrichtsverlaufsplan
- 6. Reflexion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert eine Unterrichtsstunde zum Thema „sprachliche Bilder“ im Deutschunterricht der sechsten Klasse. Ziel ist es, die didaktische und methodische Gestaltung der Stunde zu untersuchen und zu bewerten. Die Analyse umfasst die Lernbedingungen, den fachlichen Kontext, die didaktische Konzeption und die eingesetzten Methoden.
- Analyse der Lernbedingungen der sechsten Klasse
- Fachliche Einordnung sprachlicher Bilder in der Lyrik
- Didaktische Planung und Umsetzung der Unterrichtsstunde
- Methodische Auswahl und Reflexion der eingesetzten Verfahren
- Bewertung der Kompetenzentwicklung der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Bedingungsanalyse: Die Bedingungsanalyse beschreibt die Lerngruppe (26 Schüler, davon 16 Jungen und 10 Mädchen, inklusive Schüler mit LRS und Förderbedarf), den Klassenraum (parlamentarische Bestuhlung, Tafel, Leinwand, ansprechende Gestaltung) und das Arbeitsverhalten der Schüler (zunächst einseitig, aber durch Lehrerintervention ausgeglichen). Es wird ein respektvolles und freundliches Lehrer-Schüler-Verhältnis hervorgehoben, und etablierte Unterrichtsrituale werden beschrieben. Diese Rahmenbedingungen bilden die Basis für die Analyse der darauffolgenden Unterrichtsstunde.
2. Sachanalyse: Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung und Funktion sprachlicher Bilder (Metapher, Vergleich, Personifikation) in der Lyrik. Er erklärt, wie diese Mittel die Vielfältigkeit der Sprache verdeutlichen und die Bedeutungsebenen von Wörtern erweitern. Die Analyse veranschaulicht den Unterschied zwischen Vergleich und Metapher, indem sie auf die Verwendung von Vergleichspartikeln und die Übertragung von Eigenschaften eingeht. Konkrete Beispiele illustrieren die Wirkung der jeweiligen rhetorischen Mittel.
3. Didaktische Analyse: Die didaktische Analyse bezieht sich auf den Rahmenplan von Mecklenburg-Vorpommern für Deutsch in den Klassen 5 und 6. Sie zeigt auf, wie die Unterrichtsstunde zum Thema „sprachliche Bilder“ zur Kompetenzentwicklung der Schüler im Bereich der Literatur und des Sprachverständnisses beiträgt. Die Stunde zielt auf die Erkennung und Anwendung von Metapher, Vergleich und Personifikation ab, wobei die Verknüpfung von Text und Bild die aktive Reflexion und kreative Umsetzung der gelernten Inhalte fördert. Der Bezug zum schulischen Gesamtkonzept und zur Kompetenzentwicklung in der Sekundarstufe wird hergestellt.
4. Methodische Analyse: Die methodische Analyse beschreibt den Ablauf der Unterrichtsstunde detailliert. Es werden die vorbereiteten Materialien (Moderationskarten, Plakate, Folien) und die eingesetzten Methoden (Gruppenarbeit, Einzelarbeit, spielerische Übungen) erläutert. Der methodische Ablauf umfasst eine Wiederholung, eine Einführung in das Thema durch Bildbetrachtung und anschließende Erarbeitung der sprachlichen Bilder. Die Methoden zielen auf eine aktive Beteiligung der Schüler und eine spielerische Festigung des Gelernten ab. Die Analyse zeigt, wie die Lehrkraft die Schüler zum selbstständigen Denken und Arbeiten anregt.
Schlüsselwörter
Sprachliche Bilder, Lyrik, Metapher, Vergleich, Personifikation, Didaktische Analyse, Methodische Analyse, Kompetenzentwicklung, Deutschunterricht, Muttersprachlicher Unterricht, Lese- und Schreibkompetenz, Schüleraktivität.
Häufig gestellte Fragen zur Unterrichtsanalyse "Sprachliche Bilder"
Was ist der Gegenstand dieser Unterrichtsanalyse?
Die Analyse beschreibt und bewertet eine Unterrichtsstunde zum Thema „sprachliche Bilder“ im Deutschunterricht der sechsten Klasse. Sie untersucht die didaktische und methodische Gestaltung der Stunde und deren Auswirkungen auf die Kompetenzentwicklung der Schüler.
Welche Aspekte werden in der Analyse untersucht?
Die Analyse umfasst verschiedene Aspekte: die Lernbedingungen der Klasse (Bedingungsanalyse), den fachlichen Hintergrund sprachlicher Bilder in der Lyrik (Sachanalyse), die didaktische Planung und Umsetzung der Stunde (Didaktische Analyse), die eingesetzten Methoden und deren Ablauf (Methodische Analyse), sowie eine Reflexion des Unterrichtsverlaufs.
Welche sprachlichen Bilder werden behandelt?
Die Unterrichtsstunde konzentriert sich auf die drei wichtigsten Arten sprachlicher Bilder: Metapher, Vergleich und Personifikation. Die Analyse erklärt die jeweilige Funktion und Wirkung dieser Mittel in der Lyrik anhand von Beispielen.
Wie ist die Lerngruppe beschaffen?
Die Lerngruppe besteht aus 26 Schülern (16 Jungen, 10 Mädchen), darunter Schüler mit Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) und Förderbedarf. Der Klassenraum ist gut ausgestattet und das Lehrer-Schüler-Verhältnis wird als respektvoll und freundlich beschrieben.
Welche Methoden wurden im Unterricht eingesetzt?
Die Unterrichtsstunde verwendet diverse Methoden, darunter Gruppenarbeit, Einzelarbeit und spielerische Übungen. Es wurden vorbereitete Materialien wie Moderationskarten, Plakate und Folien eingesetzt, um die Schüler aktiv am Unterricht beteiligen und das Gelernte spielerisch zu festigen.
Wie wird die didaktische Planung bewertet?
Die didaktische Planung orientiert sich am Rahmenplan von Mecklenburg-Vorpommern für Deutsch in den Klassen 5 und 6. Die Analyse zeigt auf, wie die Stunde zur Kompetenzentwicklung der Schüler im Bereich Literatur und Sprachverständnis beiträgt. Der Fokus liegt auf der Erkennung und Anwendung der behandelten sprachlichen Bilder.
Welche Kapitel umfasst die Analyse?
Die Analyse gliedert sich in sechs Kapitel: 1. Bedingungsanalyse, 2. Sachanalyse, 3. Didaktische Analyse, 4. Methodische Analyse, 5. Tabellarischer Unterrichtsverlaufsplan (nicht im Detail hier dargestellt) und 6. Reflexion (ebenfalls nicht im Detail hier dargestellt).
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Analyse?
Schlüsselwörter sind: Sprachliche Bilder, Lyrik, Metapher, Vergleich, Personifikation, Didaktische Analyse, Methodische Analyse, Kompetenzentwicklung, Deutschunterricht, Muttersprachlicher Unterricht, Lese- und Schreibkompetenz, Schüleraktivität.
Wo finde ich den detaillierten Unterrichtsverlaufsplan und die Reflexion?
Der detaillierte Unterrichtsverlaufsplan und die Reflexion sind Bestandteil der vollständigen Analyse, aber in diesem Auszug nicht enthalten.
Für wen ist diese Analyse bestimmt?
Diese Analyse ist für den akademischen Gebrauch bestimmt, z.B. zur Analyse von Unterrichtsmethoden und zur Erforschung von didaktischen Konzepten im Deutschunterricht.
- Quote paper
- Nadine Langer (Author), 2016, Umgang mit Lyrik. Sprachliche Bilder in Gedichten (Deutsch 6. Klasse), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339410