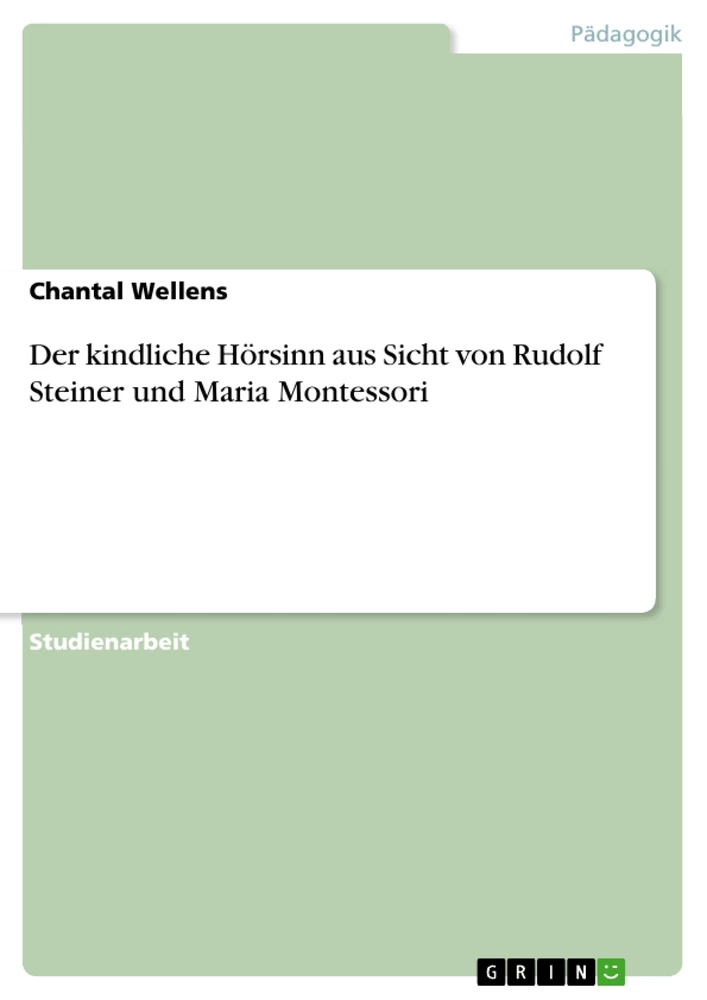Der Gehörsinn ist einer der wichtigsten Sinne eines Kindes. Dieser Text befasst sich mit dem kindlichen Gehör und der Forschung Rudolf Steiners und Maria Montessoris, die sich mit diesem Thema intensiv befasst und in ihre Pädagogik integriert haben.
Die Entwicklung eines Kindes vollzieht sich rasant. Eltern und soziale Umwelt unterstützen das Kind bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse und gehen auf die Verhaltensweisen des Kindes ein. Für die Entwicklung der Sinne gibt es keine starren Normen. Bei gesunden Kindern können die Eltern auf den individuellen Entwicklungsplan vertrauen. Seine Umwelt lernt es durch Sehen, Hören, Tasten, Riechen und Schmecken kennen.
Durch Bewegung und Experimentieren mit dem eigenen Körper macht es wichtige Erfahrungen. Das Kind muss im wahrsten Sinne begreifen: z.B. durch Anfassen und Probieren. Alles wird befühlt, in den Mund genommen, geschüttelt, zerrissen und geworfen. Die Schnelligkeit unserer modernen Wohlstandsgesellschaft und ein entsprechender Lebensstil lässt den Kindern kaum noch die Möglichkeit, die Welt mit allen Sinnen zu erfassen. Ein deviantes Verhalten ist im Kindergartenalltag immer mehr zu beobachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Sinnesentwicklung nach Rudolf Steiner
- Die Sinnesentwicklung nach Maria Montessori
- Entwicklung des Gehörsinnes des Kindes während der pränatalen Phase
- Entwicklung des Gehörsinnes des Kindes nach der Geburt
- Der physiologische Vorgang des Hörens (auditiver Sinn)
- Fehlentwicklungen und psychosomatische Hörblockaden
- Bedeutung des Hörsinns in der pädagogischen Praxis
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Bedeutung des Gehörsinnes in der Entwicklung des Kindes. Sie analysiert die Sinnesentwicklung aus der Perspektive von Rudolf Steiner und Maria Montessori und beleuchtet die Entwicklung des Gehörsinnes während der pränatalen und postnatalen Phase. Darüber hinaus werden physiologische Aspekte des Hörens, mögliche Fehlentwicklungen und der Einfluss des Hörsinns auf die pädagogische Praxis untersucht.
- Die Sinnesentwicklung nach Rudolf Steiner und Maria Montessori
- Die Entwicklung des Gehörsinnes während der pränatalen und postnatalen Phase
- Der physiologische Vorgang des Hörens
- Fehlentwicklungen und psychosomatische Hörblockaden
- Die Bedeutung des Hörsinns in der pädagogischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Sinnesentwicklung und insbesondere des Gehörsinnes ein. Sie beleuchtet die Bedeutung der Sinne für die kindliche Entwicklung und stellt die Problematik der Reizüberflutung in der heutigen Zeit dar.
- Die Sinnesentwicklung nach Rudolf Steiner: Dieses Kapitel stellt die Lehre von Rudolf Steiner zur Sinnesentwicklung vor. Es beschreibt die zwölf Sinne des Menschen nach Steiner und die besondere Bedeutung des Gehörsinnes in dieser Lehre.
- Die Sinnesentwicklung nach Maria Montessori: Dieses Kapitel widmet sich der Sinneserziehung nach Maria Montessori. Es beschreibt Montessoris Ansatz zur Sinnesentwicklung und die Bedeutung von Sinnesmaterial für das kindliche Lernen.
- Entwicklung des Gehörsinnes des Kindes während der pränatalen Phase: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung des Gehörsinnes des Kindes im Mutterleib. Es erläutert, ab wann der Fötus Geräusche wahrnehmen kann und welche Geräusche er im Mutterleib hört.
Schlüsselwörter
Sinnesentwicklung, Gehörsinn, Rudolf Steiner, Maria Montessori, pränatale Phase, postnatale Phase, physiologisches Hören, Fehlentwicklungen, Hörblockaden, pädagogische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Wie betrachten Rudolf Steiner und Maria Montessori die Sinnesentwicklung?
Beide Pädagogen sehen die Sinne als Schlüssel zur Welt. Steiner betont zwölf Sinne und deren spirituelle Komponente, während Montessori die gezielte Schulung der Sinne durch spezielles Material fokussiert.
Wann beginnt die Entwicklung des Gehörsinns beim Kind?
Die Entwicklung beginnt bereits in der pränatalen Phase; der Fötus kann schon im Mutterleib Geräusche der Umgebung und die Stimme der Mutter wahrnehmen.
Was sind psychosomatische Hörblockaden bei Kindern?
Dabei handelt es sich um Störungen der Hörverarbeitung, die nicht organisch, sondern durch psychische Belastungen oder eine Reizüberflutung in der Umwelt bedingt sind.
Welche Bedeutung hat das Hören für die pädagogische Praxis?
Ein gut ausgebildeter Hörsinn ist die Basis für den Spracherwerb und die soziale Interaktion. Pädagogen müssen Umgebungen schaffen, die bewusstes Hören ohne Lärmbelastung ermöglichen.
Wie beeinflusst die moderne Wohlstandsgesellschaft die kindliche Wahrnehmung?
Durch Schnelligkeit und permanente mediale Beschallung haben Kinder oft weniger Möglichkeiten, die Welt in Ruhe mit allen Sinnen zu "begreifen", was zu deviantem Verhalten führen kann.
- Quote paper
- Chantal Wellens (Author), 2015, Der kindliche Hörsinn aus Sicht von Rudolf Steiner und Maria Montessori, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339499