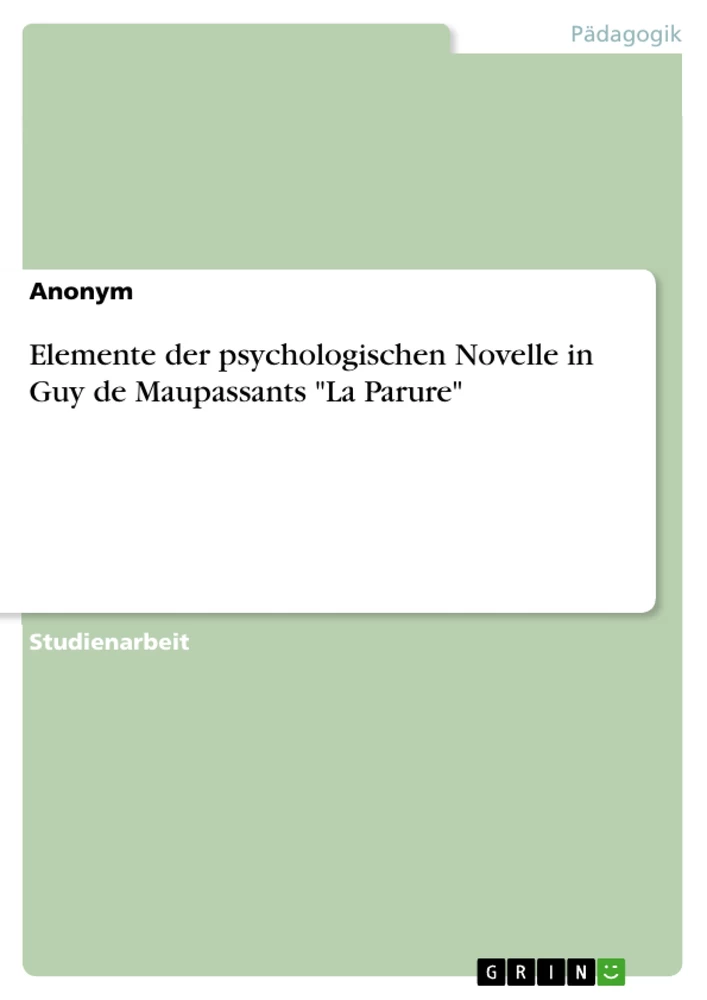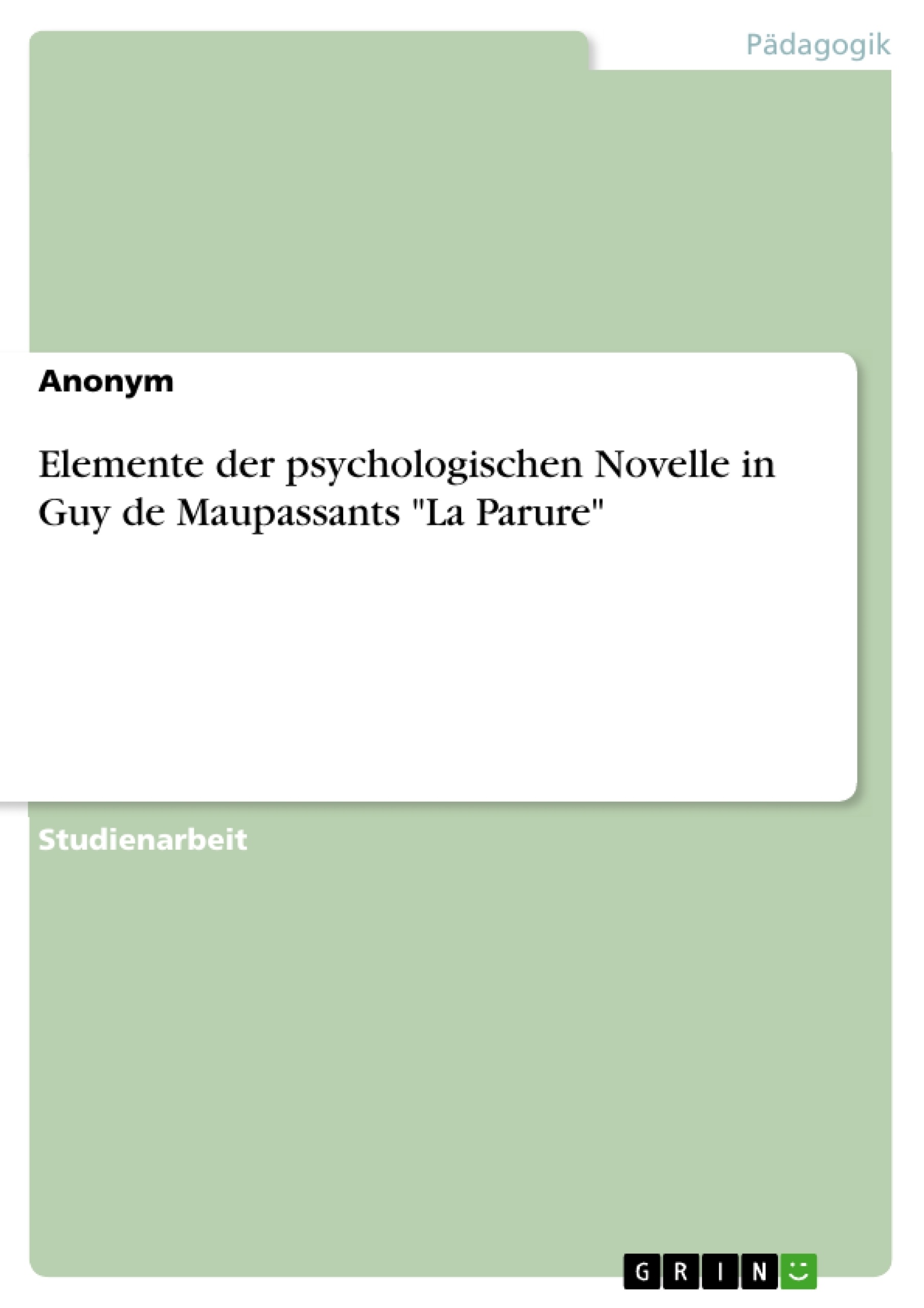Guy de Maupassant gilt als größter Meister der Novellen des 19. Jahrhunderts. Seine mehr als 300 Novellen, die er in nur zehn Jahren verfasste, wurden zunächst in Frankreich und danach in der ganzen Welt bekannt. Eines seiner Werke, die psychologische Novelle „La Parure“, die 1884 in der Zeitung ‚Le Gaulois‘ erschienen ist und einen großen Erfolg verzeichnete, ist das Thema der vorliegenden Arbeit.
Mathilde Loisel lebt mit ihrem Ehemann ein durchschnittliches Leben des niedrigen Bürgertums, träumt aber von einem Leben in der haute bourgeoisie. Für einen Ballabend leiht sie sich von einer reichen Freundin eine vermeintlich wertvolle Halskette, die sie während der Festivität verliert. Um der Freundin den Verlust nicht beichten zu müssen, kauft das Ehepaar Loisel ein neues Schmuckstück, für das es sich hoch verschulden und zehn Jahre lang ein Leben in Armut führen muss. Erst in der Schlusspointe der Novelle erfahren sie, dass die geliehene Kette keineswegs wertvoll war.
Bevor die Novelle analysiert wird, gehe ich auf die Gattung der Novelle im Allgemeinen ein. Im Anschluss wird eine versuchte Klassifikation der Novellen Maupassants vorgestellt und dabei das Augenmerk auf die psychologische Novelle gelegt. Mit Hilfe der Analyse, die sich schwerpunktmäßig auf die Figuren, die Erzählsituation, die Raumstruktur sowie auf den Zeitaspekt bezieht, sollen die psychologischen Elemente in der Novelle hervorgehoben werden. Zum Schluss soll geklärt werden, ob die Novelle „La Parure“ der reinen Unterhaltung dient oder ob sich in ihr eine tiefere Moral findet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Novelle
- Die Novellen Maupassants – Versuch einer Klassifizierung
- Analyse und Interpretation der Novelle La Parure
- Figuren
- Erzählsituation
- Raumstruktur und Zeit
- Überlegungen zur Moral in La Parure
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht Guy de Maupassants psychologische Novelle "La Parure". Ziel ist es, die psychologischen Elemente der Novelle herauszuarbeiten und zu analysieren, indem die Figuren, die Erzählsituation, die Raumstruktur und der Zeitaspekt beleuchtet werden. Zusätzlich wird die Frage nach der moralischen Aussage der Novelle untersucht.
- Die Gattung der Novelle im 19. Jahrhundert
- Klassifizierung von Maupassants Novellen, insbesondere die psychologische Novelle
- Psychologische Analyse von "La Parure"
- Moralische Implikationen von "La Parure"
- Der Realismus in Maupassants Werk
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt Guy de Maupassant als Meister der Novelle des 19. Jahrhunderts vor. Sie präsentiert "La Parure" als Fallbeispiel und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit, der eine Analyse der Figuren, Erzählsituation, Raumstruktur und Zeit beinhaltet, um die psychologischen Elemente der Novelle herauszuarbeiten. Die Frage nach der moralischen Aussage der Geschichte wird als Forschungsfrage formuliert.
Die Novelle: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Entwicklung des Begriffs "Novelle" im französischsprachigen Raum. Es wird die Entwicklung der Bedeutung von "unerhört" vom außergewöhnlichen Ereignis hin zum Skandalösen im Alltäglichen diskutiert. Die typischen Merkmale der Novelle im 19. Jahrhundert, wie die personale Erzählsituation und die Kürze der Erzählung, werden erörtert. Schließlich wird die Frage nach der Funktion der Novelle, ob moralische Lehre oder reine Unterhaltung, aufgeworfen.
Die Novellen Maupassants - Versuch einer Klassifizierung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Kategorisierung der zahlreichen Novellen Maupassants. Es wird der Ansatz von Blüher vorgestellt, der die Novellen in phantastische, Schauer-, sozialkritische, Schwank- und psychologische Novellen unterteilt. Jeder dieser Typen wird kurz skizziert, wobei auf die jeweilige Thematik und die charakteristischen Merkmale eingegangen wird. Die Einordnung von "La Parure" in dieses Klassifizierungsschema wird vorbereitet.
Schlüsselwörter
Guy de Maupassant, La Parure, psychologische Novelle, Realismus, Erzähltechnik, Figurencharakterisierung, Moral, 19. Jahrhundert, französische Novelle, Gattungspoetik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Guy de Maupassants "La Parure"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Guy de Maupassants psychologische Novelle "La Parure". Der Fokus liegt auf der Herausarbeitung und Analyse der psychologischen Elemente der Novelle, indem die Figuren, die Erzählsituation, die Raumstruktur und der Zeitaspekt beleuchtet werden. Zusätzlich wird die moralische Aussage der Novelle untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Die Gattung der Novelle im 19. Jahrhundert, Klassifizierung von Maupassants Novellen (insbesondere die psychologische Novelle), psychologische Analyse von "La Parure", moralische Implikationen von "La Parure", und der Realismus in Maupassants Werk.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Novelle (Definition und Entwicklung), Die Novellen Maupassants - Versuch einer Klassifizierung, Analyse und Interpretation von "La Parure" (Figuren, Erzählsituation, Raumstruktur und Zeit), und Überlegungen zur Moral in "La Parure".
Wie wird "La Parure" analysiert?
Die Analyse von "La Parure" umfasst eine detaillierte Untersuchung der Figuren, der Erzählsituation (perspektivische Betrachtung), der Raumstruktur und der zeitlichen Abläufe in der Geschichte. Ziel ist es, die psychologischen Aspekte der Handlung und der Charaktere aufzuzeigen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet einen methodischen Ansatz, der eine Analyse der Figuren, Erzählsituation, Raumstruktur und Zeit beinhaltet, um die psychologischen Elemente der Novelle herauszuarbeiten. Die moralische Aussage wird als Forschungsfrage formuliert und im Laufe der Arbeit beantwortet.
Welche Klassifizierung von Maupassants Novellen wird verwendet?
Die Arbeit greift den Ansatz von Blüher auf, der Maupassants Novellen in verschiedene Kategorien unterteilt, darunter phantastische, Schauer-, sozialkritische, Schwank- und psychologische Novellen. "La Parure" wird im Kontext dieser Klassifizierung eingeordnet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Guy de Maupassant, La Parure, psychologische Novelle, Realismus, Erzähltechnik, Figurencharakterisierung, Moral, 19. Jahrhundert, französische Novelle, Gattungspoetik.
Was ist das Fazit der Einleitung?
Die Einleitung führt in das Thema ein, präsentiert "La Parure" als Fallbeispiel und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit. Die moralische Aussage der Geschichte wird als zentrale Forschungsfrage formuliert.
Was wird im Kapitel "Die Novelle" behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Entwicklung des Begriffs "Novelle" im französischsprachigen Raum, diskutiert die Entwicklung der Bedeutung von "unerhört", erörtert typische Merkmale der Novelle im 19. Jahrhundert und stellt die Frage nach der Funktion der Novelle (moralische Lehre oder reine Unterhaltung).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die psychologischen Elemente von "La Parure" herauszuarbeiten und zu analysieren, um ein umfassendes Verständnis der Novelle und ihrer moralischen Implikationen zu erreichen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2014, Elemente der psychologischen Novelle in Guy de Maupassants "La Parure", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339502