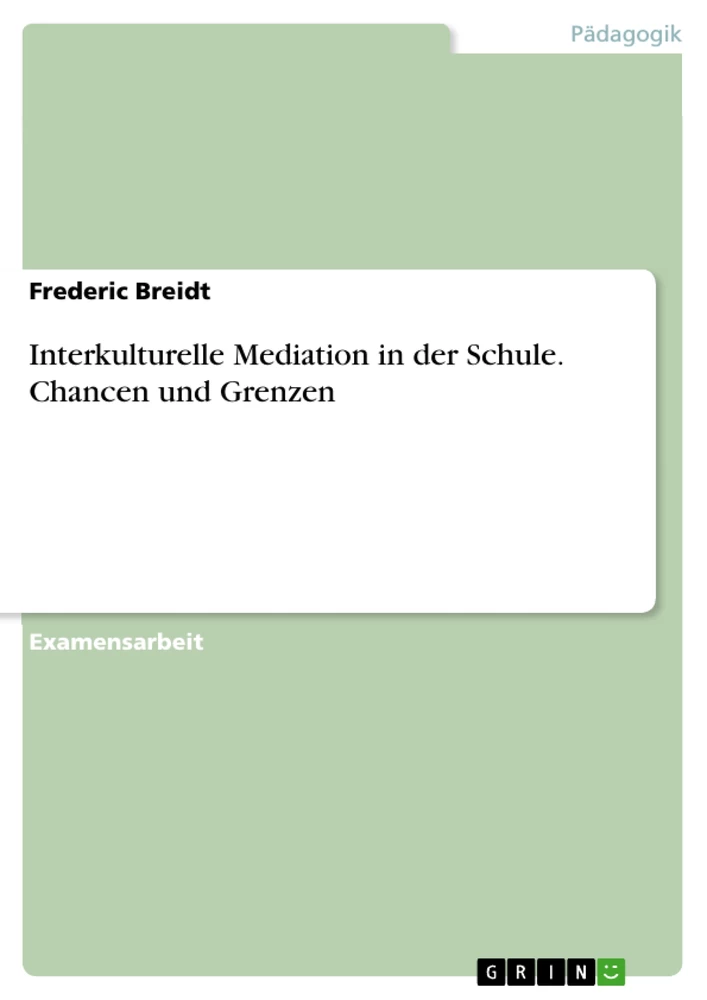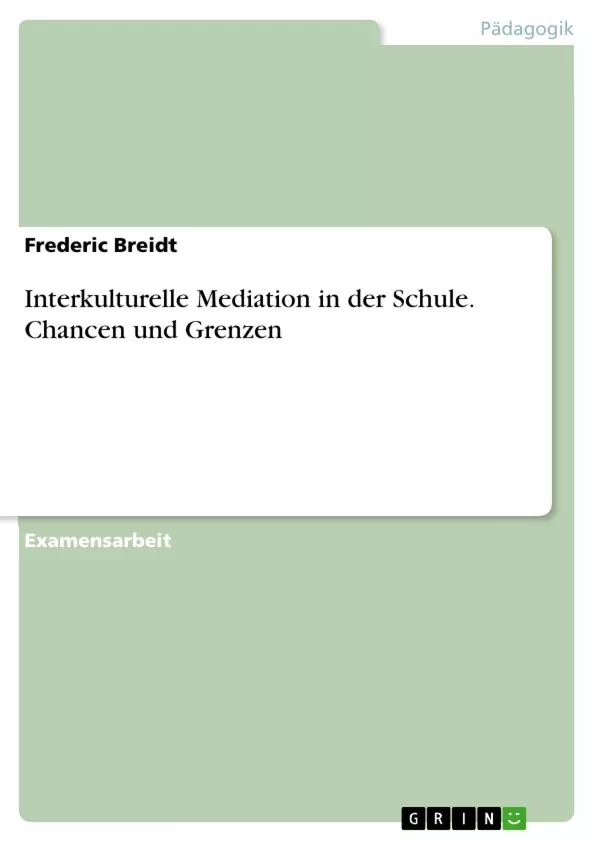Aufgrund des Asylbegehrens (476.649 Asylanträge wurden im Jahre 2015 in Deutschland gestellt) vieler Menschen aus Spannungsgebieten oder aus Ländern mit einem autoritären Regime, muss festgehalten werden, dass der aktuelle Zustrom und dessen Dimension neue Fragen hinsichtlich der Integration aufwerfen. In unserer globalisierten Welt, in welcher schon allein durch die Freizügigkeit der Arbeitnehmer/Innen und Arbeitgeber/Innen ein starker Austausch zwischen unterschiedlichen Kulturen stattfindet, kommt Europa, insbesondere Deutschland, eine besondere Verantwortung zu.
Bedenklich stimmt mich persönlich die gleichzeitige Entwicklung der Zunahme an rechtsextremistisch motivierten (Straf-)Taten, sowie das Emporkommen der rechtspopulistischen Partei AFD, welche in jüngster Vergangenheit durch die Aufnahme von harten Anti-Islam-Thesen in ihr Grundsatzprogramm Aufmerksamkeit erhielt. Der stärker werdende Protest von rechts, die Zunahme an rassistisch motivierten Straftaten, die Wahlerfolge der AFD bei den jüngsten Landtagswahlen sind eindeutige Parameter für eine Besorgnis erregende Entwicklung. Nicht nur die in Deutschland bereits lebende Migranten und die derzeit und auch in Zukunft nach Deutschland flüchtende Mitmenschen sollten besser und effektiver integriert werden, sondern scheinbar auch viele Menschen, die sich rechtsextremen Gedankenguts bedienen. Denn diese zeigen deutlich auf, dass auch sie „integrationsbedürftig“ sind, da zentrale Werte in unserem Bildungssystem scheinbar nicht vermittelt werden konnten. Integration muss also mehr sein als die Assimilation des Fremden, es sollte vielmehr auf die Bereitschaft aller abzielen, sich den Herausforderungen einer stetig verändernden Gesellschaft zu öffnen und die damit erforderlichen Kompetenzen der Teilhabe und Partizipation erwerben zu wollen.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Mediation
- 2.1 Geschichtliche Entwicklung
- 2.2 Bedeutung und Ziele der Mediation
- 2.3 Prinzipien der Mediation
- 2.5 Vergleich der Mediationskonzepte
- 2.5.1 Harvard-Ansatz
- 2.5.2 Der Transformationsansatz
- 3. Theoretische Grundlagen
- 3.1 Kommunikation
- 3.2 Konflikt
- 3.2.1 Das Eskalationsmodell
- 4. Die Bedeutung der Kultur für die interkulturelle Mediation
- 4.1 Kulturbegriff
- 4.2 Die interkulturelle Mediation
- 4.3 Der interkulturelle Konflikt
- 5. Psychosoziale Einflüsse im Umgang mit dem Fremden
- 5.1 Psychosoziale Einflüsse auf Konflikte
- 5.2 Stereotype/Vorurteile
- 5.3 Institutionelle Diskriminierung
- 5.4 Kulturelle Fremdheit als Faszination und Angst
- 5.5 Geschichte der Ausländerpädagogik bis zur Interkulturellen Pädagogik
- 6. Schule als Ort interkultureller Mediation
- 6.1 Interkulturelle Kompetenz
- 6.2 Interkulturelle Kompetenz bei Lehrern/Innen
- 6.3 Forderungen für die Praxis der interkulturellen Mediation
- 7. Interkulturelle Mediation in der Schule - Chancen und Grenzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Herausforderungen interkultureller Mediation im schulischen Kontext vor dem Hintergrund des steigenden Flüchtlingszustroms und des Rechtspopulismus in Deutschland. Ziel ist es, die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Lehrer und Schüler zu beleuchten und präventive Maßnahmen zur Konfliktlösung aufzuzeigen.
- Bedeutung interkultureller Mediation im deutschen Schulsystem
- Herausforderungen und Chancen interkultureller Kommunikation im Schulalltag
- Rollen von interkultureller Kompetenz bei Lehrkräften
- Konfliktprävention und -lösung durch Mediation
- Der Einfluss von kulturellen Unterschieden auf Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Kontext des hohen Flüchtlingszustroms nach Deutschland und den Anstieg rechtsextremer Aktivitäten. Sie verweist auf die Notwendigkeit einer effektiven Integration von Migranten und betont die Bedeutung interkultureller Kompetenz, nicht nur bei den Neuankömmlingen, sondern auch bei der einheimischen Bevölkerung. Persönliche Erfahrungen des Autors in einem Flüchtlingsheim unterstreichen die Notwendigkeit von Hilfestellung und sozialer Verantwortung.
2. Mediation: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die historische Entwicklung, die Bedeutung, die Ziele und die Prinzipien der Mediation. Es vergleicht verschiedene Mediationskonzepte wie den Harvard-Ansatz und den Transformationsansatz, um ein umfassendes Verständnis dieses Konfliktlösungsinstruments zu schaffen. Die Bedeutung der Mediation als Werkzeug zur Bewältigung von Konflikten in multikulturellen Kontexten wird hervorgehoben.
3. Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von Kommunikation und Konflikt. Es beschreibt verschiedene Konfliktmodelle, mit dem Fokus auf dem Eskalationsmodell, welches die Dynamik und Entwicklung von Konflikten erläutert. Diese theoretischen Grundlagen bilden die Basis für das Verständnis der interkulturellen Mediation im späteren Verlauf der Arbeit.
4. Die Bedeutung der Kultur für die interkulturelle Mediation: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem Kulturbegriff und seiner Bedeutung für die interkulturelle Mediation. Es analysiert die Besonderheiten des interkulturellen Konflikts und wie kulturelle Unterschiede die Konfliktentstehung und -lösung beeinflussen. Hier werden wichtige theoretische Konzepte und Beispiele erläutert, die ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen der interkulturellen Kommunikation ermöglichen.
5. Psychosoziale Einflüsse im Umgang mit dem Fremden: Das fünfte Kapitel analysiert psychosoziale Faktoren, die den Umgang mit Fremden beeinflussen, inklusive Stereotypen, Vorurteilen und institutioneller Diskriminierung. Es untersucht kulturelle Fremdheit sowohl als Quelle von Faszination als auch von Angst und beleuchtet die historische Entwicklung der Ausländerpädagogik hin zur interkulturellen Pädagogik. Es werden konkrete Beispiele für diese Einflüsse auf Konflikte und deren Bewältigung gegeben.
6. Schule als Ort interkultureller Mediation: In diesem Kapitel wird die Schule als ein Ort der interkulturellen Mediation betrachtet. Es definiert interkulturelle Kompetenz und beleuchtet deren Bedeutung für Lehrer und Schüler. Es werden konkrete Forderungen für die Praxis der interkulturellen Mediation im Schulalltag formuliert und praktische Ansätze zur Konfliktvermeidung und -lösung vorgestellt.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Mediation, Schule, Integration, Konfliktlösung, Kommunikation, Kultur, Kompetenz, Heterogenität, Rechtspopulismus, Flüchtlinge, Diskriminierung, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Interkulturelle Mediation in der Schule
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen interkultureller Mediation im schulischen Kontext vor dem Hintergrund des steigenden Flüchtlingszustroms und des Rechtspopulismus in Deutschland. Sie beleuchtet die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Lehrer und Schüler und zeigt präventive Maßnahmen zur Konfliktlösung auf.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt eine breite Palette an Themen, darunter die historische Entwicklung und Prinzipien der Mediation, theoretische Grundlagen der Kommunikation und des Konflikts, den Einfluss von Kultur auf interkulturelle Konflikte, psychosoziale Einflüsse im Umgang mit Fremden (Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung), die Rolle der Schule als Ort interkultureller Mediation, die Bedeutung interkultureller Kompetenz für Lehrer und Schüler, und konkrete Forderungen für die Praxis der interkulturellen Mediation in der Schule.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem einzelnen Kapitel?
Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung) beleuchtet den aktuellen Kontext und die Notwendigkeit interkultureller Kompetenz. Kapitel 2 (Mediation) gibt einen Überblick über die Mediation als Konfliktlösungsinstrument. Kapitel 3 (Theoretische Grundlagen) legt die Grundlagen zu Kommunikation und Konflikt. Kapitel 4 (Bedeutung der Kultur) analysiert den Einfluss kultureller Unterschiede auf Konflikte. Kapitel 5 (Psychosoziale Einflüsse) untersucht psychosoziale Faktoren im Umgang mit Fremden. Kapitel 6 (Schule als Ort) betrachtet die Schule als Ort interkultureller Mediation. Kapitel 7 (Chancen und Grenzen) diskutiert Chancen und Grenzen interkultureller Mediation in der Schule.
Welche Mediationskonzepte werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Harvard-Ansatz und den Transformationsansatz der Mediation.
Welche Konfliktmodelle werden behandelt?
Ein Fokus liegt auf dem Eskalationsmodell, welches die Dynamik und Entwicklung von Konflikten erläutert.
Welche Bedeutung hat interkulturelle Kompetenz in dieser Arbeit?
Interkulturelle Kompetenz spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit betont ihre Bedeutung sowohl für Lehrer als auch Schüler zur effektiven Konfliktlösung und Integration von Migranten.
Welche konkreten Forderungen werden für die Praxis formuliert?
Die Arbeit formuliert konkrete Forderungen für die Praxis der interkulturellen Mediation im Schulalltag, mit dem Ziel der Konfliktvermeidung und -lösung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Interkulturelle Mediation, Schule, Integration, Konfliktlösung, Kommunikation, Kultur, Kompetenz, Heterogenität, Rechtspopulismus, Flüchtlinge, Diskriminierung, Prävention.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrer, Pädagogen, Sozialarbeiter, Integrationsbeauftragte und alle, die sich mit interkulturellen Herausforderungen im Bildungsbereich auseinandersetzen.
- Arbeit zitieren
- Frederic Breidt (Autor:in), 2016, Interkulturelle Mediation in der Schule. Chancen und Grenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339536