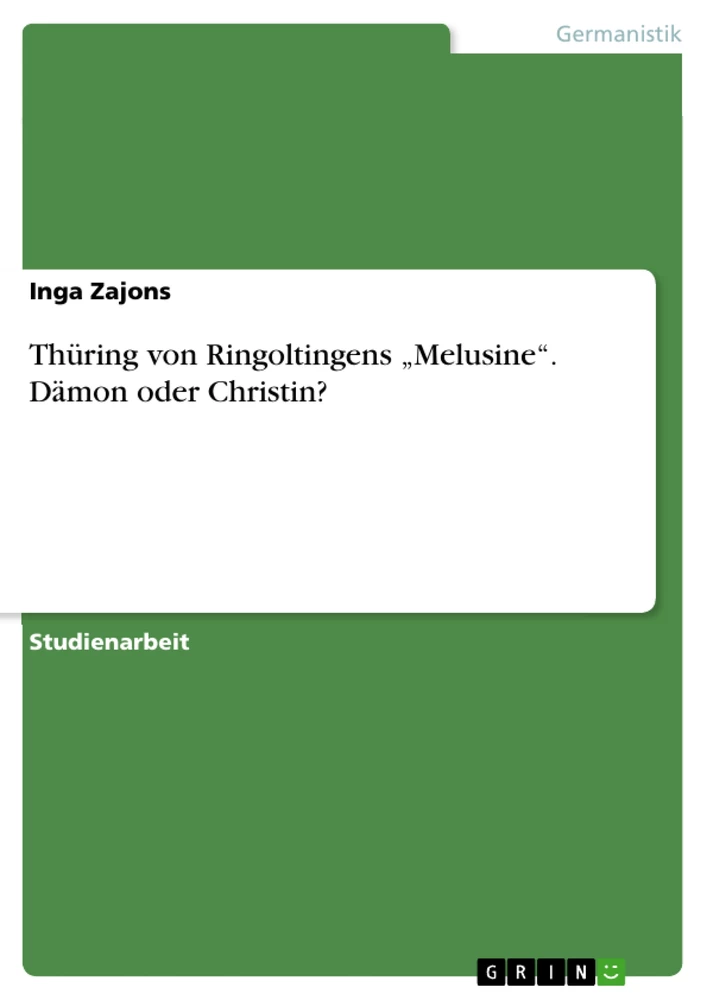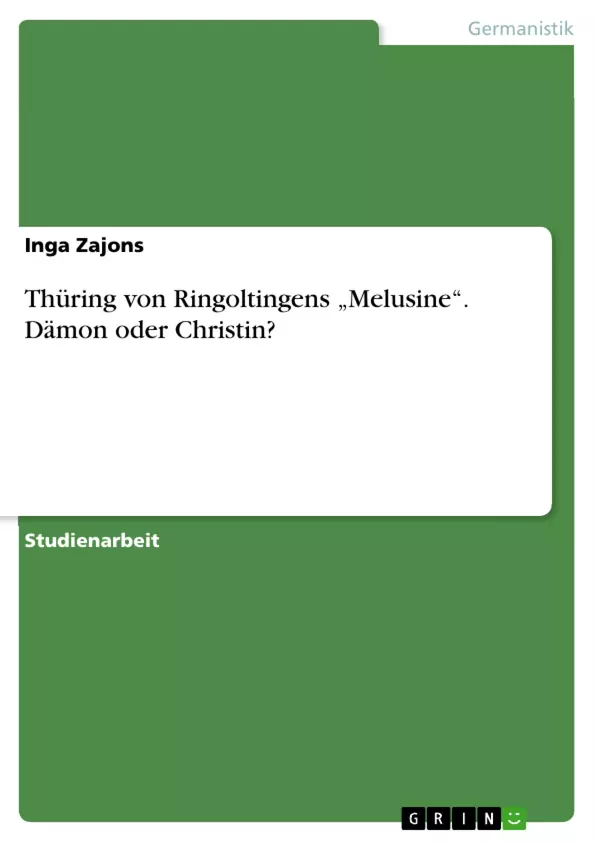Thüring von Ringoltingens „Melusine“ ist eine der berühmtesten mythischen Sagengestalten des Mittelalters. In ihr scheinen sich dämonenhafte und menschliche Wesensmerkmale zu vereinen.
Betrachtet man von Ringoltingens „Melusine“, dann scheint es, als würde sich die Sagengestalt in einem Zwiespalt befinden. So zeigt sie zwar den Drang in der sterblichen Welt leben zu wollen, besitzt jedoch dämonische Wesensmerkmale.
Diese Arbeit wird sich besonders mit dieser Opposition beschäftigen und vor allem der Frage nachgehen, ob man von der Melusine als einen Dämon sprechen muss, oder ob es sich womöglich bei ihr um eine Entdämonisierung aufgrund der Hochzeit mit Reymund handelt.
Um dieser Frage nachgehen zu können, wird zunächst eine allgemeine Einführung der Wasserfrauen und dämonischen Gestalten vorangestellt. Vor diesem Hintergrund werden später Melusines dämonische Wesensmerkmale diskutiert und hinsichtlich ihrer Beziehung zu Reymund als Ehemann und ihren Kindern analysiert werden.
Diese Art der mythischen Erzählung ist keine Seltenheit. Schon bis in die Antike lassen sich vielseitige Erscheinungsformen zurückverfolgen. Seit Jahrtausenden zählt besonders die mythische Wasserfrau zu den rätselhaftesten und geheimnisvollsten Wesen sowohl in der Literatur als auch in der bildenden Kunst. Daran wird deutlich, welche Bedeutungen Mythen schon immer für die Menschen hatten und, dass sie als Grundelement aus dem menschlichen Denken nicht wegzudenken sind. Nach Gabriele Bessler gehört gerade „die mythische Wasserfrau zu den schillerndsten Gestalten. Sie begegnet uns wie eh und je, weicht nicht aus unserem Gedächtnis.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Natur der Wasserfrau
- Melusine als Konstrukt dämonischer und christlicher Attribute
- Ehe als Versuch zur Erlösung
- Melusine und ihre Mutterrolle
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der mythischen Gestalt der Melusine aus Thüring von Ringoltingens gleichnamiger Erzählung. Im Fokus steht die Frage, ob Melusine als ein Dämon zu bezeichnen ist, oder ob ihre dämonischen Wesensmerkmale durch ihre Hochzeit mit Reymund entschärft werden.
- Die Natur der Wasserfrau als mythische Gestalt
- Melusines dämonische Wesensmerkmale und ihre Verbindung zu christlichen Attributen
- Die Ehe als möglicher Weg zur Erlösung von Dämonenhaftigkeit
- Melusines Rolle als Mutter und ihre Auswirkungen auf ihre dämonischen Eigenschaften
- Die Frage nach der Entdämonisierung von Melusine durch ihre Beziehung zu Reymund
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Wasserfrau als mythische Gestalt ein und stellt die Relevanz von Melusines Geschichte in der mittelalterlichen Literatur dar. Sie skizziert die zentralen Fragen, die in der Arbeit behandelt werden, und erläutert den methodischen Ansatz.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Natur der Wasserfrau und analysiert verschiedene Aspekte ihrer mythischen Darstellung, insbesondere im Hinblick auf ihre dämonischen und christlichen Attribute. Die Analyse konzentriert sich dabei auf die Verbindung von Wasser und Weiblichkeit als zentrale Elemente der mythischen Wasserfrau.
Das dritte Kapitel untersucht die Ehe als möglichen Weg zur Erlösung von Melusines dämonischen Eigenschaften. Es analysiert die Bedingungen der Ehe zwischen Melusine und Reymund und diskutiert die Auswirkungen dieser Verbindung auf Melusines Wesen.
Das vierte Kapitel beleuchtet Melusines Rolle als Mutter und untersucht, inwieweit ihre Mutterrolle ihre dämonischen Eigenschaften beeinflusst oder verändert. Es analysiert die Beziehung zwischen Melusine und ihren Kindern und die Auswirkungen ihrer dämonischen Natur auf ihre Familie.
Schlüsselwörter
Wasserfrau, Melusine, Dämon, Christentum, Ehe, Erlösung, Mutterrolle, mythische Gestalt, mittelalterliche Literatur, Geschlechterrollen, Weiblichkeit, Tod, Fruchtbarkeit, Heil, Zerstörung, Unbeherrschbarkeit, Entdämonisierung, Symbolik.
- Quote paper
- Inga Zajons (Author), 2014, Thüring von Ringoltingens „Melusine“. Dämon oder Christin?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339554