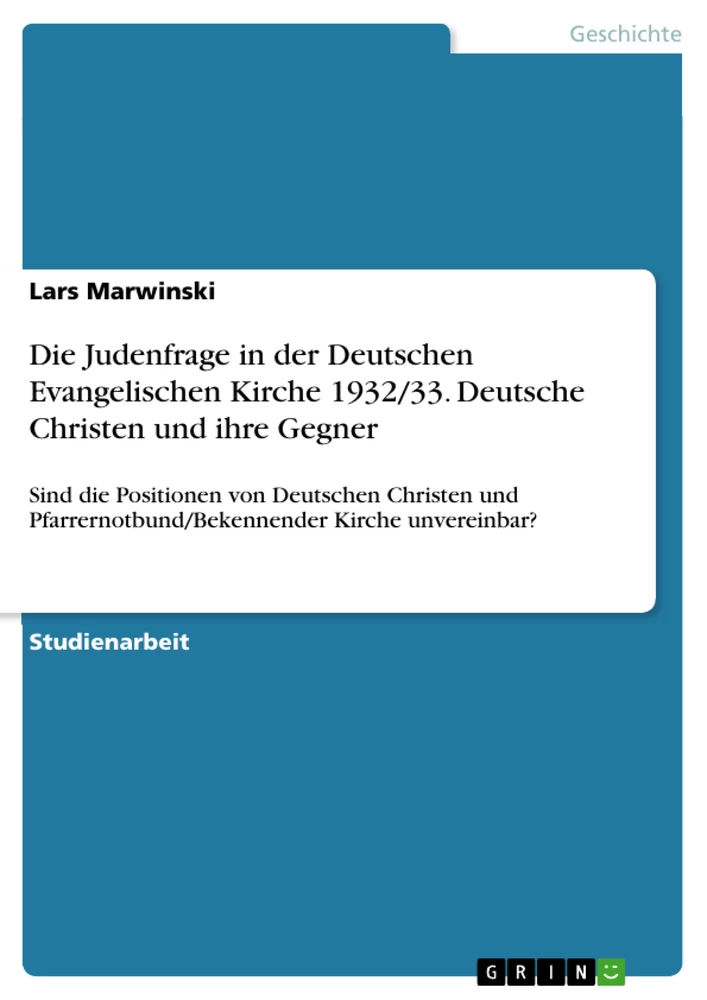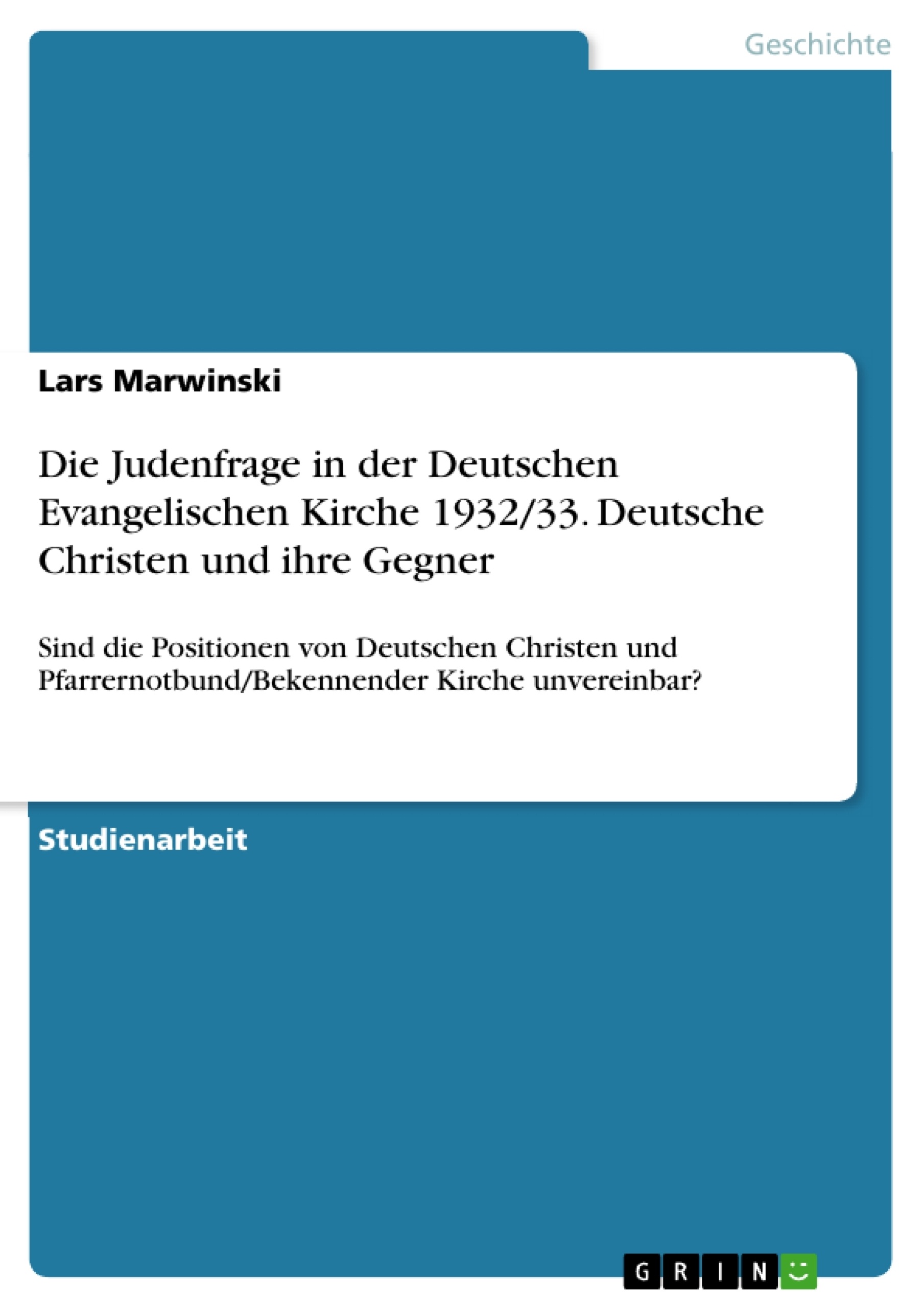Die Zeit des Nationalsozialismus wurde durch die Gleichschaltung eingeläutet. Bekannt ist der Begriff vor allem im Zuge der „Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom Januar 1934 oder der Installation von Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädel im Erziehungssektor. Die Gleichschaltung im Bereich der Religion ist dagegen nicht in Lehrbüchern für Schüler zu finden, zu wenig Einfluss hatten die christlichen Konfessionen auf das Nazi-Regime. Vielmehr tritt das positive Christentum an die Stelle der Kirchen und bildet das Fundament für eine politische Religion, die sich vor allem gegen das jüdische Volk behaupten soll.
Im Jahre 1933 waren von ca. 65,2 Millionen Einwohnern in Deutschland 40,9 Millionen evangelisch und machten fast zwei Drittel des Staates aus. Daher war die NSDAP hinsichtlich der Christenpolitik nicht komplett inaktiv, wie zwei evangelische Kirchenbewegungen beweisen, die im Zuge dieser Arbeit vorgestellt werden. Erstens die anfangs von der NSDAP unterstützten Deutschen Christen, zweitens der Pfarrernotbund bzw. später die Bekennende Kirche. Beide Bewegungen waren auch die Hauptakteure im sogenannten Kirchenkampf.
Dem Begriff Kirchenkampf liegt nicht die eine Definition zugrunde, vielmehr liegt die Gemeinsamkeit seines Ursprungs im Nationalsozialismus und – wie dem Namen zu entnehmen ist – der Kirche. Geht es also um das Verhältnis des NS-Regimes und der Kirche oder um Konflikte innerhalb der evangelischen Kirche in der NS-Zeit? Siegele-Wenschkewitz versucht Antwort zu geben: „Der Kampf um die Kirchen, gegen die Kirchen und in den Kirchen ist entbrannt um die Frage: Sind Nationalsozialismus und Christentum miteinander vereinbar?“
Gemäß der Fragestellung wird die Vorstellung von Kirchenkampf als Konfrontation zwischen Deutschen Christen und der Bekennenden Kirche postuliert, welche das Gerüst des Hausarbeitsthemas darstellt. Es wird ein konkreter Streitpunkt des Kirchenkampfes als Bearbeitungsobjekt gewählt, nämlich die Judenfrage in der evangelischen Kirche. Die Frage, wie mit jüdischstämmigen Bürgern in der evangelischen Kirche verfahren werden soll, gilt als elementarer Konfliktgegenstand zwischen DC und BK.
Diese Hausarbeit spezifiziert sich dabei auf einen abgegrenzten Zeitraum, ab dem 6. Juni 1932 als Gründungsdatum der Glaubensbewegung Deutsche Christen, bis zum Ende des Jahres 1933, nachdem der Arierparagraph, ein wichtiges Gesetz in der Judenpolitik in Deutschland, auch in der Kirche durchgesetzt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Kontext
- Forschungsstand
- Deutsche Christen und Deutsche Evangelische Kirche
- Pfarrernotbund/Bekennende Kirche
- Hauptteil
- Die Deutschen Christen und die Judenfrage
- Kampf gegen den Arierparagraphen
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Auseinandersetzung mit der Judenfrage in der Deutschen Evangelischen Kirche (DEK) zwischen 1932 und 1933. Im Fokus stehen die Positionen der Deutschen Christen (DC) und ihrer Gegner, insbesondere des Pfarrernotbundes, der später zur Bekennenden Kirche (BK) wurde. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ansichten beider Gruppen zu beleuchten und zu analysieren, ob diese unvereinbar waren.
- Die Rolle der Judenfrage im Kirchenkampf
- Die nationalsozialistische Ideologie und ihre Auswirkungen auf die Kirche
- Die Positionen der Deutschen Christen und ihre antisemitische Ausrichtung
- Der Widerstand des Pfarrernotbundes/Bekennenden Kirche gegen die Judenpolitik der DC
- Die Bedeutung des Arierparagraphen für den Kirchenkampf
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik des Kirchenkampfes und die Judenfrage in der DEK im Kontext der nationalsozialistischen Gleichschaltung vor. Der zweite Teil beleuchtet den historischen Kontext, wobei der Forschungsstand, die Entstehung der Deutschen Christen und die Entwicklung des Pfarrernotbundes/Bekennenden Kirche dargestellt werden. Der Hauptteil analysiert die Positionen der Deutschen Christen zur Judenfrage und den Widerstand gegen den Arierparagraphen. Das Fazit fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Kirchenkampf, Deutsche Christen, Pfarrernotbund, Bekennende Kirche, Judenfrage, Arierparagraph, Nationalsozialismus, Gleichschaltung, Antisemitismus, Widerstand, Deutsche Evangelische Kirche, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was war der "Kirchenkampf" im Nationalsozialismus?
Es war der Konflikt innerhalb der evangelischen Kirche zwischen den regimetreuen "Deutschen Christen" und dem Widerstand im "Pfarrernotbund" bzw. der "Bekennenden Kirche".
Was forderte der "Arierparagraph" in der Kirche?
Der Arierparagraph sah vor, Geistliche und Kirchenbeamte jüdischer Herkunft aus ihren Ämtern zu entfernen, was zu heftigem Widerstand führte.
Wer waren die "Deutschen Christen" (DC)?
Eine rassistische und antisemitische Strömung im deutschen Protestantismus, die das Christentum mit der NS-Ideologie in Einklang bringen wollte.
Wie reagierte die Bekennende Kirche auf die Judenfrage?
Sie wehrte sich primär gegen den staatlichen Eingriff in kirchliche Belange und die Ausgrenzung getaufter Juden, wobei die theologische Haltung komplex war.
Welchen Zeitraum deckt die Untersuchung ab?
Die Arbeit konzentriert sich auf die entscheidende Phase zwischen der Gründung der Deutschen Christen im Juni 1932 und dem Ende des Jahres 1933.
- Quote paper
- Lars Marwinski (Author), 2015, Die Judenfrage in der Deutschen Evangelischen Kirche 1932/33. Deutsche Christen und ihre Gegner, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339636