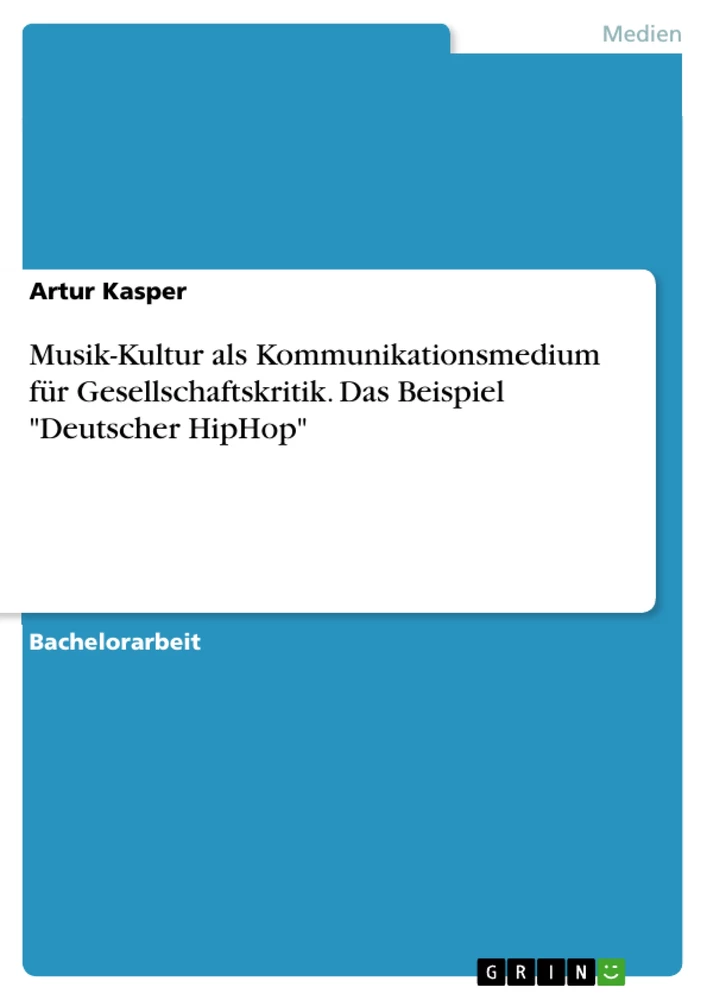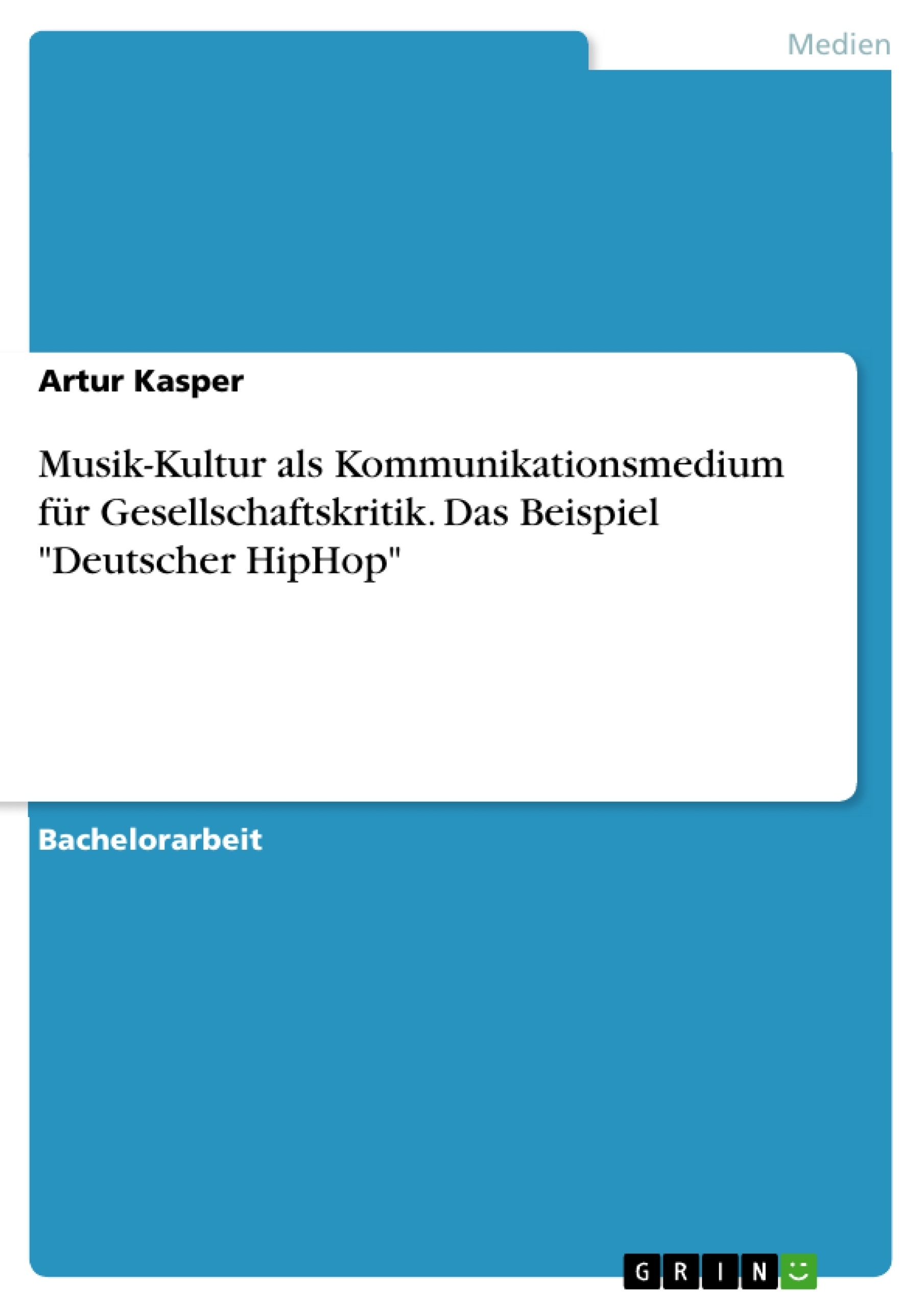Musik gehört seit Anfang der Menschheitsgeschichte zu den gängigsten Begleitern unseres Alltags und wird von Menschen gehört, erlebt und gefühlt. Sie gilt somit als Erfahrungsmedium. Gleichzeitig kann Musik aber auch kommunizieren und ist somit Kommunikationsmedium. Spätestens seit Mitte des 20. Jahrhunderts mit Beginn der Popmusik hat sich eine Popkultur entwickelt, die viel mehr umfasst als nur das Erleben von Musik. Es wurden ganze Lebensgefühle, Einstellungen und (Abgrenzungs)kulturen gebildet.
Musik legt den Grundstein und ist nicht nur Begleitung, sondern aktiver Part inmitten von Bewegungen wie die der 68er, der Hippies oder Punks. Somit sind Musikkulturen von gesellschaftlichen Entwicklungen nicht zu trennen. Musiker können mit ihren Inhalten, Menschen erreichen und bewusst Botschaften transportieren. In dieser Arbeit soll es deshalb um die gesellschaftskritische Relevanz von Musikkultur gehen. Inwiefern fungiert Musikkultur als Kommunikationsmedium für Gesellschaftskritik? Werden durch Popkultur gesellschaftskritische Themen angestoßen und diskutiert?
Neben der gesellschaftskritischen Relevanz von Popkultur allgemein, wird sich die Arbeit auf die Subkultur HipHop in Deutschland spezialisieren. In keinem anderen Musikgenre wird so viel Wert auf den Inhalt und die Texte der Songs gelegt. In den letzten Jahren konnten auch immer mehr Rapper mit explizit politischen und gesellschaftskritischen Inhalten Erfolge in den Charts vorweisen. Die gesellschaftskritische Relevanz von Popkultur allgemein und deutschem HipHop im Speziellen wird somit in dieser Arbeit untersucht. Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob und inwiefern Popkultur und speziell Deutscher HipHop eine gesellschaftskritische Relevanz besitzen. Gleichzeitig erscheint es interessant, zu untersuchen, wie genau Gesellschaftskritik sich äußert und wie diese bei den Rezipienten ankommt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung & Relevanz des Themas
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2. Musik als Kommunikationsmedium
- 2.1 Musiksoziologische Einordnung
- 2.2 Musikverbreitung innerhalb einer Gesellschaft
- 2.3 Asymmetrische Kommunikation
- 2.4 Musiksoziologie und Hörverhalten
- 2.5 Adornos klassische Hörertypologie
- 2.6 Musikerleben innerhalb eines kulturellen Milieus
- 2.7 Musik-Kultur innerhalb verschiedener Gesellschaften
- 3. Pop-Musik und Kulturindustrie
- 3.1 Pop-Musik als Erweiterung der Musik
- 3.2 Einführung in die Kulturindustrie Adornos
- 3.3 Geschichte der Pop-Musik und die zweite Kulturindustrie
- 3.4 Subkulturen und ihre Vereinnahmung durch die Kulturindustrie
- 3.5 Die Subkultur des "Hipsters" - im 20. und 21. Jahrhundert
- 3.6 Pop-Musik und Gesellschaftskritik heute
- 3.7 Zwischenfazit
- 4. Deutscher HipHop und Gesellschaftskritik
- 4.1 Einführung in die Subkultur des HipHop
- 4.2 Geschichte und heutige Relevanz von Deutschem HipHop
- 4.3 HipHop aus kulturwissenschaftlicher Sicht
- 4.4 Sub-Genres im Vergleich: Gangsta-und Politrap
- 4.5 Zusammenfassender Vergleich
- 5. Empirische Untersuchung mittels Experteninterviews
- 5.1 Das leitfadengeführte Experteninterview als Erhebungsmethode
- 5.2 Bestimmung des Ausgangsmaterials
- 5.3 Strukturierung nach Mayring
- 6. Ergebnisse der Experteninterviews
- 6.1 Gesellschaftskritik im deutschen HipHop
- 6.1.1 "Gesellschaftskritische" Rapper
- 6.1.2 Gesellschaftskritische Relevanz von Deutschem HipHop
- 6.1.3 Gangsta-und Politrap
- 6.2 Hörverhalten der Rezipienten
- 6.2.1 Inhalt oder Hörgenuss?
- 6.2.2 Inhaltliche Grenzen
- 6.2.3 Gesellschaftskritischer Rap aus Rezipienten-Sicht
- 6.3 Kulturindustrie und Vereinnahmung im Deutschen HipHop
- 6.3.1 Glaubwürdigkeit gesellschaftskritischer Rapper
- 6.3.2 Gesellschaftskritische Rap-Gruppen in den Charts
- 6.3.3 Vereinnahmung von HipHop als Subkultur
- 6.3.4 Beispiele für Vereinnahmung der HipHop-Kultur
- 6.1 Gesellschaftskritik im deutschen HipHop
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob und inwiefern Pop-Kultur und insbesondere Deutscher HipHop eine gesellschaftskritische Relevanz besitzen. Sie untersucht, wie sich Gesellschaftskritik in der Musik äußert und wie sie von den Rezipienten wahrgenommen wird.
- Musiksoziologische Einordnung von Musik als Kommunikationsmedium
- Analyse der Kulturindustrie und ihrer Auswirkungen auf Pop-Musik
- Untersuchung der Subkultur HipHop in Deutschland und ihrer gesellschaftskritischen Dimensionen
- Analyse der Relevanz von Gangsta- und Politrap im Kontext der Gesellschaftskritik
- Empirische Untersuchung mittels Experteninterviews zur Rezeption von gesellschaftskritischem HipHop
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer musiksoziologischen Einordnung von Musik als Kommunikationsmedium. Sie beleuchtet die Verbreitung von Musik in der Gesellschaft und die verschiedenen Arten von Hörverhalten. Anschließend wird die Pop-Kultur ab der Nachkriegszeit betrachtet, wobei die Kulturindustrie Adornos und die Vereinnahmung von Subkulturen durch diese untersucht werden. Die Subkultur des "Hipsters" wird im 20. und 21. Jahrhundert beleuchtet. Im vierten Kapitel wird der Fokus auf die Subkultur "Deutscher HipHop" gelegt, wobei die Geschichte und heutige Relevanz des Genres sowie die verschiedenen Sub-Genres wie Gangsta- und Politrap untersucht werden. Die Arbeit enthält auch eine empirische Untersuchung mittels Experteninterviews, die Aufschluss über die Rezeption von gesellschaftskritischem HipHop geben soll. Die Ergebnisse der Experteninterviews werden im sechsten Kapitel vorgestellt, wobei die Relevanz von gesellschaftskritischem HipHop, das Hörverhalten der Rezipienten sowie die Vereinnahmung durch die Kulturindustrie beleuchtet werden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Pop-Kultur, Deutscher HipHop, Gesellschaftskritik, Kulturindustrie, Subkulturen, Gangsta- und Politrap, Rezeption, Experteninterviews.
- Citation du texte
- Artur Kasper (Auteur), 2016, Musik-Kultur als Kommunikationsmedium für Gesellschaftskritik. Das Beispiel "Deutscher HipHop", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339666