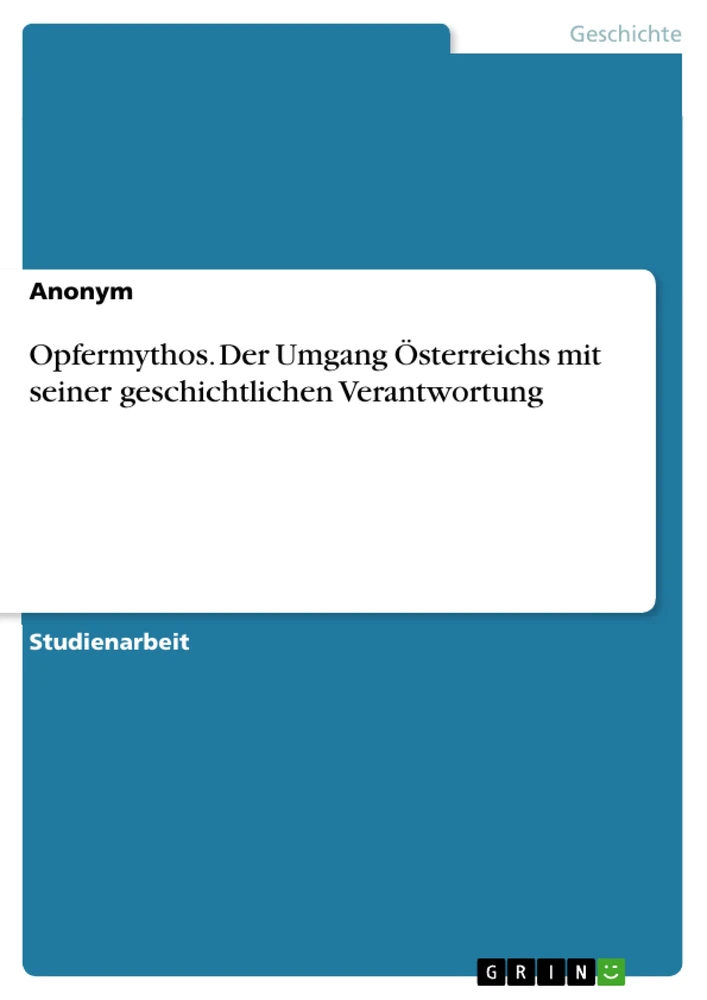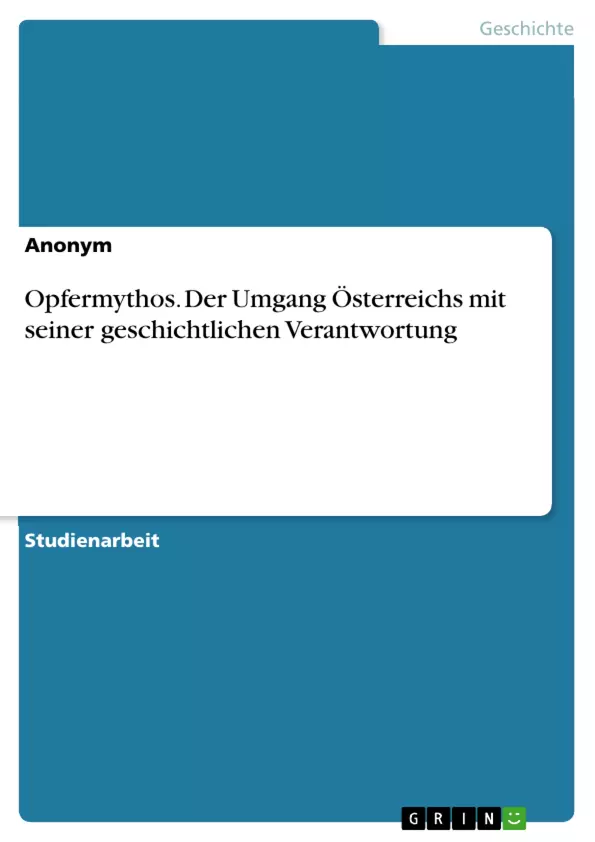Die Ausgangsbasis dieser Arbeit stellen die Ereignisse rund um den 13. März 1938 dar. Am 13. März 1938 erfolgte der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Seither steht der Begriff „Anschluss“ in Österreich im Zentrum angeregter Diskussionen. Zum einen erörtern diese Diskussionen die Frage einer etwaigen Mitschuld Österreichs an den Verbrechen des nationalsozialistischen Regimes. Zum anderen stellen diese Diskussionen aber auch die Unschuld Österreichs an diesen schrecklichen Ereignissen dar. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch nicht mit der Klärung dieser Fragen, sondern analysiert lediglich den Umgang Österreichs in Bezug auf seine geschichtliche Verantwortung. Dabei steht im Rahmen dieser Arbeit vor allem die Beantwortung der folgenden Forschungsfrage im Vordergrund.
Welches Rollenbild konstruieren österreichische Schulbücher in Bezug auf die österreichische Beteiligung am zweiten Weltkrieg beziehungsweise an den Verbrechen des deutschen Hitlerregimes?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Forschungsfrage
- DER ANSCHLUSS
- Annexionstheorie
- Okkupationstheorie
- KONSTRUKTION VON GESCHICHTE
- Die Moskauer Deklaration
- Die Wannsee Protokolle
- Die Waldheim Affäre
- Der Umgang mit Gedenkstätten
- SCHULBUCHANALYSE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert den Umgang Österreichs mit seiner geschichtlichen Verantwortung im Kontext des Zweiten Weltkriegs. Im Zentrum steht die Frage, wie österreichische Schulbücher das Rollenbild Österreichs in Bezug auf die Beteiligung am Krieg und den Verbrechen des NS-Regimes konstruieren.
- Der Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich und seine unterschiedlichen Interpretationen
- Die Konstruktion von Geschichte im Kontext des Opfermythos
- Die Rolle österreichischer Schulbücher in der Vermittlung der NS-Vergangenheit
- Der Umgang Österreichs mit Gedenkstätten und der Erinnerungskultur
- Die Bedeutung von historischen Ereignissen und Persönlichkeiten wie der Moskauer Deklaration, den Wannsee-Protokollen und Kurt Waldheim
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit stellt die Ereignisse rund um den 13. März 1938 und die daraus resultierenden Debatten über die österreichische Mitschuld an den NS-Verbrechen in den Vordergrund. Sie führt die Forschungsfrage ein, welche Rolle österreichische Schulbücher in der Konstruktion des österreichischen Rollenbildes im Zweiten Weltkrieg spielen.
Das Kapitel „Der Anschluss“ betrachtet die Annexion Österreichs aus zwei Perspektiven: die Annexionstheorie, die von einem völkerrechtlichen Untergang Österreichs ausgeht, und die Okkupationstheorie, die den Anschluss als völkerrechtswidrige Besetzung betrachtet. Die Argumente beider Theorien werden diskutiert, wobei der Fokus auf die Bedeutung der historischen und gesellschaftlichen Kontextualisierung des Anschlusses liegt.
Das Kapitel „Konstruktion von Geschichte“ befasst sich mit der Frage, wie die NS-Vergangenheit in Österreich aufgearbeitet wird und welches Bild den folgenden Generationen vermittelt wird. Es analysiert die Bedeutung der Moskauer Deklaration, die Österreich als Opfer des NS-Regimes bezeichnet, und stellt die Frage, wie die Rolle österreichischer Täter in der Erinnerungskultur Berücksichtigung findet. Die Kapitel über die Wannsee-Protokolle, die Waldheim Affäre und den Umgang mit Gedenkstätten liefern weitere Einblicke in die Konstruktion von Geschichte und das Bewusstsein für die österreichische Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Opfermythos, Anschluss Österreichs, NS-Verbrechen, Schulbuchanalyse, Erinnerungskultur, Moskauer Deklaration, Wannsee-Protokolle, Kurt Waldheim, Geschichtskonstruktion und österreichische Verantwortung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der „Opfermythos“ in Österreich?
Der Opfermythos beschreibt die jahrzehntelange Darstellung Österreichs als „erstes Opfer“ Hitlers, wodurch die eigene Mitschuld am Nationalsozialismus in den Hintergrund rückte.
Welche Rolle spielen Schulbücher bei der Geschichtskonstruktion?
Schulbücher prägen das Rollenbild künftiger Generationen; die Arbeit untersucht, wie sie die Beteiligung Österreichs am Zweiten Weltkrieg und an NS-Verbrechen darstellen.
Was unterscheidet die Annexionstheorie von der Okkupationstheorie?
Die Annexionstheorie geht vom völkerrechtlichen Untergang Österreichs 1938 aus, während die Okkupationstheorie den Anschluss als illegale Besetzung betrachtet.
Was war die Waldheim-Affäre?
Die Affäre um den ehemaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim in den 1980er Jahren löste eine internationale Debatte über dessen verschwiegene NS-Vergangenheit und Österreichs Umgang mit der Geschichte aus.
Welche Bedeutung hat die Moskauer Deklaration von 1943?
In dieser Deklaration bezeichneten die Alliierten Österreich als erstes Opfer der Aggression Hitlers, was die Grundlage für den späteren Opfermythos bildete.
Wie geht Österreich heute mit Gedenkstätten um?
Die Arbeit analysiert den Wandel in der Erinnerungskultur und wie Gedenkstätten zur Aufarbeitung der geschichtlichen Verantwortung beitragen.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2012, Opfermythos. Der Umgang Österreichs mit seiner geschichtlichen Verantwortung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339749