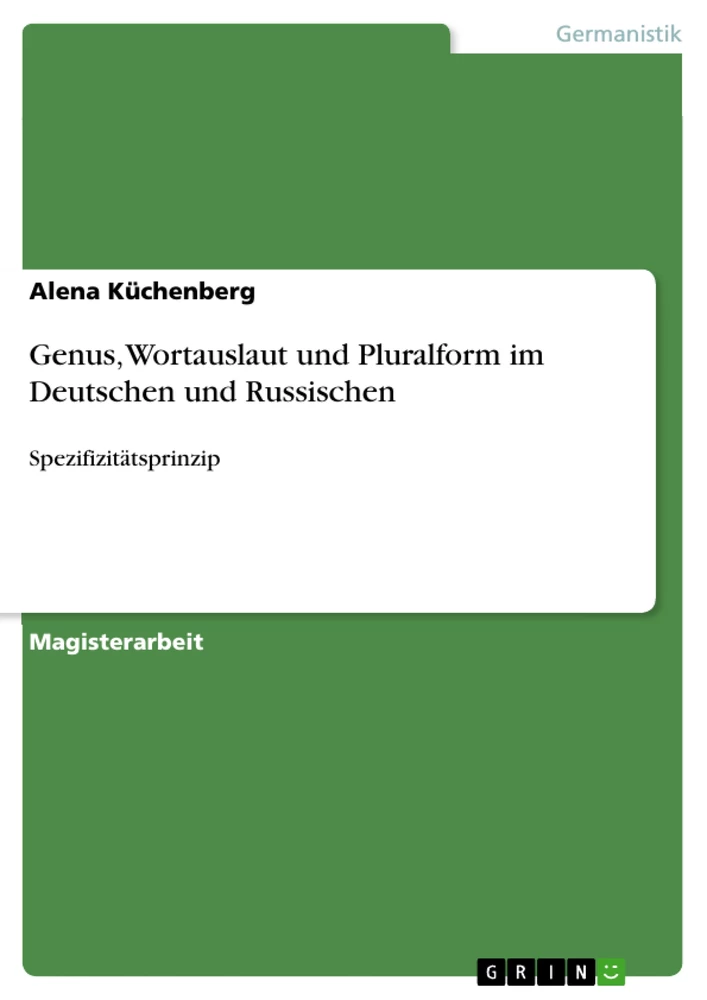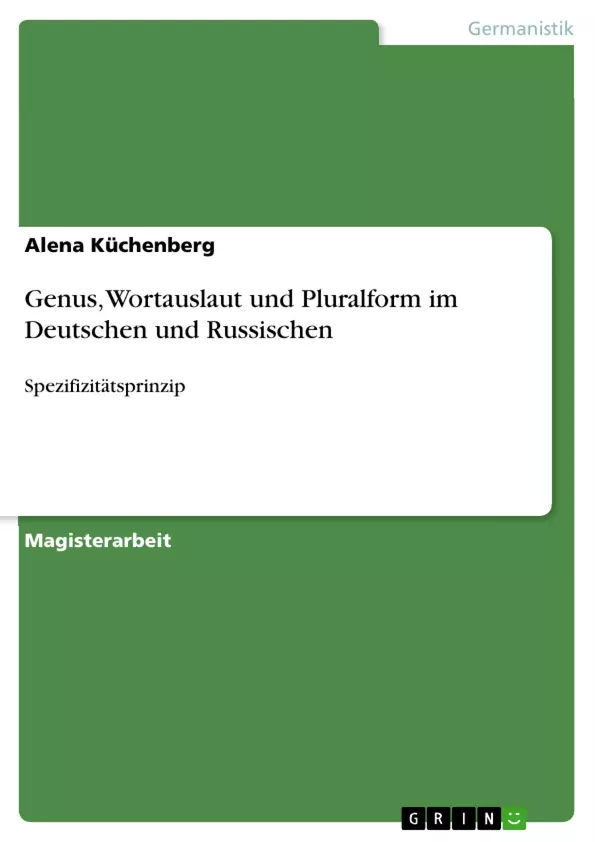Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Pluralsystemen des Deutschen und des Russischen und stellt eine Art komparative Analyse dar. Es wird untersucht, ob die Pluralbildungsregeln im Deutschen und Russischen nach denselben Kriterien formuliert und angewendet werden, und, wenn nicht, wo die Unterschiede liegen.
Zentral für die vorliegende Untersuchung ist die These von Wegener, dass „sich die Pluralform aus Merkmalen des Singularstamms ableiten lassen muss“ und dass die „Genusklassenzugehörigkeit dafür eine Rolle spielt.“ Darum bilden die Genusregeln und ihre Anwendung den ersten Schwerpunkt dieser Arbeit.
Das zweite von Wegener genannte Merkmal, das für die Pluralbildung relevant sein kann, ist die Flexionsklasse. Im Russischen ist die Flexionsklassenzugehörigkeit an den Auslaut des jeweiligen Substantivs gebunden und korreliert mehr oder weniger zuverlässig mit der Eigenschaft Genus. Insofern ist es logisch zu vermuten, dass der Wortauslaut als ein zweites wichtiges Kriterium neben dem Genus für die Bildung der Pluralformen von Bedeutung ist. Deswegen bilden die Wortauslautregeln in den beiden Sprachen einen weiteren Schwerpunkt.
Es ist offensichtlich, dass auf das jeweilige Wort mehr als nur eine Regel zutreffen kann. Darum ist es wichtig, nicht nur die Regeln an sich zu beherrschen, sondern auch zu wissen, welche der eventuell mit einander konkurrierenden Regeln anzuwenden ist. Dass die Regeln nicht beliebig benutzt werden können, ist klar. Insofern stellt die Frage nach der Hierarchisierung der Genus- und Wortauslautregeln den nächsten Schwerpunkt dar.
In dieser Hinsicht sind zwei Aspekte besonders wichtig. Der erste Aspekt betrifft die Rangordnung der Pluralbildungsregeln als solche. Die damit verbundenen Fragen, die beantwortet werden müssen, sind:
– Welche Gruppe von Regeln ist in der jeweiligen Sprache höher gerankt und für die Bildung der Pluralformen wichtiger, die Genusregeln oder die Wortauslautregeln?
– Welche Gruppe von Regeln hat in der jeweiligen Sprache einen größeren Anwendungsskorpus?
– Inwiefern unterscheiden sich das Deutsche und das Russische in Bezug auf die relative Gewichtung der Genus- und der Wortauslautregeln?
Den zweiten wichtigen Aspekt der Regelhierarchisierung bildet die Frage, ob die Anwendungsreihenfolge der Pluralregeln arbiträr ist und von den Sprechern gelernt werden muss oder ob sie automatisch erfolgt. In diesem Zusammenhang stellt die Annahme des Spezifizitätsprinzips ein besonderes Interesse dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die existierenden Ansätze zum Thema Pluralbildung und sprachliche Daten
- 2.1. Das Pluralsystem des Deutschen und die traditionellen Pluralregeln
- 2.1.1. Der Reichtum der deutschen Pluralformen
- 2.1.2. Die Behandlung der deutschen Pluralbildung in der Dudengrammatik
- 2.1.2.1. Faktor Genus bei der Formulierung der Grundregeln im Duden
- 2.1.2.2. Faktor Wortauslaut und die Zusatzregeln nach Duden
- 2.1.2.3. Lexikalische Spezifikationen und ihre Behandlung im Duden
- 2.2. Die Daten des Russischen und verschiedene Ansätze zu ihrer Beschreibung
- 2.2.1. Die Vielfalt der Pluralbildungsmuster im Russischen
- 2.2.2. Die Pluralbildungsregeln des Russischen
- 2.2.2.1. Die deklinationsklassenbasierte Behandlung russischer Plurale in den Referenzgrammatiken
- 2.2.2.2. Die Pluralbildungsregeln in den genusgesteuerten Ansätzen
- 2.2.2.3. Die Rolle des Wortauslautes bei der Formulierung der Pluralregeln
- 2.2.2.4. Behandlung der nur teilweise regulären Fälle und die Ausnahmen
- 2.1. Das Pluralsystem des Deutschen und die traditionellen Pluralregeln
- 3. Pluralregeln in ihrem Zusammenspiel
- 3.1. Korrelation zwischen dem Genus und dem Wortauslaut und Möglichkeiten ihrer Auswirkung auf die Pluralbildung im Deutschen und Russischen
- 3.2. Mögliche Varianten der Regelinteraktion
- 3.3. Das Spezifizitätsprinzip als Mechanismus der Regelhierarchisierung
- 3.3.1. Definition des Spezifizitätsprinzips und seine Vorteile
- 3.3.2. Was ist spezifischer, das Genus oder der Wortauslaut?
- 3.3.3. Wortauslaut als Elsewhere-Condition für die genusgesteuerte Pluralbildung im Deutschen
- 3.3.4. Wortauslaut als Elsewhere-Condition für die genusgesteuerte Pluralbildung im Russischen
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit verfolgt das Ziel, die Pluralsysteme des Deutschen und des Russischen vergleichend zu analysieren. Im Fokus steht die Untersuchung der Faktoren, die die Pluralbildung in beiden Sprachen steuern, insbesondere die Interaktion von Genus und Wortauslaut bei der Regelbildung und -anwendung. Die Arbeit überprüft, ob und wie die Pluralbildungsregeln in beiden Sprachen übereinstimmen oder sich unterscheiden.
- Analyse der Pluralbildungsregeln im Deutschen und Russischen
- Untersuchung der Rolle des Genus bei der Pluralbildung
- Untersuchung der Rolle des Wortauslauts bei der Pluralbildung
- Vergleich der Regelhierarchisierung in beiden Sprachen
- Anwendung des Spezifizitätsprinzips auf die Pluralbildung im Deutschen und Russischen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der vergleichenden Analyse der Pluralsysteme des Deutschen und Russischen ein. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Einflussfaktoren auf die Pluralbildung und deren Interaktion. Die These von Wegener, wonach sich die Pluralform aus Merkmalen des Singularstamms (Genus und Flexionsklasse) ableitet, wird als Ausgangspunkt der Untersuchung genannt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Rolle des Genus und des Wortauslauts als entscheidende Faktoren.
2. Die existierenden Ansätze zum Thema Pluralbildung und sprachliche Daten: Dieses Kapitel präsentiert die sprachlichen Daten zur Pluralbildung im Deutschen und Russischen und deren Behandlung in bestehenden Grammatiken. Der Fokus liegt auf der Analyse der Pluralregeln im Duden (Deutsch) und auf verschiedenen Ansätzen zur Beschreibung der russischen Pluralbildung, die den Genus und den Wortauslaut als relevante Kriterien berücksichtigen. Es wird gezeigt, dass im Deutschen die Pluralregeln bereits nach Genus und Wortauslaut systematisiert sind, während dies im Russischen oft erst durch eigene Formulierung geleistet werden muss.
3. Pluralregeln in ihrem Zusammenspiel: Dieses Kapitel befasst sich mit der Interaktion von Genus- und Wortauslautregeln bei der Pluralbildung. Es untersucht die Rangordnung der Regeln und ihre relative Gewichtung in beiden Sprachen. Ein zentraler Aspekt ist die Frage nach der Hierarchisierung der Regeln und die Anwendung des Spezifizitätsprinzips (Elsewhere Condition) zur Erklärung der Regelanwendung. Das Kapitel vergleicht die Anwendung des Prinzips im Deutschen und Russischen und untersucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Behandlung von Ausnahmen.
Schlüsselwörter
Pluralbildung, Genus, Wortauslaut, Deutsch, Russisch, Regelhierarchisierung, Spezifizitätsprinzip, Elsewhere Condition, Vergleichende Sprachwissenschaft, Morphologie.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Vergleichende Analyse der Pluralbildung im Deutschen und Russischen
Was ist das Thema dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert vergleichend die Pluralsysteme des Deutschen und des Russischen. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Faktoren, die die Pluralbildung in beiden Sprachen steuern, insbesondere die Interaktion von Genus und Wortauslaut bei der Regelbildung und -anwendung. Die Arbeit überprüft, ob und wie die Pluralbildungsregeln in beiden Sprachen übereinstimmen oder sich unterscheiden.
Welche Faktoren beeinflussen die Pluralbildung im Deutschen und Russischen?
Die Arbeit untersucht die Rolle des Genus (grammatisches Geschlecht) und des Wortauslauts als entscheidende Faktoren bei der Pluralbildung in beiden Sprachen. Sie analysiert, wie diese Faktoren interagieren und welche Hierarchie zwischen den Regeln besteht.
Welche Daten werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit analysiert die Pluralbildungsregeln im Duden (für Deutsch) und verschiedene Ansätze zur Beschreibung der russischen Pluralbildung. Die Analyse berücksichtigt sowohl regelmäßige als auch unregelmäßige Pluralformen.
Wie werden die Pluralregeln in den beiden Sprachen behandelt?
Im Deutschen sind die Pluralregeln bereits nach Genus und Wortauslaut systematisiert (Duden). Im Russischen hingegen muss diese Systematisierung oft erst durch eigene Formulierung geleistet werden. Die Arbeit vergleicht die verschiedenen Ansätze zur Beschreibung der russischen Pluralbildung.
Welche Rolle spielt das Spezifizitätsprinzip (Elsewhere Condition)?
Die Arbeit wendet das Spezifizitätsprinzip (Elsewhere Condition) an, um die Hierarchisierung der Pluralbildungsregeln im Deutschen und Russischen zu erklären. Sie untersucht, ob und wie das Genus und der Wortauslaut als spezifischere Kriterien im Vergleich zueinander behandelt werden und wie Ausnahmen erklärt werden können.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse in Form einer vergleichenden Analyse der Pluralbildungsregeln im Deutschen und Russischen. Sie zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Regelhierarchisierung und der Anwendung des Spezifizitätsprinzips auf. Das Inhaltsverzeichnis bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Kapitel.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Pluralbildung, Genus, Wortauslaut, Deutsch, Russisch, Regelhierarchisierung, Spezifizitätsprinzip, Elsewhere Condition, Vergleichende Sprachwissenschaft, Morphologie.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die vergleichende Analyse der Pluralsysteme des Deutschen und Russischen, um die Einflussfaktoren auf die Pluralbildung und deren Interaktion zu untersuchen. Die Arbeit zielt darauf ab, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Regelbildung und -anwendung aufzuzeigen.
Welche These wird in der Arbeit diskutiert?
Die These von Wegener, wonach sich die Pluralform aus Merkmalen des Singularstamms (Genus und Flexionsklasse) ableitet, dient als Ausgangspunkt der Untersuchung.
- Quote paper
- Alena Küchenberg (Author), 2015, Genus, Wortauslaut und Pluralform im Deutschen und Russischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/339788