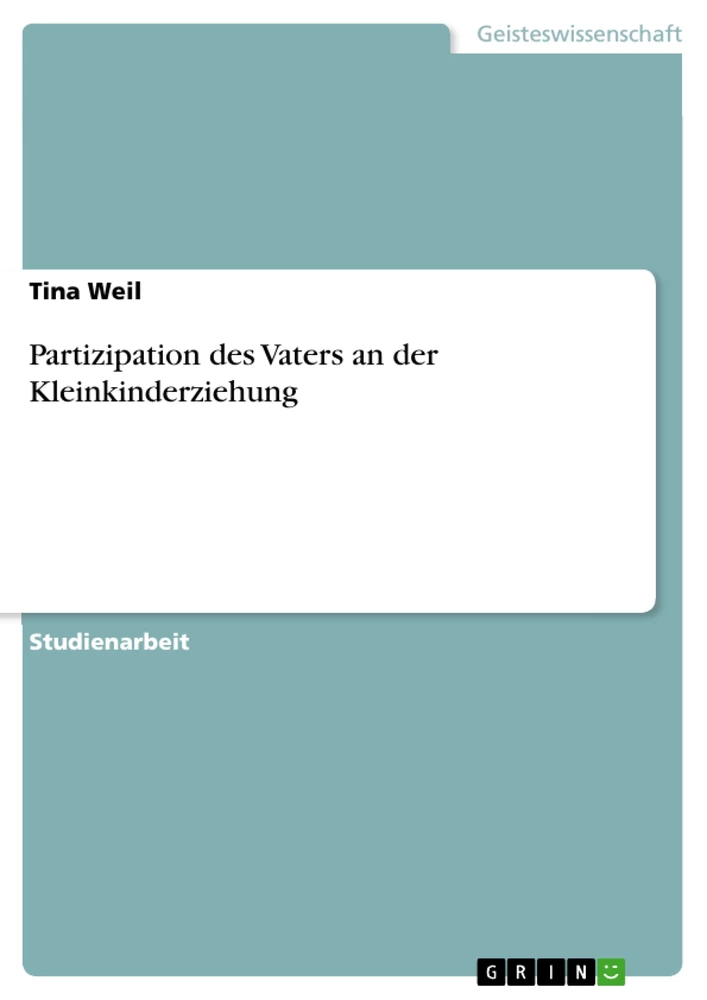„Ein Vater, der Kinder zeugt und sie großzieht, erfüllt damit nur ein Drittel seiner Aufgabe. Seiner Gattung schuldet er Menschen, seiner Gesellschaft schuldet er gemeinschaftsfähige Menschen, und dem Staat schuldet er Bürger. Jeder Mann, der in der Lage ist, diese dreifache Schuld zu zahlen, und es nicht tut, ist schuldig und noch schuldiger vielleicht, wenn er sie nur zur Hälfte zahlt. Derjenige, der unfähig ist, die Aufgabe eines Vaters zu erfüllen, hat nicht das Recht, Vater zu werden. Weder Armut noch Arbeit, noch menschliche Rücksichten entbinden ihn von der Pflicht, seine Kinder zu ernähren und sich selbst zu erziehen.“
Diese Anleitung zur verantworteten Vaterschaft mag einem zunächst zwar recht nachvollziehbar erscheinen, die Tatsache, dass sie bereits vor über 200 Jahren gegeben wurde, dürfte allerdings sehr erstaunen. Während sich das Konzept der Vaterrolle vor allem in den letzten Jahrzehnten erheblich gewandelt hat und man gegenwärtig wieder nach einer sinnvollen Definition des Vaterbegriffs sucht, ist es fast unwirklich, dass Rousseaus Worte, die ja den Weg in die richtige Richtung weisen, im Laufe der Zeit anscheinend in Vergessenheit geraten sind. Besonders beeindruckt vor allem die Erkenntnis, dass Kinder, die aus einem Mann ja erst einen Vater machen auch zu einer Erziehung seiner eigenen Person beitragen. Zwar sind vor allem für die Verwirklichung der aktiven Vaterschaft grundlegende Veränderungen des Lebens beider Elternteile gewiss, von einer parallelen Entwicklung beider Rollen kann jedoch keine Rede sein.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Überblick über Vaterschaft
- Die neuen Väter ?!
- Ihre Bedeutung für das Kind
- Entwicklung eines neuen Rollenkonzeptes
- Überblick über die derzeitige Partizipation
- Ursachen und Gründe für eine mangelnde Partizipation
- Eigenschaften und Persönlichkeit des Vaters
- Soziale Faktoren
- Verhalten und Rolle der Partnerin
- Einfluss des Kindes
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Väter im Vorschulalter oft nicht ausreichend an der Kinderbetreuung beteiligt sind. Sie analysiert die verschiedenen Gründe für mangelndes väterliches Engagement, untersucht die historischen Entwicklungen der Vaterrolle und beleuchtet die Bedeutung der Väter für die Entwicklung ihrer Kinder.
- Historische Entwicklung der Vaterrolle
- Bedeutung der Väter für die Entwicklung des Kindes
- Gründe für mangelndes väterliches Engagement
- Soziokulturelle Einflussfaktoren auf die Vaterrolle
- Mögliche Veränderungen und Perspektiven der Vaterrolle
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die aktuelle Situation der Vaterrolle, insbesondere im Kontext der Kleinkinderziehung. Sie bezieht sich auf historische Entwicklungen und beleuchtet die Herausforderungen, die mit der aktiven Vaterschaft verbunden sind.
- Historischer Überblick über Vaterschaft: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über die Vaterrolle in verschiedenen Klassen und Ständen bis zur Französischen Revolution. Es wird die traditionelle Rolle des Vaters im Mittelalter und die Bedeutung der Frau in der Erziehung der Kinder beleuchtet. Auch die Rolle des Vaters in der adligen Gesellschaft wird betrachtet.
- Die neuen Väter?!: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Vaterbildes in der heutigen Zeit. Es werden die Bedeutung der Väter für die Entwicklung des Kindes, die Herausforderungen bei der Entwicklung eines neuen Rollenkonzeptes und die aktuelle Situation der Partizipation der Väter an der Kinderbetreuung betrachtet.
Schlüsselwörter
Vaterrolle, Kleinkinderziehung, Partizipation, historische Entwicklung, Soziokulturelle Faktoren, Familienleben, Genderrollen, Kinderentwicklung, Einflussfaktoren, Veränderungen, Perspektiven, Engagement.
Häufig gestellte Fragen
Warum beteiligen sich Väter oft weniger an der Kleinkinderziehung?
Gründe liegen oft in sozialen Faktoren, der Persönlichkeit des Vaters, traditionellen Rollenbildern der Partnerin sowie beruflichen Rahmenbedingungen.
Wie hat sich die Vaterrolle historisch entwickelt?
Die Arbeit bietet einen Überblick vom Mittelalter bis zur Moderne und zeigt, wie sich das Bild vom „Ernährer“ hin zum „aktiven Vater“ gewandelt hat.
Welche Bedeutung hat der Vater für die Entwicklung des Kindes?
Väter leisten einen eigenständigen Beitrag zur Sozialisation, zur kognitiven Entwicklung und zur emotionalen Sicherheit ihrer Kinder.
Was versteht man unter dem Begriff „Neue Väter“?
Dieser Begriff beschreibt eine Generation von Vätern, die aktiv an der Erziehung teilhaben wollen und eine emotionale Bindung zu ihren Kindern jenseits der Versorgerrolle suchen.
Welchen Einfluss hat die Partnerin auf das Engagement des Vaters?
Das Verhalten und die Rollenerwartungen der Mutter können die Partizipation des Vaters entweder fördern oder durch „Gatekeeping“ einschränken.
- Quote paper
- Tina Weil (Author), 2001, Partizipation des Vaters an der Kleinkinderziehung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3400