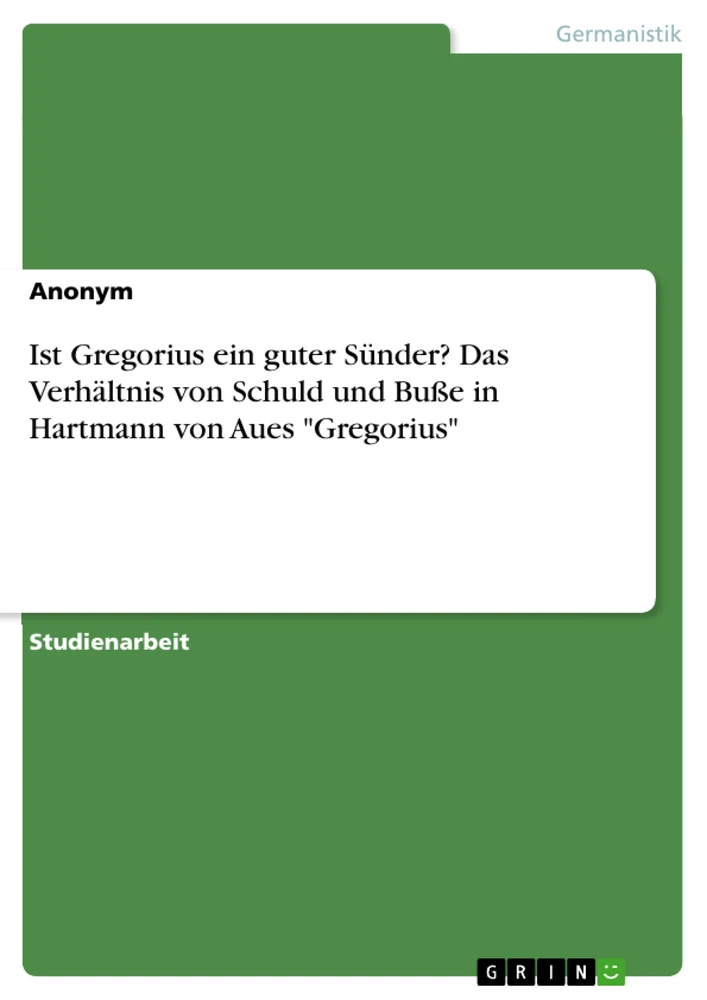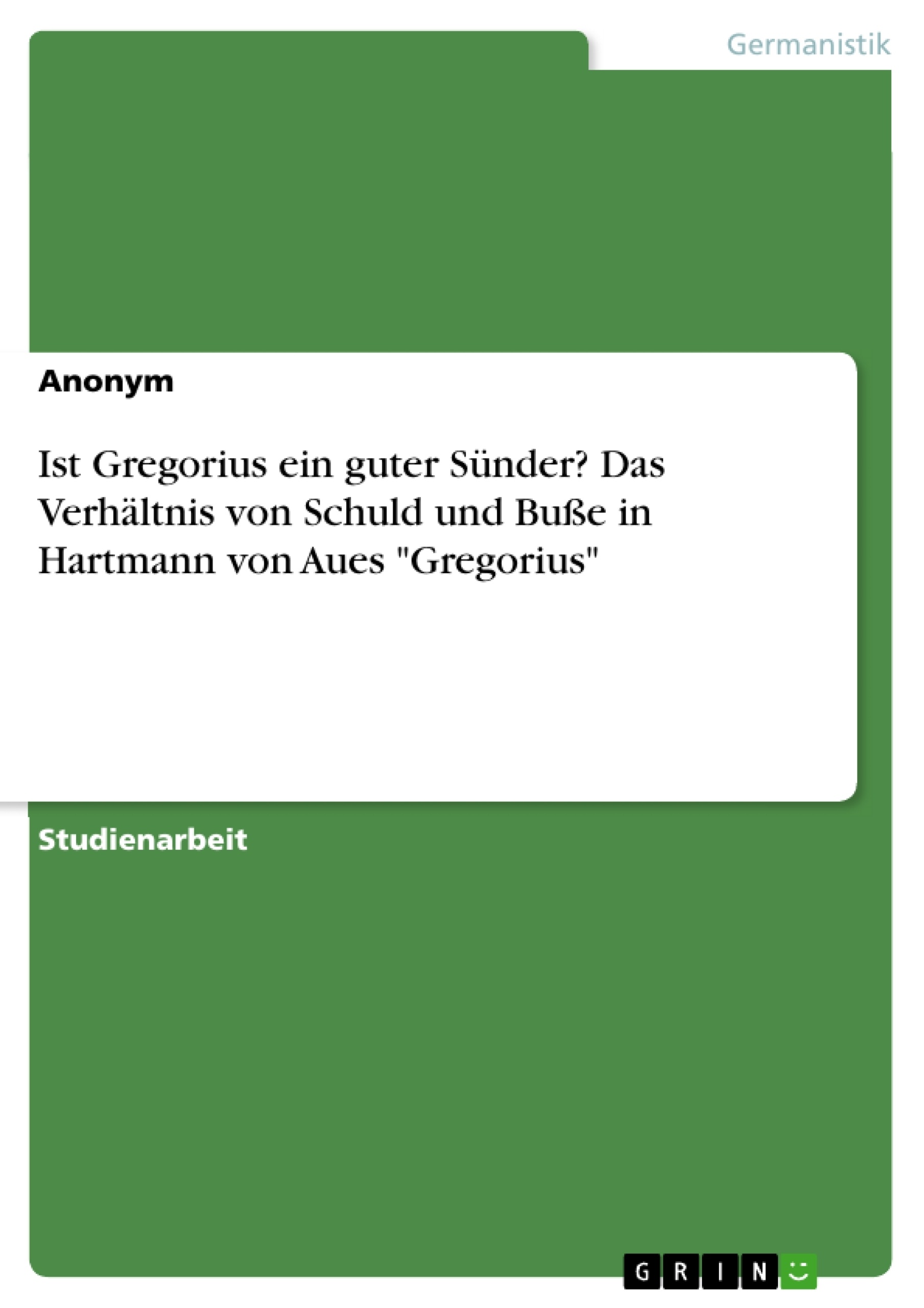Der Begriff 'Legende' leitet sich von dem lateinischen Ausdruck 'legenda' ab, was so viel bedeutet wie "das, was zu lesen ist". Legenden handeln von dem Leben und den Taten von Heiligen. Im Mittelalter spielte die Gattung der Legendendichtung eine große Rolle. Es gab sowohl Legendensammlungen als auch längere Dichtungen, die einzelnen Heiligen gewidmet waren. Hierzu zählt Hartmann von Aues Werk "Gregorius", mit dem ich mich in dieser Hausarbeit näher beschäftigen möchte.
Im Mittelalter waren die Heiligen allgegenwärtig: Im Gottesdienst, bei Heiligenfesten und Prozessionen. Angebetet wurde dabei nicht nur die Person eines Heiligen, sondern auch seine Reliquien. Verehrung fanden Knochen oder Körperteile des Heiligen, die man auf verschiedene Kirchen verteilte. Zu den Reliquien gehörten zudem Gegenstände, die der Heilige berührt hatte oder berührt haben sollte. Auch dort, wo sich das Grab eines Heiligen befand, erhoffte man sich Hilfe und pilgerte zu den heiligen Stätten. Durch den Erwerb einer Reliquie versprach man sich einen Platz im Himmel sichern zu können. Außerdem glaubte man, dass von den Reliquien eine schützende und heilende Kraft ausging. Die Heiligenverehrung bestimmte den Alltag und die Lebenswirklichkeit der mittelalterlichen Menschen sehr stark, weshalb die Legendendichtung eine wichtige Gattung dieser Zeit darstellte.
Eine Besonderheit unter den Heiligen bildeten die sogenannten 'sündigen Heiligen'.
Sündige Heilige sind Heilige, die in ihrem Leben nicht sündenfrei blieben, sondern – im Gegenteil – sogar teilweise schwere Sünden begingen. In der Regel fanden sie durch Reue und Buße den Weg zurück zu Gott und galten deshalb trotz ihrer begangenen Sünden als Vorbilder. Als ein solcher 'sündiger Heiliger' wird auch Gregorius verstanden. In manchen Ausgaben hat die Dichtung den Untertitel "Der gute Sünder". Trifft diese paradoxe Eigen-schaft auf Gregorius zu? Und wenn ja, warum? Dieser Fragestellung möchte ich mich in der nachfolgenden Arbeit widmen und dabei vor allem auf das Verhältnis von Schuld und Buße eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sündige Heilige
- Schuld im Gregorius
- Geschwisterinzest
- Mutter-Sohn Inzest
- Buße im Gregorius
- Buße der Mutter
- Buße des Gregorius
- Papsttum
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit Hartmanns von Aues Werk Gregorius und untersucht das Verhältnis von Schuld und Buße im Kontext der mittelalterlichen Heiligenlegende. Besonderes Augenmerk liegt auf der Figur des Gregorius, der als "sündiger Heiliger" in der Literatur bezeichnet wird.
- Die Darstellung von Inzest als schwere Sünde und die Folgen für die beteiligten Personen
- Die Rolle des Teufels in der Entstehung der Sünde und der Bedeutung der Buße
- Die gesellschaftliche und rechtliche Ausgrenzung von Inzestkindern und die Suche nach Rekonziliation
- Die Funktion der Heiligenlegende als erbauliches Werk und ihre Bedeutung für die mittelalterliche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in die Thematik der Heiligenlegende im Mittelalter ein und stellt den "sündigen Heiligen" als Sonderfall vor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des Werks "Gregorius" von Hartmann von Aue, insbesondere auf das Verhältnis von Schuld und Buße in der Figur des Protagonisten.
- Das zweite Kapitel erläutert den Begriff des "sündigen Heiligen" und zeigt die Funktion dieser Heiligenfiguren in der mittelalterlichen Gesellschaft. Es werden die verschiedenen Typen von Sünden und die drei Stufen im Leben eines Sünderheiligen beschrieben.
- Das dritte Kapitel befasst sich mit der Schuld im Gregorius, genauer gesagt mit den beiden Inzestfällen, die die Handlung des Werks prägen. Es werden die beiden Fälle des Geschwisterinzest und des Mutter-Sohn-Inzestes im Hinblick auf ihre unterschiedlichen Charakteristiken und Beweggründe analysiert.
- Der Abschnitt über den Geschwisterinzest beschreibt, wie der Inzest im Werk als schwere Sünde dargestellt wird und welche Motive dem Bruder für seine Handlung zugeschrieben werden. Zudem wird diskutiert, ob Gregorius als Kind seiner Eltern deren Schuld trägt.
Schlüsselwörter
Die zentrale Thematik dieser Hausarbeit ist die Darstellung von Schuld und Buße im mittelalterlichen Werk "Gregorius" von Hartmann von Aue. Schlüsselwörter sind dabei "sündiger Heiliger", "Inzest", "Teufel", "Buße", "Rekonziliation", "Heiligenlegende" und "mittelalterliche Gesellschaft". Das Werk untersucht die Figur des Gregorius als Inzestkind und seine Suche nach Vergebung und spiritueller Wiedergeburt im Kontext der mittelalterlichen Moralvorstellungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „sündiger Heiliger“?
Es ist eine Figur der Legendendichtung, die schwere Sünden begeht, aber durch tiefe Reue und Buße den Weg zurück zu Gott findet und als Vorbild gilt.
Welche Sünden begeht Gregorius?
Gregorius ist das Kind eines Geschwisterinzests und begeht später unwissentlich selbst Inzest mit seiner eigenen Mutter.
Wie vollzieht Gregorius seine Buße?
Er verbringt siebzehn Jahre angekettet auf einem einsamen Felsen im Meer, um für seine Schuld zu büßen, bevor er schließlich zum Papst gewählt wird.
Warum wird das Werk als „Der gute Sünder“ bezeichnet?
Diese paradoxe Eigenschaft bezieht sich darauf, dass Gregorius trotz seiner schweren Verfehlungen ein gottgefälliges Leben anstrebt und durch Buße rekonziliert wird.
Welche Rolle spielt der Teufel in Hartmanns Werk?
Der Teufel wird als treibende Kraft dargestellt, die die Menschen zur Sünde verführt, was die Bedeutung der anschließenden Buße unterstreicht.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Ist Gregorius ein guter Sünder? Das Verhältnis von Schuld und Buße in Hartmann von Aues "Gregorius", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340021