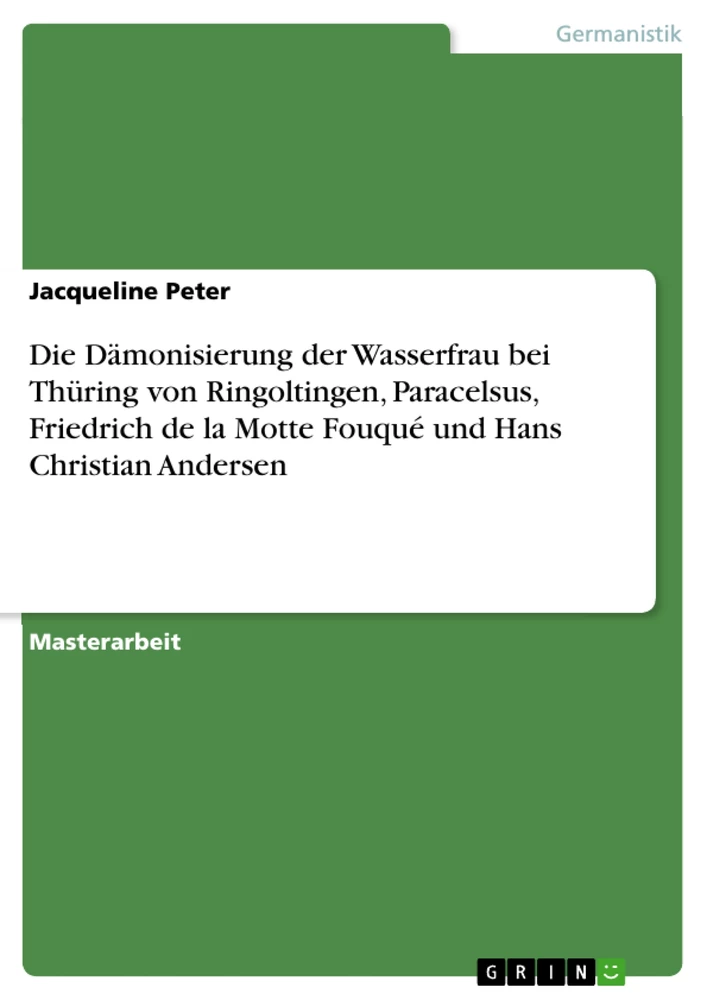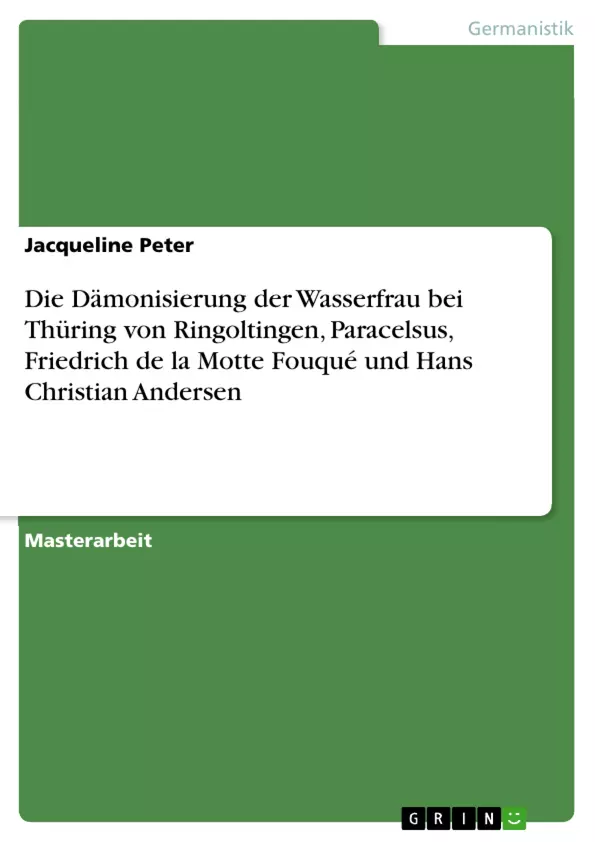In dieser Arbeit werden vorrangig die Primärtexte "Melusine" von Thüring von Ringoltingen, "Liber de nymphis sylphis pygmaeus et salamandres et de ceteris spiritibus" von Paracelsus, "Undine" von Friedrich de la Motte Fouqué und "Die kleine Meerjungfrau" von Hans Christian Andersen auf die Dämonisierung beziehungsweise Entdämonisierung der Wasserfrau hin untersucht. Die einzelnen Erzählungen veranschaulichen, welche zeitliche Entwicklung die Figur durchmacht und wie sie "fortschreitend von der Sage zum Märchen" entdämonisiert und mit "weiblichen Zügen" behaftet wird. Doch trotz dieser zunehmenden Entdämonisierung wird die Wasserfrau für den Mann immer gefährlicher, die Bestrafung des Mannes drastischer. Es gilt zu klären, von welchen Faktoren dies abhängt.
Die Wasserfrau wird grob in zwei verschiedene Typen unterteilt: die Melusinen- und die Undinenfigur. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Stofftradition, den geschichtlichen Hintergründen und der Art der Dämonisierung. Als mythische Stammmutter und Ahnfrau der Lusignans nimmt Melusine eine Sonderstellung ein. Doch auch der Ursprung des Wasserfrauenmythos, die Sirenen, findet hier Beachtung. Ebenso relevant sind die klerikalen Erzählungen des 12. Jahrhunderts als Vorläufer des Melusinenstoffs und die Staufenberg-Sage aus dem 15. Jahrhundert.
Bei der Analyse der Texte werden verschiedene Fragestellungen und Sachverhalte behandelt. In welchem Maße besitzen die Figuren eine Doppelnatur und welche Bedeutung hat der Schlangen- bzw. Fischschwanz hinsichtlich der Dämonisierung? Inwieweit wird das Bedrohliche der Wasserfrau christlich absorbiert und welche Rolle spielt dabei genau der Erlösungsgedanke Paracelsus'? Eine zentrale Rolle spielt außerdem das Narrativ der gestörten Mahrtenehe. Dabei werden die unterschiedlichen Variationen in Verbindung mit dem Tabubegriff, der Bestrafung und der Rollen des menschlichen und des andersweltlichen Parts erläutert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Sirenen - Der mythologische Ursprung der Wasserfrau
- 2.2. Die Stammutter Melusine
- 2.3. Loreley
- 2.4. Meerjungfrauen und Nixen
- 3. Paracelsus
- 3.1. Paracelsus Elementargeistlehre
- 3.2. Melusine als Hexe
- 4. Das Motiv der gestörten Mahrtenehe
- 5. Die proto-melusinische Erzählung - Gervasius von Tilburys „Otia imperialia“
- 6. Die Staufenberg-Sage
- 6.1. Entstehungsgeschichte
- 6.2. Die mysteriöse Unbekannte
- 6.3. Eine Sonderform der gestörten Mahrtenehe
- 6.4. Der bedeutungsträchtige Fuß
- 6.5. Paracelsus - die Freisprechung der Staufenberger Fee
- 7. Thürings von Ringoltingen „Melusine“
- 7.1. Entstehungsgeschichte
- 7.2. Der erste Eindruck zählt
- 7.3. Die Gründung eines neuen Geschlechts
- 7.4. Eine Frau in der Herrscherrolle
- 7.5. Der erste Tabubruch - Die Verschiebung des Kräfteverhältnisses
- 7.6. Der zweite Tabubruch - Die Diffamierung der Melusine
- 7.7. Dämonisierung und Christianisierung der Schlangenfrau
- 7.8. Die Ambivalenz des Schlangenleibes
- 8. Friedrich de la Motte Fouqués „Undine“
- 8.1. Entstehungsgeschichte
- 8.2. Die Naturhaftigkeit der Undine
- 8.3. Undines Verwandlung in eine leidende und liebende Frau
- 8.4. Polarisierte Weiblichkeit
- 8.5. Undine im Spannungsfeld zwischen Christentum und mythischer Herkunft
- 9. Hans Christian Andersens "Die kleine Meerjungfrau"
- 9.1. Entstehungsgeschichte
- 9.2. Die Amputation des Fischschwanzes
- 9.3. Die Unvereinbarkeit zweier Welten
- 9.4. Die dämonische Meerhexe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dämonisierung der Wasserfrau in verschiedenen literarischen Werken vom Mittelalter bis zur Moderne. Ziel ist es, die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs und seine Wandlung im Laufe der Zeit nachzuvollziehen, insbesondere die Verschiebung zwischen Dämonisierung und Entdämonisierung zu analysieren. Dabei werden die unterschiedlichen Darstellungen in Bezug auf ihre zeitgeschichtlichen Hintergründe und die jeweiligen gesellschaftlichen Normen betrachtet.
- Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs über die Jahrhunderte
- Die Ambivalenz der Wasserfrau: zwischen Faszination und Bedrohung
- Der Einfluss des Christentums auf die Darstellung der Wasserfrau
- Das Motiv der gestörten Mahrtenehe und dessen Variationen
- Die Rolle des Schlangen- bzw. Fischschwanzes als Symbol der Andersartigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Wasserfrau ein und skizziert die Ambivalenz dieser Figur, die zwischen Mythischem, Wunderbarem und Bedrohlichem changiert. Sie benennt die Primärtexte, die im Laufe der Arbeit analysiert werden – Thürings von Ringoltingens „Melusine“, Paracelsus’ „Liber de nymphis sylphis pygmaeus et salamandres et de ceteris spiritibus“, Fouqués „Undine“ und Andersens „Die kleine Meerjungfrau“ – und beschreibt den Fokus der Arbeit auf die zeitliche Entwicklung der Wasserfrau-Darstellung und die Faktoren, die die zunehmende Gefährlichkeit der Figur für den Mann beeinflussen.
2. Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Analyse, indem es den mythologischen Ursprung der Wasserfrau in den Sirenen der griechischen Mythologie beleuchtet. Es werden deren Eigenschaften – die verführerische Stimme, die Macht über das Wetter, das übernatürliche Wissen – erläutert und ihre Rolle als Verführerinnen in der Literaturgeschichte hervorgehoben. Die Ambivalenz des Wasserfrauen-Mythos wird hier bereits als Ausgangspunkt der weiteren Untersuchung etabliert.
Häufig gestellte Fragen zu „Die Dämonisierung der Wasserfrau in Literatur und Mythos“
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Dämonisierung der Wasserfrau in verschiedenen literarischen Werken vom Mittelalter bis zur Moderne. Im Fokus steht die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs und seine Wandlung im Laufe der Zeit, insbesondere die Verschiebung zwischen Dämonisierung und Entdämonisierung. Die unterschiedlichen Darstellungen werden in Bezug auf ihre zeitgeschichtlichen Hintergründe und die jeweiligen gesellschaftlichen Normen betrachtet.
Welche Texte werden analysiert?
Die Analyse umfasst unter anderem Thürings von Ringoltingens „Melusine“, Paracelsus’ „Liber de nymphis sylphis pygmaeus et salamandres et de ceteris spiritibus“, Fouqués „Undine“ und Andersens „Die kleine Meerjungfrau“. Die Arbeit beleuchtet auch den mythologischen Ursprung der Wasserfrau in den Sirenen der griechischen Mythologie und die proto-melusinische Erzählung in Gervasius von Tilburys „Otia imperialia“ sowie die Staufenberg-Sage.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs über die Jahrhunderte, die Ambivalenz der Wasserfrau zwischen Faszination und Bedrohung, den Einfluss des Christentums auf die Darstellung der Wasserfrau, das Motiv der gestörten Mahrtenehe und dessen Variationen sowie die Rolle des Schlangen- bzw. Fischschwanzes als Symbol der Andersartigkeit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Kapitel 1 bietet eine Einleitung in die Thematik. Kapitel 2 liefert Begriffsdefinitionen, die den mythologischen Ursprung der Wasserfrau beleuchten. Die folgenden Kapitel analysieren die ausgewählten literarischen Werke und thematisieren Aspekte wie die Entstehungsgeschichte der jeweiligen Texte, die Rolle der Wasserfrau in den Erzählungen und die zeitgeschichtlichen sowie gesellschaftlichen Einflüsse auf ihre Darstellung. Die Kapitel 3 und 6 befassen sich speziell mit Paracelsus und der Staufenberg-Sage. Die Kapitel 7 und 8 analysieren die Melusine-Erzählung von Thürings von Ringoltingen und Fouqués Undine. Kapitel 9 behandelt Andersens „Die kleine Meerjungfrau“.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist es, die Entwicklung des Wasserfrauen-Motivs und seine Wandlung im Laufe der Zeit nachzuvollziehen und die Verschiebung zwischen Dämonisierung und Entdämonisierung zu analysieren. Die Arbeit untersucht, welche Faktoren die zunehmende Gefährlichkeit der Figur für den Mann beeinflussen.
Welche Aspekte der Wasserfrau werden besonders hervorgehoben?
Besonderes Augenmerk liegt auf der Ambivalenz der Wasserfrau, ihrer Darstellung als verführerische und gefährliche Figur, dem Einfluss des Christentums auf ihre Darstellung und der Rolle des Schlangen- bzw. Fischschwanzes als Symbol für Andersartigkeit.
Welche Bedeutung hat das Motiv der gestörten Mahrtenehe?
Das Motiv der gestörten Mahrtenehe wird als wiederkehrendes Element in verschiedenen Erzählungen untersucht und seine Variationen in den jeweiligen Texten analysiert.
- Arbeit zitieren
- Jacqueline Peter (Autor:in), 2016, Die Dämonisierung der Wasserfrau bei Thüring von Ringoltingen, Paracelsus, Friedrich de la Motte Fouqué und Hans Christian Andersen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340114