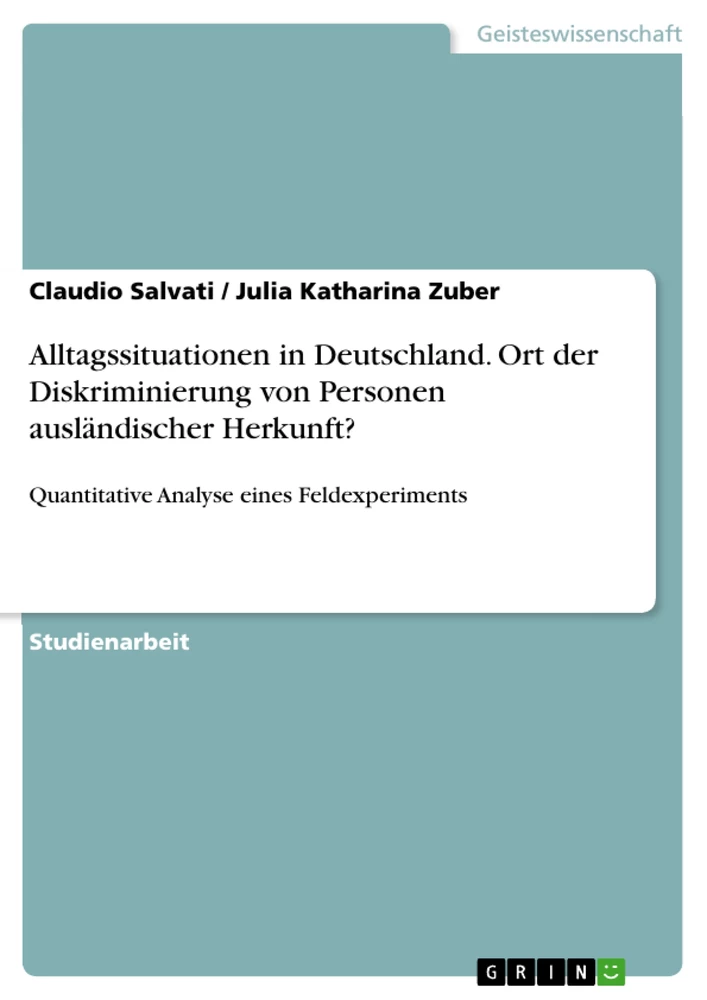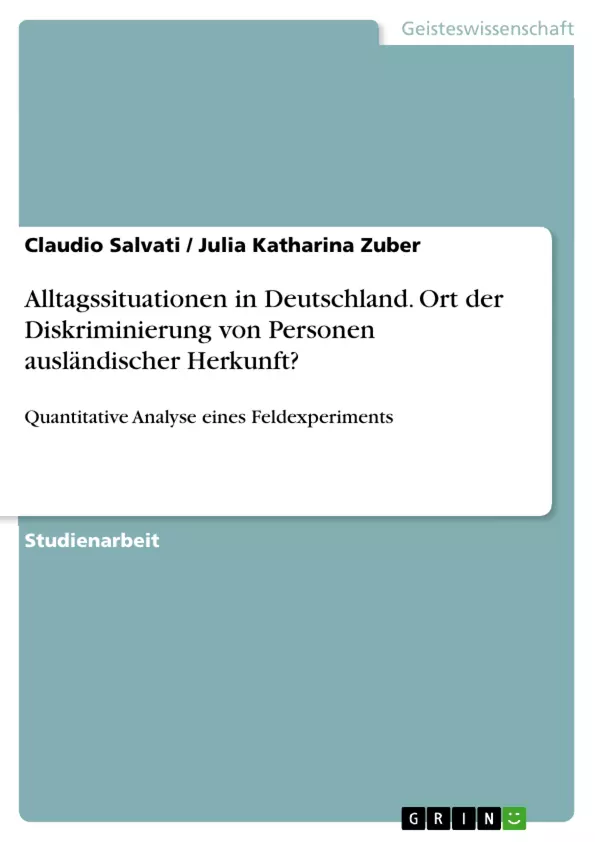Die Anzahl der gestellten Asylanträge in Deutschland erreicht 2014 ihren Höhepunkt, im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um fast 58%. Doch die Zuwanderer werden nicht immer willkommen geheißen: Eine Studie der Friedrich-Ebert- Stiftung von 2008 kam zu dem Ergebnis, dass 30% der Bevölkerung ausländerfeindlichen Aussagen zustimmte. In Ostdeutschland ist der Anteil der zustimmenden Befragten am Höchsten; dort betrugt er 45%.
Aktuell bekommt Fremdenfeindlichkeit in Deutschland mediale Aufmerksamkeit. Der Verein der „Patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“, kurz PEGIDA, propagiert derzeit eine noch strengere europäische und deutsche Migrationspolitik, vor allem in Hinblick auf Migranten islamischen Glaubens. Die Ansprüche, die von den PEGIDA- Mitgliedern gestellt werden, erfahren allerdings nicht von allen Bundesbürgern Rückhalt. In ganz Deutschland mobilisieren sich PEGIDA-Gegner und rufen zu Anti-PEGIDA-Demos auf. Anschuldigungen zur Fremdenfeindlichkeit und der Vorwurf, Ausländer, vor allem Anhänger des Islam, zu diskriminieren, indem konsequent vor einer scheinbaren „Islamisierung des Abendlandes“ gewarnt wird, werden auf der Seite der PEGIDA-Gegner laut, auf der Seite deren Anhänger vehement zurückgewiesen. Das Thema Diskriminierung gewinnt an Aktualität und Relevanz. Der Vorwurf der PEGIDA-Gegner zeigt aber lediglich das alltagssprachliche Verständnis von Diskriminierung als eine illegitime oder nicht begründete schlechte Einschätzung von Menschen (in diesem Fall von Islamanhängern).
Die vollständige Definition des Begriffs Diskriminierung blickt aus einer Opferperspektive, beinhaltet eine Perspektivendifferenz und daher unterschiedliche Auffassungen über die Rechtmäßigkeit eines bestimmten Verhaltens: „Diskriminierung wird als eine als illegitim wahrgenommene negative Behandlung von Mitgliedern einer Gruppe definiert, wobei diese negative Behandlung allein auf der Basis ihrer Gruppenmitgliedschaft beruht“ (vgl. Jonas & Beelmann 2009: 23).
Das hier definierte Verhalten wird zwar von der Mehrheit der Bevölkerung in allen Ländern der EU deutlich abgelehnt, der Umkehrschluss zeigt sich allerdings nicht als aktiver Widerstand gegen jegliche Formen von Diskriminierung. Eine auf Deutschland bezogene Studie des Sinus-Instituts von 2008 zeigt, dass die Aufmerksamkeit der Bevölkerung für das Thema Diskriminierung gering ist. Diese Arbeit untersucht anhand eines Feldexperiments das Auftreten von Diskriminierung im Alltag.
Inhaltsverzeichnis
- Gesellschaftliche Relevanz der Diskriminierungsforschung¹
- Theoretischer Hintergrund…………….
- Sozialpsychologisch orientierte Theorien der Diskriminierung.
- Die „self-fulfilling prophecy“.
- Die Theorie der sozialen Identität nach Tajfel (1978).....
- Das Etablierten-Außenseiter-Modell
- Deprivationsansätze (u.a. Stouffer et al. 1949)
- Ökonomisch orientierte Theorien der Diskriminierung
- Signaling Theorie
- Der Präferenzansatz..
- Statistische Diskriminierung..
- Aufarbeitung des bisherigen Forschungsstandes......
- ,,Wie fremdenfeindlich ist die Schweiz? – Fünf Feldexperimente über prosoziales Verhalten und die Diskriminierung von Ausländern in der Stadt Zürich und in der Deutschschweiz❝
- "Ethnic discrimination in Germany's labour market: a field experiment”.
- "Discrimination Against Ethnic Minorities in Germany: Going Back to the Field”...........
- Ableitung der Forschungshypothesen
- Methoden
- Forschungsdesign
- Erhebungsverfahren......
- Variablen
- Abhängige Variablen
- Unabhängige Variablen.....
- Drittvariablen........
- Analyseverfahren..........\li>
- Deskriptive Datenanalyse.
- Regressionsanalyse
- Wahrscheinlichkeit einer Antwort bzw. einer Zusage..
- Linearer Zusammenhang der Dauer bis zur Antwort ..
- Schätzung der Antwortdauer mittels nicht-linearen Regressionen…...\li>
- Linearer Zusammenhang der Buchstabenanzahl
- Ergebnisse der Regressionsanalysen – Rückbezug zu den aufgestellten Hypothesen ............
- Ergebnisse der logistischen Regressionen.
- Ergebnisse der linearen und der Poisson-Regression der Dauer bis zu Antwort.
- Ergebnisse der negativen Binomial-Regression der Dauer bis zu Antwort
- Interpretation der linearen Regression der Buchstabenanzahl......
- Diskussion
- Fazit.........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht das Auftreten von Diskriminierung im Alltag. Der Fokus liegt auf der Frage, ob sich Diskriminierung von Personen ausländischer Herkunft in Alltagssituationen nachweisen lässt. Dabei wird ein Feldexperiment ausgewertet, das sich mit der Frage der Diskriminierung im Alltag auseinandersetzt.
- Diskriminierung von Personen ausländischer Herkunft im Alltag
- Quantitative Analyse eines Feldexperiments
- Theoretische Ansätze zur Erklärung von Diskriminierung
- Methoden der Datenanalyse
- Ergebnisse der Regressionsanalysen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die gesellschaftliche Relevanz der Diskriminierungsforschung im Kontext der aktuellen Migrationsentwicklungen in Deutschland. Kapitel 2 bietet einen theoretischen Hintergrund, indem verschiedene sozialpsychologische und ökonomische Theorien der Diskriminierung vorgestellt werden. In Kapitel 3 wird der bisherige Forschungsstand zur Diskriminierung in Deutschland und der Schweiz aufgearbeitet. Kapitel 4 leitet die Forschungshypothesen des Feldexperiments ab. Kapitel 5 beschreibt das Forschungsdesign, die Erhebungsverfahren und die verwendeten Variablen. Kapitel 6 erläutert die Analyseverfahren, die zur Auswertung des Feldexperiments eingesetzt werden. Schließlich werden in Kapitel 7 die Ergebnisse der Regressionsanalysen vorgestellt und auf die aufgestellten Hypothesen bezogen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit konzentriert sich auf die Bereiche Diskriminierung, Feldexperiment, quantitative Analyse, sozialpsychologische Theorien, ökonomische Theorien, Migrationsforschung und Deutschland.
- Citation du texte
- Claudio Salvati (Auteur), Julia Katharina Zuber (Auteur), 2015, Alltagssituationen in Deutschland. Ort der Diskriminierung von Personen ausländischer Herkunft?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340118