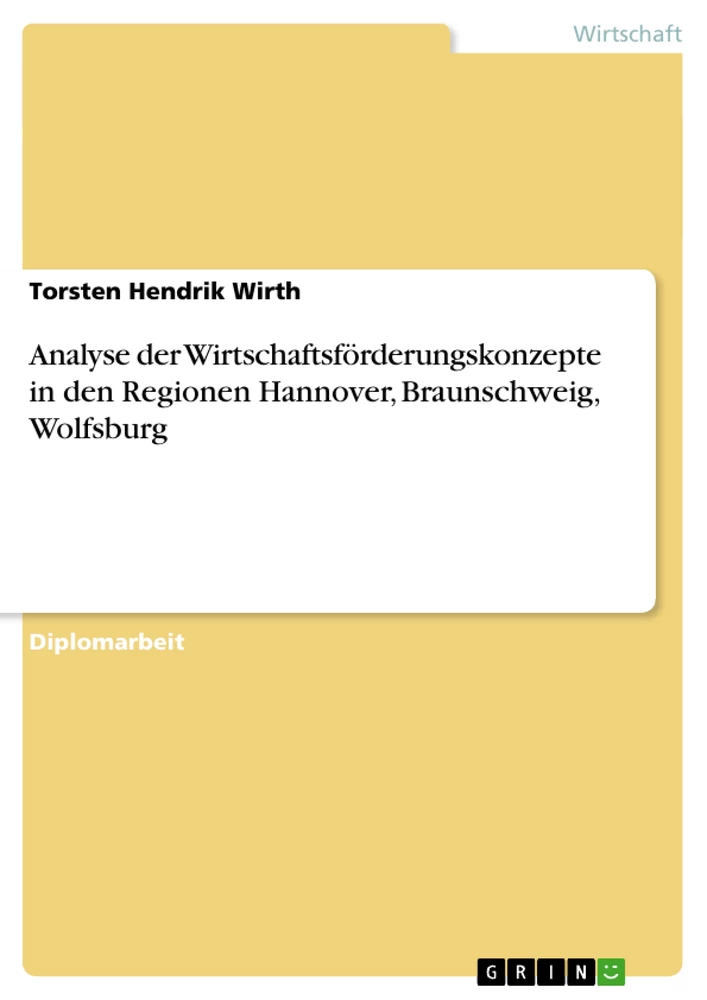Der anhaltende Strukturwandel wirkt nicht nur auf Branchen und einzelne Unternehmen, sondern zeigt seine Auswirkungen mittlerweile auch in weiten Teilen der westlichen Industriestaaten. Ebenfalls beeinflussen im nationalen und internationalen Wettbewerb die globalen Rahmenbedingungen den Handlungsspielraum von Wirtschafts- bzw. Lebensräumen. Folglich werden betroffene Regionen zukünftig stärker gezwungen sein, sich den damit verbundenen Entwicklungs- und Umstrukturierungsprozessen zu stellen.
Vor diesem Hintergrund kommt es entscheidet darauf an, wie sich die wirtschaftsfördernden Akteure einer Volkswirtschaft unter den verändernden Wettbewerbsbedingungen profilieren bzw. positionieren können. Diejenigen, die ihre Potenziale nur unzureichend nutzen, werden im Vergleich zu denen, die ihre traditionellen Stärken in einem kontinuierlichen Innovationsprozess weiterentwickeln können, zukünftig stärker zurück fallen. Die wirtschaftlichen Folgen eines negativen Szenarios sind unter anderem der Rückgang der Wirtschaftskraft sowie der Abbau von Arbeitsplätzen. In Relation zu erfolgreicheren Räumen führt diese Entwicklung zu einem nachhaltigen Attraktivitätsverlust der gesamten Region.
Damit auch Regionen im internationalen Wettbewerb um die besten Standortfaktoren weiter bestehen können, wird es immer wichtiger echte wirtschaftliche, wissenschaftliche, soziale und kulturelle Profile zu entwickeln. Ziel dieser Bemühungen ist es, attraktive Rahmenbedingungen für die Unternehmen sowie die Bevölkerung zu schaffen. Damit vorhandene Stärken ausgebaut bzw. besser nutzbar gemacht werden können, ist es daher notwendig, die wirtschaftsfördernden Aktivitäten einer Region in einen ganzheitlichen konzeptionellen Rahmen einzubinden.
Vor diesem Hintergrund entwickelten die Wirtschaftsräume Hannover, Braunschweig und Wolfsburg zwischen 1998 und 2004 drei umsetzungsfähige Konzepte zur Verbesserung der Wirtschafts- und Beschäftigungssituation vor Ort.
Die vorliegende Diplomarbeit zur Erlangung des Hochschulgrades „Dipl. Kaufmann (FH)“ befasst sich aus gegebenem Anlass beispielhaft mit der Analyse dieser Wirtschaftsförderungskonzepte.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen
- 2.1 Rechtsgrundlagen der kommunalen Wirtschaftsförderung
- 2.2 Rechtsgrundlagen der staatlichen Wirtschafts- und Strukturpolitik
- 2.3 Grundzüge der europäischen Regionalpolitik
- 2.4 Erläuterungen zum Begriff der „Wirtschaftsförderung“
- 2.5 Clusterbildung als Konzeptansatz für regionale Wirtsförderung
- 3. Status der Wirtschaftsregion Hannover im nationalen Vergleich
- 3.1 Ziele und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
- 3.2 Träger und Aufgabengebiete der Wirtschaftsförderung
- 3.3 Entwicklung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes für die Region Hannover
- 3.3.1 Darstellung des Wirtschaftsförderungskonzeptes „Hannover - Projekt“
- 3.3.2 Die Projektgesellschaft Hannoverimpuls GmbH
- 3.3.3 Konzeptumsetzung des „Hannover-Projektes“
- 3.3.3.1 Schwerpunkt 1: Automotive
- 3.3.3.2 Schwerpunkt 2: Produktionstechnik
- 3.3.3.3 Schwerpunkt 3: Lasertechnik
- 3.3.3.4 Schwerpunkt 4: Life Science
- 3.3.3.5 Schwerpunkt 5: luk-Technologie
- 3.3.3.6 Schwerpunkt 6: Beschäftigungsmodelle
- 3.3.3.7 Schwerpunkt 7: Querschnittsprojekte
- 3.3.3.8 Schwerpunkt 8: Steigerung der regionalen Attraktivität
- 4. Status der Wirtschaftsregion Braunschweig
- 4.1 Leitlinien der Wirtschaftsförderung
- 4.2 Träger der Wirtschaftsförderung
- 4.3 Entwicklung eines Wirtschaftsförderungskonzepte für den Großraum Braunschweig
- 4.3.1 Darstellung des Wirtschaftsförderungskonzeptes „Projekt Region Braunschweig“
- 4.3.2 Konzeptumsetzung des „Projektes Region Braunschweig“
- 4.3.2.1 Schwerpunkt 1: Fahrzeugbau
- 4.3.2.2 Schwerpunkt 2: Umwelttechnik
- 4.3.2.3 Schwerpunkt 3: Materialien- und Maschinenbau
- 4.3.2.4 Schwerpunkt 4: Tourismus
- 4.3.2.5 Schwerpunkt 5: Finanzdienstleistungen
- 4.3.2.6 Schwerpunkt 6: Verkehrssicherheit / luk
- 4.3.2.7 Schwerpunkt 7: Norddeutsches Wasserzentrum
- 4.3.2.8 Schwerpunkt 8: Querschnittsthemen
- 5. Status Wolfsburg, eine Stadt der Wolkswagen AG ?
- 5.1 Ziele der Wirtschaftsförderung
- 5.2 Träger und Aufgabengebiete der kommunalen Wirtschaftsförderung
- 5.3 Entwicklung eines Wirtschaftsförderungskonzeptes für die Stadt Wolfsburg
- 5.3.1 Darstellung des Wirtschaftsförderungskonzeptes „AutoVision“
- 5.3.2 Die Projektgesellschaft Wolfsburg AG
- 5.3.3 Konzeptumsetzung der „AutoVision“ in Projektphase I
- 5.3.3.1 Geschäftsbereich 1: Lieferantenansiedlung
- 5.3.3.2 Geschäftsbereich 2: Personal Service Agentur
- 5.3.3.3 Geschäftsbereich 3: ErlebnisWelt
- 5.3.3.4 Geschäftsbereich 4: InnovationsCampus
- 5.3.4 Zwischenbilanz „AutoVision“ nach der Projektphase I
- 5.3.5 Konzeptumsetzung der „AutoVision“ in Projektphase II
- 5.3.6 Konzeptumsetzung der „AutoVision“ in Projektphase III
- 6. Vergleichende Bewertung der drei Fallbeispiele
- 7. Zur Gestaltbarkeit von Clustern durch die regionale Wirtschaftsförderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Wirtschaftsförderungskonzepte der Regionen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg. Sie untersucht die rechtlichen Grundlagen der kommunalen und staatlichen Wirtschaftsförderung sowie die Rolle der europäischen Regionalpolitik. Ziel ist es, die unterschiedlichen Ansätze der Wirtschaftsförderung in den drei Regionen zu vergleichen und zu bewerten.
- Rechtsgrundlagen der Wirtschaftsförderung auf kommunaler, staatlicher und europäischer Ebene
- Analyse der Wirtschaftsförderungskonzepte in den Regionen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg
- Vergleichende Bewertung der unterschiedlichen Ansätze
- Bedeutung von Clusterbildung für die regionale Wirtschaftsförderung
- Gestaltungsmöglichkeiten von Clustern durch die Wirtschaftsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik der Diplomarbeit und erläutert die Zielsetzung und die methodischen Vorgehensweisen.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Wirtschaftsförderung. Es werden die rechtlichen Rahmenbedingungen auf kommunaler, staatlicher und europäischer Ebene sowie der Begriff der „Wirtschaftsförderung“ und das Konzept der Clusterbildung erläutert.
- Kapitel 3: Das Kapitel beleuchtet die Wirtschaftsregion Hannover im nationalen Vergleich. Es werden die Ziele und Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowie die Träger und Aufgabengebiete dargestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf der Entwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes „Hannover - Projekt“ und dessen Umsetzung in verschiedenen Schwerpunktbereichen.
- Kapitel 4: Analog zu Kapitel 3 werden die Leitlinien, Träger und die Entwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes für den Großraum Braunschweig dargestellt. Es werden die Schwerpunkte des „Projektes Region Braunschweig“ detailliert analysiert.
- Kapitel 5: Die Analyse der Wirtschaftsregion Wolfsburg konzentriert sich auf die Ziele, Träger und die Entwicklung des Wirtschaftsförderungskonzeptes „AutoVision“. Es wird die Umsetzung der „AutoVision“ in verschiedenen Projektphasen beleuchtet.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel widmet sich der vergleichenden Bewertung der drei Fallbeispiele Hannover, Braunschweig und Wolfsburg. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Konzepten und deren Umsetzung aufgezeigt.
- Kapitel 7: Das Kapitel diskutiert die Gestaltungsmöglichkeiten von Clustern durch die regionale Wirtschaftsförderung. Es werden die Chancen und Herausforderungen der Clusterbildung im Kontext der Wirtschaftsförderung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wirtschaftsförderung, Regionalentwicklung, Clusterbildung, Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Projektgesellschaften, AutoVision, Hannover-Projekt, Region Braunschweig, Rechtliche Rahmenbedingungen, Europäische Regionalpolitik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Regionen werden in der Wirtschaftsförderungs-Analyse untersucht?
Die Diplomarbeit analysiert die Konzepte der Regionen Hannover, Braunschweig und Wolfsburg.
Was ist das "Hannover-Projekt"?
Es ist das Wirtschaftsförderungskonzept der Region Hannover, das durch die Projektgesellschaft Hannoverimpuls GmbH umgesetzt wird und Schwerpunkte wie Automotive und Life Science hat.
Was verbirgt sich hinter dem Konzept "AutoVision" in Wolfsburg?
"AutoVision" ist das Konzept der Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg AG, das unter anderem auf Lieferantenansiedlung und Innovation setzt.
Welche Rolle spielt die Clusterbildung?
Clusterbildung wird als zentraler Konzeptansatz für die regionale Wirtschaftsförderung untersucht, um Synergien zwischen Unternehmen und Forschung zu nutzen.
Auf welchen Rechtgrundlagen basiert die Wirtschaftsförderung?
Die Arbeit erläutert die Rechtsgrundlagen auf kommunaler Ebene, staatlicher Ebene sowie die Grundzüge der europäischen Regionalpolitik.
- Citar trabajo
- Torsten Hendrik Wirth (Autor), 2004, Analyse der Wirtschaftsförderungskonzepte in den Regionen Hannover, Braunschweig, Wolfsburg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34015