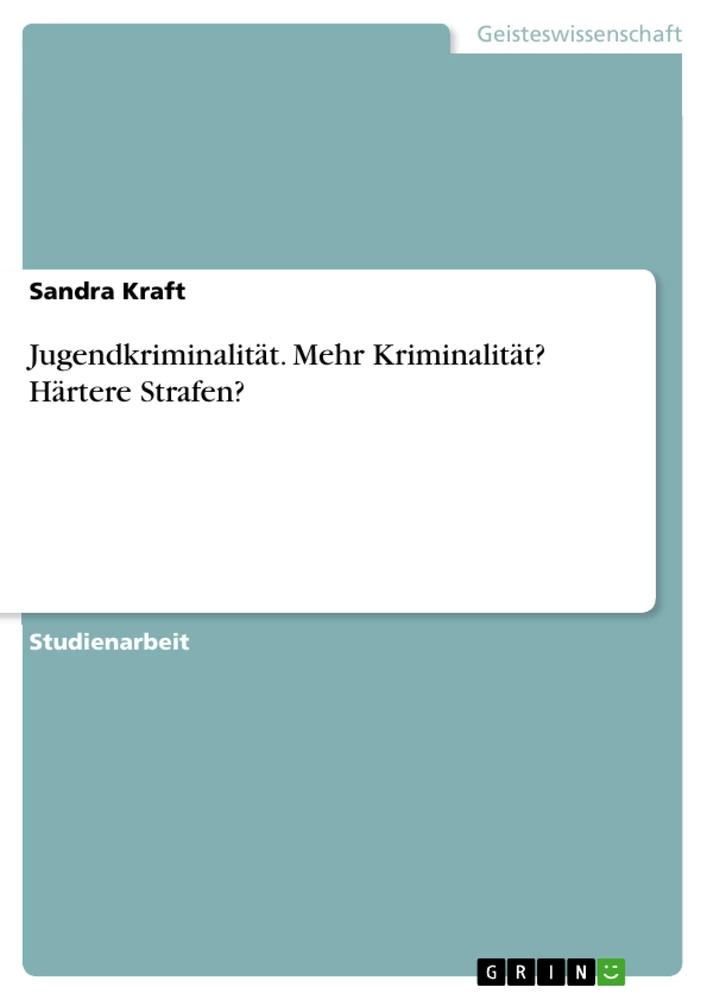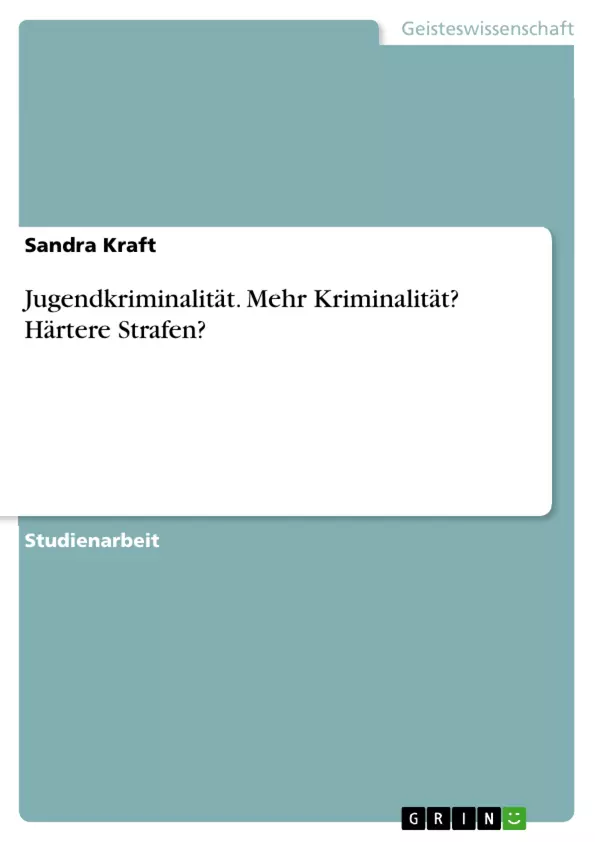Die mediale Berichterstattung über kriminelle Jugendliche erweckt oft den Anschein von einer immer gefährlicher werdenden jungen Generation. Gerade im Zusammenhang mit einzelnen äußerst brutalen Gewaltanwendungen (beispielhaft sei hier auf die Schlägerei mit Todesfolge in einem Münchner S-Bahnhof im Jahr 2009 und ähnlich gearteter und medial präsenter Fälle in den letzten Jahren hingewiesen) werden Stimmen laut, die vor einer Gefahr durch die heutige Jugend warnen. In der Folge greifen üblicherweise Politiker die Thematik auf, um sogleich für mehr Überwachung und härtere Strafen gegenüber Jugendlichen zu plädieren. In der hessischen Landtagswahl im Jahr 2008 wurde diese Thematik sogar zentrales Wahlkampfthema einer Partei . Eine wissenschaftliche Untermauerung solcher Forderungen nach härterem Durchgreifen und der Darstellung einer zunehmenden Jugendkriminalität fehlt es in der Regel in den zugehörigen Berichterstattungen, was verschiedene Fragen aufwirft. Im Kern lassen sich hier zwei Grundannahmen herausfiltern: Die Jugendkriminalität ist ein ständig wachsendes Problemfeld (1) und mit härteren Strafen lässt sich dieses Problem zurückdrängen oder gar beseitigen (2).
In dieser Arbeit werden jene zwei Grundannahmen aufgegriffen, um abseits von populistischen Äußerungen darzustellen, ob es hierfür auch aus wissenschaftlicher Sicht Belege gibt.
Können die Jugendlichen in Deutschland also als immer krimineller angesehen werden? Und hilft ein härteres Durchgreifen in Form von Strafverschärfungen generell Kriminalität zu bekämpfen bzw. präventiv als Abschreckung zu dienen? Um diese Fragen beantworten zu können wird zunächst die quantitativen und qualitativen Ausmaße der Jugendkriminalität und ihre Entwicklung dargestellt. Danach werden die strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten und die Sanktionspraxis gegenüber Jugendlichen in Deutschland vorgestellt. Zum Abschluss wird betrachtet, ob härtere Strafen vorteilhaft gegenüber milderen Sanktionsarten sind und was die härtesten Strafen, namentlich die freiheitsentziehenden Sanktionen, mit Blick auf die Ziele des Jugendstrafrechts (hierauf wird im entsprechenden Kapitel näher eingegangen) überhaupt leisten können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendkriminalität. Immer schlimmer?
- Sanktionen/Strafen gegenüber Jugendlichen
- Formelle und informelle Sanktionsmöglichkeiten des JGG.
- Sanktionierungspraxis in Deutschland...
- Sind härtere Strafen sinnvoll?
- Rechtliche Tendenzen zu mehr Härte
- Erziehung zur Freiheit durch Freiheitsentzug?
- Fazit.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob Jugendkriminalität in Deutschland tatsächlich immer schlimmer wird und ob härtere Strafen ein effektives Mittel zur Bekämpfung dieses Problems darstellen. Die Arbeit untersucht die quantitativen und qualitativen Ausmaße der Jugendkriminalität, analysiert die strafrechtlichen Sanktionsmöglichkeiten und die Sanktionspraxis gegenüber Jugendlichen in Deutschland, und diskutiert die Vor- und Nachteile von härteren Strafen im Vergleich zu milderen Sanktionsarten.
- Entwicklung und Ausmaß der Jugendkriminalität in Deutschland
- Sanktionsmöglichkeiten im Jugendstrafrecht
- Sanktionierungspraxis in Deutschland
- Effektivität von härteren Strafen
- Ziele des Jugendstrafrechts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung
Die Arbeit beleuchtet den medialen Diskurs über Jugendkriminalität und die Forderung nach härteren Strafen. Sie stellt zwei zentrale Grundannahmen in Frage: Erstens, dass Jugendkriminalität ein ständig wachsendes Problemfeld ist, und zweitens, dass härtere Strafen dieses Problem lösen können.
2. Jugendkriminalität. Immer schlimmer?
Das Kapitel analysiert die Entwicklung der Jugendkriminalität anhand der polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und der Strafverfolgungsstatistik. Es stellt fest, dass die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen zwar in den 90er Jahren deutlich gestiegen ist, aber seit 2004 wieder rückläufig ist. Allerdings ist die Kriminalitätsbelastung stark vom Alter abhängig, und junge Menschen sind in den Statistiken überrepräsentiert. Das Kapitel erläutert auch, dass die meisten von Jugendlichen begangenen Delikte dem Bagatellbereich zuzuordnen sind und die mediale Berichterstattung über Gewaltverbrechen das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinflussen kann.
3. Sanktionen/Strafen gegenüber Jugendlichen
Dieses Kapitel beschreibt die formellen und informellen Sanktionsmöglichkeiten des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) und die Sanktionierungspraxis in Deutschland. Es beleuchtet die Frage, ob härtere Strafen sinnvoll sind und welche rechtlichen Tendenzen zu mehr Härte bestehen.
4. Erziehung zur Freiheit durch Freiheitsentzug?
Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf den Auswirkungen von freiheitsentziehenden Sanktionen auf die Ziele des Jugendstrafrechts. Es wird untersucht, inwiefern diese Maßnahmen mit den Grundprinzipien des Jugendstrafrechts in Einklang stehen.
Schlüsselwörter
Jugendkriminalität, Jugendstrafrecht, Sanktionen, Strafen, Härte, Prävention, Abschreckung, Kriminalitätsbelastung, PKS, Strafverfolgungsstatistik, Medienberichterstattung, Sicherheitsempfinden, Gewaltkriminalität, Freiheitsentzug, Erziehung, JGG.
Häufig gestellte Fragen zur Jugendkriminalität
Wird die Jugendkriminalität in Deutschland immer schlimmer?
Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass die Zahlen nach einem Anstieg in den 90ern seit etwa 2004 rückläufig sind. Die mediale Wahrnehmung weicht oft von der statistischen Realität ab.
Helfen härtere Strafen gegen kriminelle Jugendliche?
Wissenschaftliche Belege für eine abschreckende Wirkung härterer Strafen fehlen weitgehend. Das Jugendstrafrecht setzt primär auf Erziehung statt auf reine Vergeltung.
Was ist das Ziel des Jugendstrafrechts (JGG)?
Das Hauptziel ist die Resozialisierung und die Vermeidung künftiger Straftaten durch erzieherische Maßnahmen, nicht die bloße Bestrafung des Täters.
Warum sind Jugendliche in Kriminalstatistiken überrepräsentiert?
Kriminalität im Jugendalter ist oft ein episodenhaftes Phänomen ("Ubiquität"), das mit der Identitätssuche und Gruppendynamik zusammenhängt und sich meist im Erwachsenenalter verliert.
Welchen Einfluss haben Medien auf das Sicherheitsempfinden?
Durch die Berichterstattung über seltene, aber brutale Einzelfälle entsteht oft ein verzerrtes Bild einer "gewaltbereiten Generation", was politische Forderungen nach mehr Härte befeuert.
- Arbeit zitieren
- Sandra Kraft (Autor:in), 2013, Jugendkriminalität. Mehr Kriminalität? Härtere Strafen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340174