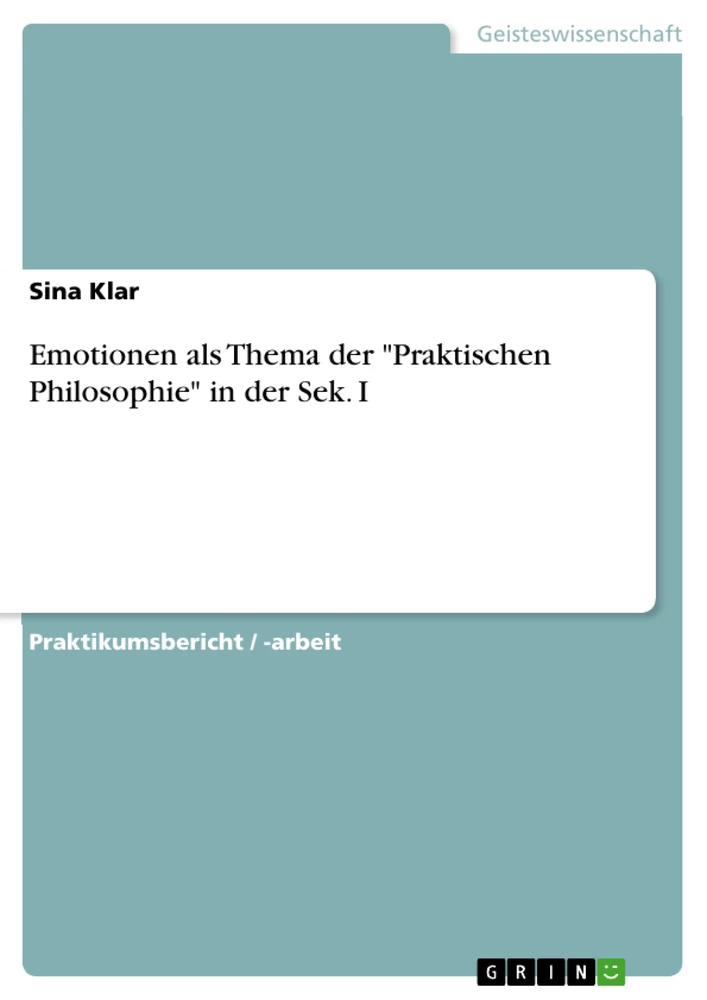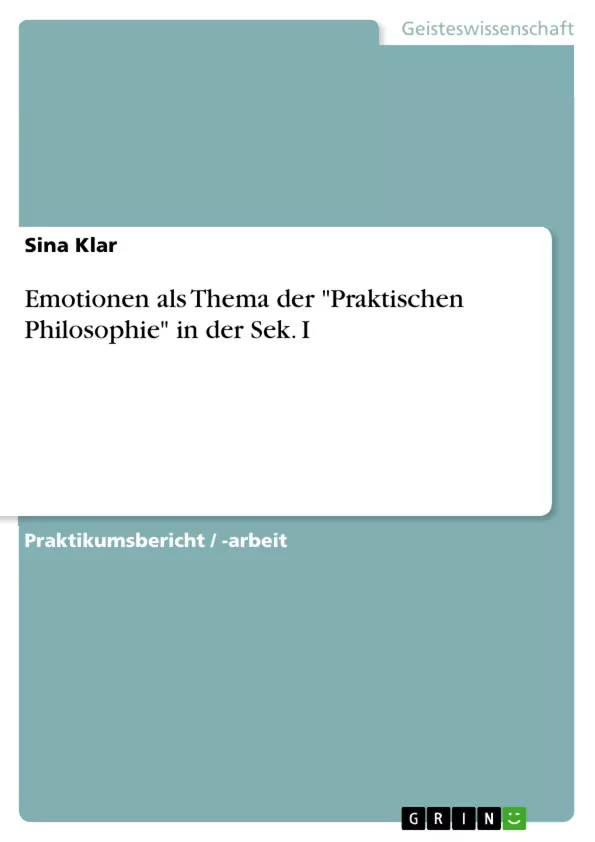Dies ist ein Praktikumsbericht über ein Fachpraktikum an einem Kölner Gymnasium im Fachbereich Philosophie. Die Autorin berichtet über ihre Erfahrungen gegenüber dem Lehrpersonal, ihren Mentoren und auch dem Unterrichten selbst.
Aus dem Text:
-Vorstellung der Schule;
-Organisation und Unterricht;
-Der hospitierte Unterricht;
-Schlussbetrachtung
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Schule
- Das Schulprofil
- Projekte und AGs am Gymnasium
- Lehrerinnen und Lehrer
- Die äußere und innere Gestaltung der Schule
- Organisation und Unterricht
- Mein Stundenplan
- Der hospitierte Unterricht
- Praktische Philosophie: Der Philosophieunterricht in der 7. Klasse
- Unterrichtsprotokolle
- Auswertung
- Philosophie in der Oberstufe
- Unterrichtsprotokolle
- Auswertung
- Eigene Unterrichtsplanung
- Textgrundlage
- Tabellarischer Verlaufsplan
- Praktische Philosophie: Der Philosophieunterricht in der 7. Klasse
- Schlussbetrachtung
- Literaturangabe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Fachpraktikumsbericht gibt Einblicke in die Erfahrungen des Autors während eines fünfwöchigen Praktikums an einem rechtsrheinischen Gymnasium in Köln. Der Bericht fokussiert auf den Philosophieunterricht und die praktische Anwendung der Philosophie in der Sekundarstufe I.
- Kennenlernen des Faches Philosophie, insbesondere der Praktischen Philosophie in der Unterstufe
- Gewinnung eines generellen Eindrucks von Unterrichten, wie z.B. Lehrerrolle, Methoden der Wissensvermittlung und Motivierung
- Reflexion über die eigene Unterrichtsplanung und Durchsetzung von Stunden im Fach Philosophie
- Bestärkung des Wunsches, Lehrerin zu werden
- Vorstellung der Schule und des Schulprofils mit Schwerpunkt auf den bilingualen Zweig Englisch und das IB Diploma
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beschreibt den Kontext des Praktikums und die Erwartungen des Autors. Das Kapitel "Vorstellung der Schule" bietet einen Überblick über die Struktur und das Schulprofil des Gymnasiums. Der Abschnitt "Organisation und Unterricht" fokussiert auf den Stundenplan des Praktikanten. Der Schwerpunkt des Berichts liegt auf dem "hospitierten Unterricht", wo die Erfahrungen mit dem Philosophieunterricht in der 7. Klasse und der Oberstufe beleuchtet werden. Das Kapitel "Eigene Unterrichtsplanung" zeigt die Konzeption und Umsetzung einer eigenen Unterrichtseinheit. Die Schlussbetrachtung fasst die Erfahrungen und Erkenntnisse des Praktikums zusammen.
Schlüsselwörter
Fachpraktikum, Philosophie, Praktische Philosophie, Sekundarstufe I, Gymnasium, Schulprofil, Bilingualer Zweig, IB Diploma, Unterrichtsplanung, Lehrerrolle, Wissensvermittlung, Motivierung.
- Quote paper
- Sina Klar (Author), 2009, Emotionen als Thema der "Praktischen Philosophie" in der Sek. I, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340662