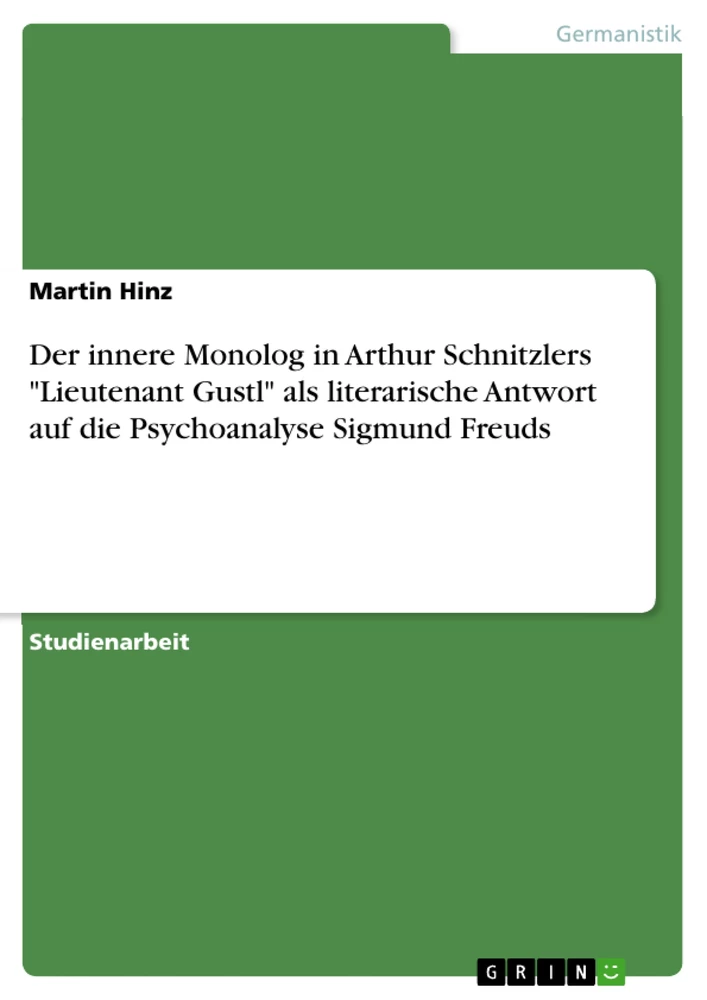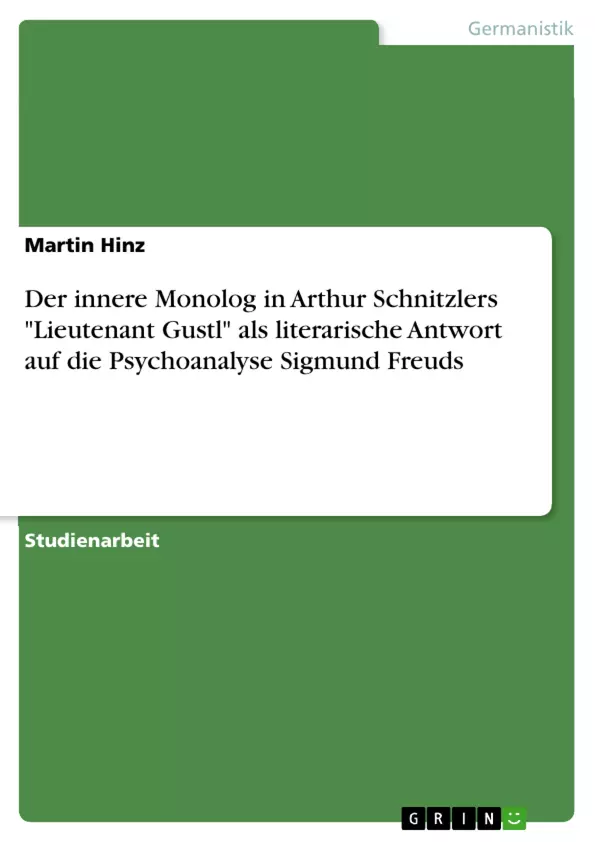Möchte man sich in einer klassisch literaturwissenschaftlichen Methodik einem Texte nähern, so ergeben sich verschiedene Ansätze dies zu tun. Im Allgemeinen unterscheidet man drei große Theoriefelder, die textimmanenten Ansätze, die kulturwissenschaftlichen Theorien und schließlich die interdisziplinären Richtungen, hier vorzugsweise der
psychoanalytische Interpretationsansatz.
Ziel dieser Hausarbeit wird sein diesen letztgenannten auf Arthur Schnitzlers Novelle "Lieutenant Gustl" anzuwenden. Die psychoanalytische Literaturwissenschaft beschäftigt sich ihrerseits mit einem Gros an Möglichkeiten den kreativen Werkprozess, die Motivgestaltung, die Rezeptionsmodelle und die Psyche und Intentionen der handelnden Personen zu deuten.
Im Verlauf dieser Arbeit werde ich zunächst die Parallelen in den Vitae von Arthur Schnitzler und Sigmund Freud gegenüberstellen, da hier signifikante Wechselwirkungen in der Entstehung des Inneren Monologs in der Novelle liegen. Ich werde den Inneren Monolog genauer bezüglich seiner Einflüsse aus der Literatur untersuchen und aufzeigen, wie die Erzähltechnik den Bewusstseinsstrom transportiert, um schließlich darauf zurückzukommen, inwieweit die Psychoanalyse Sigmund Freuds Schnitzler inspiriert hat. Kernstück dieser Hausarbeit wird der Versuch einer psychoanalytisch inspirierten Interpretation des Charakters Gustls und der Suche nach einer durch die Theorien Freuds beeinflusster Motivgestaltung in der Novelle sein.
Es wird ferner die Frage aufgeworfen, ob es sich bei Gustl um einen im Grunde harmlosen, nur durch Standesvorurteile verwirrten, einfältigen, jungen Mann handelt, oder ob sein Seelenleben durch Ausbrüche von unkontrollierten Affekten
bereits pathologische Dimensionen aufweist.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Freud und Schnitzler
- II.I Parallelen der Vitae
- II.II Hypnoseexperimente
- III. Der Innere Monolog
- III.I. Literarische Vorbilder
- III.II. Die Erzähltechnik
- IV. Freuds Modell der menschlichen Psyche und Schnitzlers Antwort
- IV.I Der Einfluss der Traumdeutung
- V. Psychoanalytische Deutung
- V.I. Gustl - Ein männlicher Hysteriker?
- VI. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Anwendung des psychoanalytischen Interpretationsansatzes auf Arthur Schnitzlers Novelle „Lieutenant Gustl“. Sie untersucht die Parallelen zwischen den Vitae von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler, um die Entstehung des Inneren Monologs in der Novelle zu beleuchten. Die Arbeit analysiert den Inneren Monolog hinsichtlich seiner literarischen Vorbilder und der Erzähltechnik, um die Darstellung des Bewusstseinsstroms zu verdeutlichen. Darüber hinaus wird der Einfluss der Psychoanalyse Sigmund Freuds auf Schnitzlers Werk beleuchtet.
- Parallelen zwischen den Vitae von Freud und Schnitzler
- Der Innere Monolog als literarische Antwort auf die Psychoanalyse
- Die Rolle der Hypnoseexperimente in der Entwicklung der Psychoanalyse und der Literatur
- Die psychoanalytische Interpretation des Charakters Gustl
- Die Suche nach einer durch Freuds Theorien beeinflussten Motivgestaltung in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die klassische literaturwissenschaftliche Methodik und die drei großen Theoriefelder vor, auf die sich die Arbeit fokussieren wird. Sie führt den psychoanalytischen Interpretationsansatz als Schwerpunkt der Arbeit ein und erläutert die Zielsetzung, die sich auf die Anwendung dieses Ansatzes auf Schnitzlers „Lieutenant Gustl“ konzentriert.
Das zweite Kapitel widmet sich den Parallelen zwischen den Vitae von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler. Es werden die gemeinsamen Stationen ihrer Ausbildung, ihre wissenschaftlichen Interessen und ihre Skepsis gegenüber der Schulmedizin beleuchtet. Die besondere Rolle der Hypnoseexperimente wird hervorgehoben.
Im dritten Kapitel wird der Innere Monolog als literarische Technik genauer betrachtet. Es werden die literarischen Vorbilder und die spezifische Erzähltechnik, die den Bewusstseinsstrom transportiert, analysiert.
Das vierte Kapitel befasst sich mit dem Einfluss der Psychoanalyse Sigmund Freuds auf Schnitzlers Werk. Es wird insbesondere der Einfluss der Traumdeutung auf die Gestaltung des Charakters Gustl untersucht.
Das fünfte Kapitel bietet eine psychoanalytische Deutung des Charakters Gustl. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Gustl ein harmloser, verwirrter junger Mann ist oder ob sein Seelenleben bereits pathologische Dimensionen aufweist.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Psychoanalyse, Innere Monolog, Bewusstseinsstrom, Arthur Schnitzler, Lieutenant Gustl, Sigmund Freud, Hysterie, Traumdeutung, Motivgestaltung, Charakteranalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Psychoanalyse und Arthur Schnitzlers Werk zusammen?
Schnitzlers Novelle "Lieutenant Gustl" gilt als literarische Antwort auf Sigmund Freuds Psychoanalyse, insbesondere durch die Darstellung unbewusster Gedankenströme.
Was ist die Besonderheit des Inneren Monologs in "Lieutenant Gustl"?
Es ist einer der ersten konsequenten Anwendungen des Inneren Monologs in der deutschsprachigen Literatur, um den Bewusstseinsstrom einer Figur unmittelbar abzubilden.
Welche Parallelen gibt es zwischen Schnitzler und Freud?
Beide lebten in Wien, waren Mediziner und teilten Interessen an Hypnose, Hysterie und der Erforschung der menschlichen Psyche, was sich in ihren Biografien widerspiegelt.
Wird Lieutenant Gustl als pathologischer Charakter dargestellt?
Die Arbeit untersucht, ob Gustl lediglich ein durch Standesdünkel verwirrter Mann ist oder ob seine Affektausbrüche bereits pathologische Dimensionen im Sinne Freuds erreichen.
Welchen Einfluss hatte die Traumdeutung auf die Novelle?
Freuds Theorien zur Traumdeutung und zum Unbewussten beeinflussten Schnitzlers Motivgestaltung, insbesondere wie Gustls Ängste und Wünsche im Text zutage treten.
Ist Gustl ein Beispiel für einen "männlichen Hysteriker"?
Ein Kernstück der Analyse ist die psychoanalytische Deutung Gustls als Repräsentant einer männlichen Form der Hysterie, basierend auf den damaligen medizinischen Diskursen.
- Quote paper
- Martin Hinz (Author), 2013, Der innere Monolog in Arthur Schnitzlers "Lieutenant Gustl" als literarische Antwort auf die Psychoanalyse Sigmund Freuds, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340712