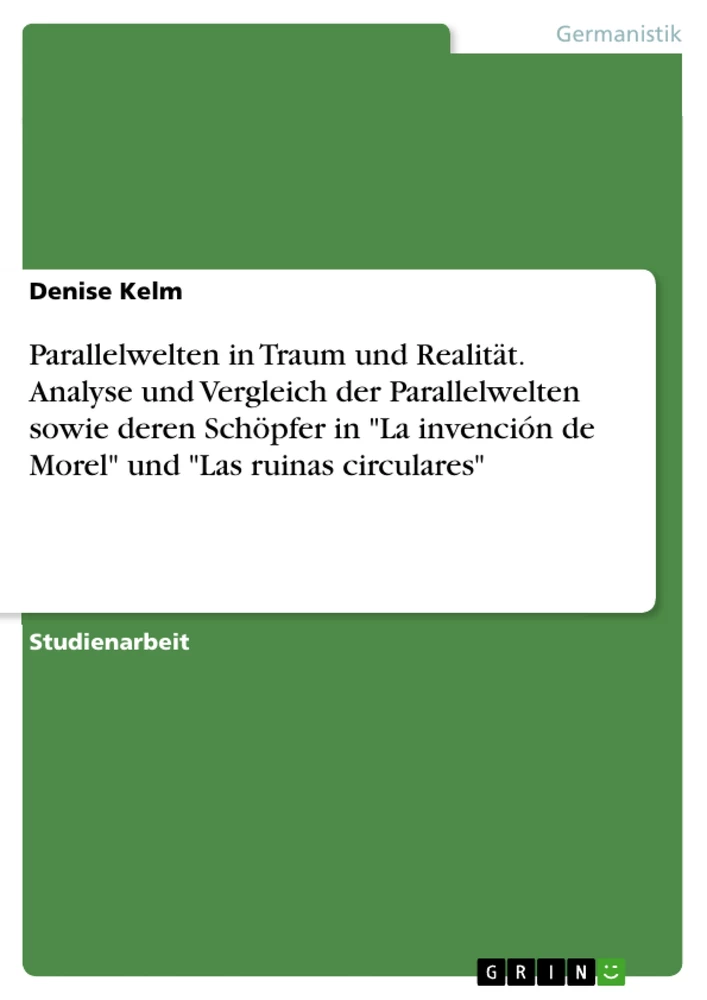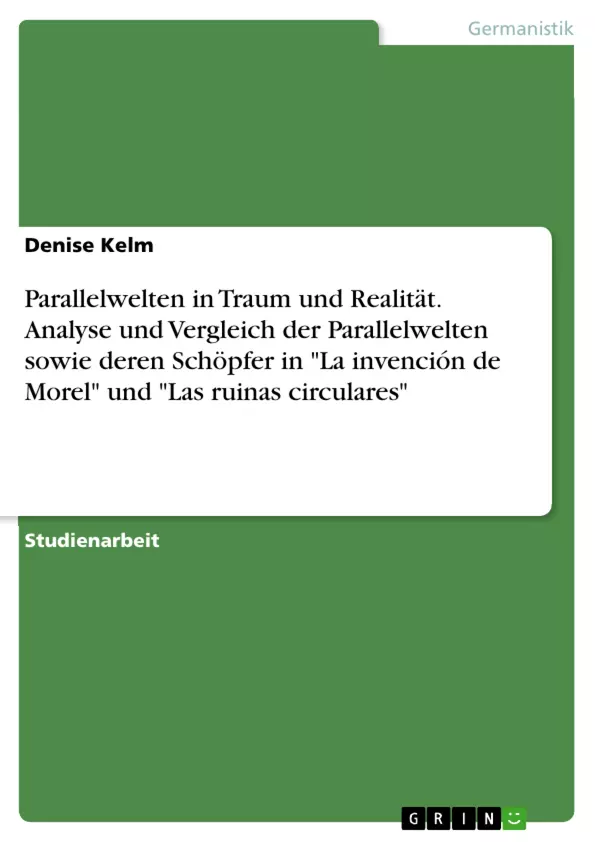Parallelwelten gibt es überall: Eine fremde Kultur mag einem wie eine Parallelwelt erscheinen, ebenso die Diegese eines Buches, eines Videospieles oder der Inhalt eines Traums. Doch wie werden Parallelwelten in der Literatur, speziell in der argentinischen Literatur, präsentiert? Wer schafft diese Welten, inwiefern sind sie im Werk eine parallele Realität oder nur eine Illusion? All diese Fragen sollen im Verlauf dieser Hausarbeit an zwei Prosawerke der argentinischen Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts gestellt werden: "La invención de Morel" und "Las ruinas circulares".
Das erste Werk, der Roman "La invención de Morel", wurde im Jahr 1940 von Adolfo Bioy Casares veröffentlicht. Es handelt von einem juristisch Verfolgten, der sich auf eine verlassene Insel flüchtet und dort plötzlich den menschlichen Projektionen eines von den Gezeiten angetriebenen Generators gegenüber steht, die wie ein Film immer wieder die Handlungen einer aufgezeichneten Woche ausführen.
Das zweite Werk, die 1944 von Jorge Luis Borges als Teil der Geschichtensammlung Ficciones veröffentlichte Kurzgeschichte "Las ruinas circulares" handelt von einem Mann, der sich in einer kreisförmigen Ruine hinlegt und in seinen Träumen einen Menschen schafft, den er als seinen Sohn betrachtet und schließlich in die außerhalb des Traumes stehende Wirklichkeit überführt.
In den ersten beiden Kapiteln dieser Arbeit sollen zunächst die Begriffe Parallelwelt sowie Schöpfer und Gott genauer betrachtet und definiert werden mit dem Ziel, die in den literarischen Werken vorkommenden Parallelwelten und jene, die sie kreieren, umfassend zu analysieren. Im dritten Kapitel richtet sich der Fokus auf den Roman "La invención de Morel" und es werden die parallele Realität der Projektionen sowie Morel und der Verfolgte in ihrer Rolle als Schöpfer und Gott betrachtet. In Kapitel vier soll das selbe Vorgehen auf die Kurzgeschichte "Las ruinas circulares" angewendet werden: Inwiefern kann der Traum als Parallelwelt angesehen werden und handelt es sich bei dem Träumenden eher um einen Schöpfer oder um einen Gott?
Ziel des fünften Kapitels ist es, die Parallelweltphänomene sowie deren Schöpfer aus beiden Werken zu vergleichen und die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Dabei sollen auch Fragen geklärt werden wie: Welcher Zusammenhang besteht zwischen einer Parallelwelt und der Realität? Wie können Parallelwelten beschaffen sein und wie erhält man Zugang zu ihnen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des Begriffs Parallelwelt
- Die sozialwissenschaftliche Definition Astleitners
- Die phantastische Definition Kimlers
- Definition der Begriffe Schöpfung, Schöpfer und Gott
- Die Begriffe Schöpfung und Schöpfer
- Definition des Begriffs Gott
- Die einsame Insel als Parallelwelt in La invención de Morel
- Zeit, Grenze und Grenzübergang in die Parallelwelt
- Anwendung von Kimlers Merkmalen von Parallelwelten
- Anwendung von Astleitners Merkmalen von Parallelwelten
- Morel als Schöpferfigur und Gott
- Die Traumwelt in Las ruinas circulares
- Anwendung der Merkmale von Parallelwelten nach Astleitner auf die Traumwelt
- Anwendung der Merkmale von Parallelwelten nach Kimler auf die Traumwelt
- Der Träumer als Schöpferfigur und Gott
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Darstellung von Parallelwelten in zwei Prosawerken der argentinischen Literatur des 20. Jahrhunderts: La invención de Morel und Las ruinas circulares. Ziel ist es, die Begriffe Parallelwelt, Schöpfer und Gott zu definieren und anhand dieser Definitionen die in den beiden Werken vorkommenden Parallelwelten und deren Schöpferfiguren zu analysieren.
- Definition und Analyse des Begriffs Parallelwelt
- Untersuchung der Schöpferfiguren in den beiden Werken
- Vergleich der Parallelwelten und Schöpferfiguren in La invención de Morel und Las ruinas circulares
- Analyse der Beziehung zwischen Parallelwelt und Realität
- Die Rolle von Zeit und Raum in den Parallelwelten
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten beiden Kapitel dieser Arbeit widmen sich der Definition der Begriffe Parallelwelt, Schöpfer und Gott. Dabei werden die sozialwissenschaftliche Definition von Astleitner und die phantastische Definition von Kimler für den Begriff Parallelwelt vorgestellt und erläutert. Im dritten Kapitel wird der Roman La invención de Morel analysiert, wobei die Insel als Parallelwelt betrachtet wird und die Rolle von Morel als Schöpferfigur und Gott beleuchtet wird. Kapitel vier behandelt die Kurzgeschichte Las ruinas circulares und analysiert den Traum als Parallelwelt sowie die Rolle des Träumenden als Schöpfer oder Gott. Das fünfte Kapitel vergleicht die Parallelweltphänomene und deren Schöpferfiguren aus beiden Werken und untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
Schlüsselwörter
Parallelwelt, Schöpfer, Gott, La invención de Morel, Las ruinas circulares, argentinische Literatur, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis Borges, Astleitner, Kimler, Traum, Realität, Projektionen, Generator, Insel, Ruine, Fiktion.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Parallelwelt in der Literatur?
Eine Parallelwelt ist eine Realität, die neben der unsrigen existiert, oft mit eigenen Regeln. Die Arbeit nutzt Definitionen von Astleitner und Kimler zur Analyse.
Worum geht es in "La invención de Morel"?
Ein Flüchtling entdeckt auf einer Insel Projektionen von Menschen, die durch eine Maschine ewig wiederholt werden – eine technologisch erschaffene Parallelwelt.
Welche Rolle spielt der Traum in "Las ruinas circulares"?
In Borges' Kurzgeschichte erschafft ein Mann durch Träume ein menschliches Wesen, nur um am Ende festzustellen, dass er selbst Teil des Traums eines anderen ist.
Was unterscheidet einen "Schöpfer" von einem "Gott" in diesen Werken?
Die Arbeit untersucht, ob die Figuren lediglich Welten kreieren (Schöpfer) oder absolute Macht und religiöse Züge innerhalb dieser Welten tragen (Gott).
Wie erhält man Zugang zu diesen Parallelwelten?
Der Zugang erfolgt in den analysierten Werken entweder durch physische Grenzüberschreitung (Insel) oder durch mentale Prozesse (Träumen).
- Quote paper
- Denise Kelm (Author), 2016, Parallelwelten in Traum und Realität. Analyse und Vergleich der Parallelwelten sowie deren Schöpfer in "La invención de Morel" und "Las ruinas circulares", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340768