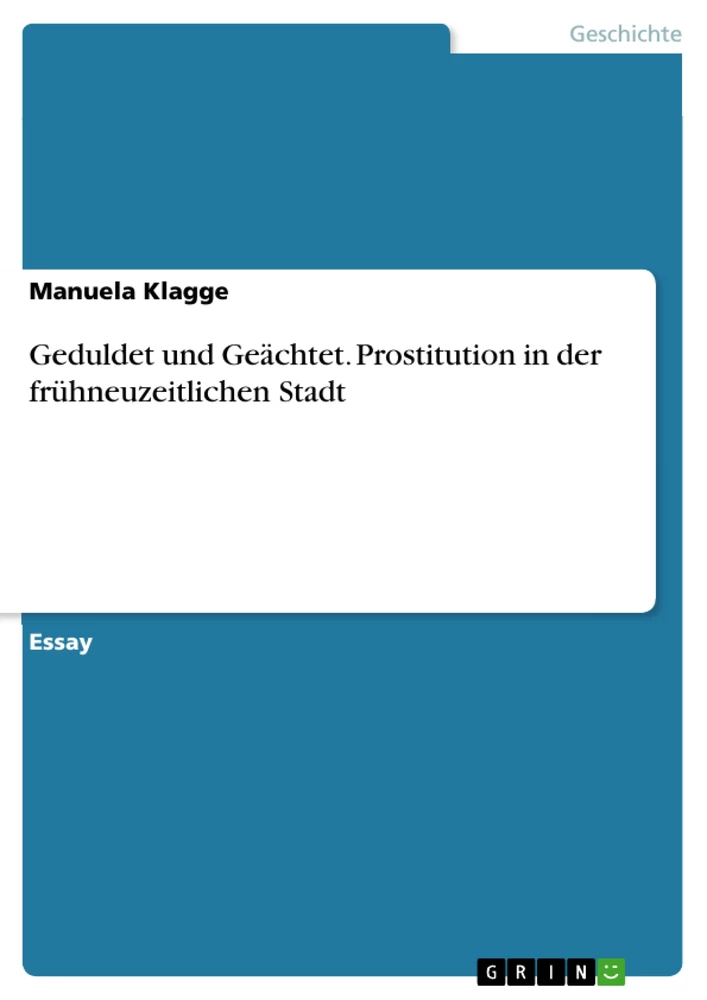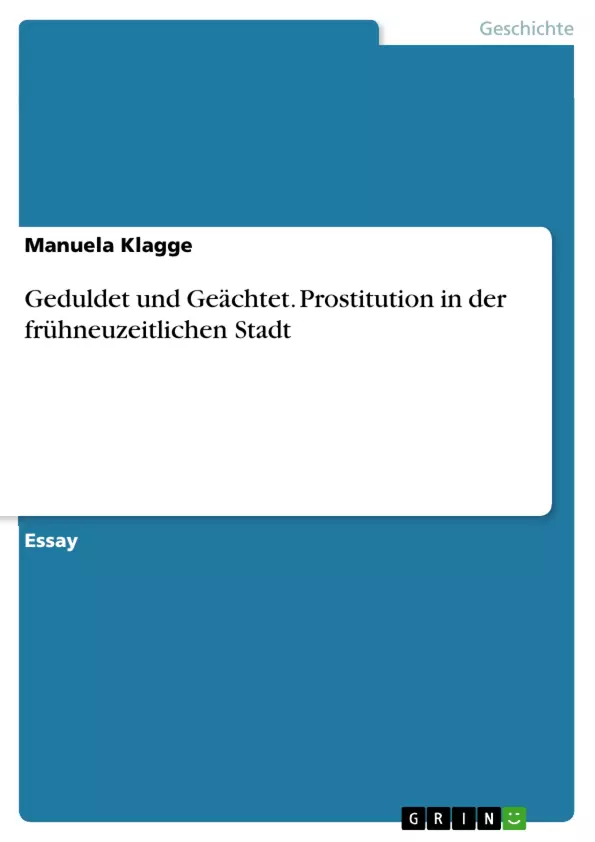Geduldet und geächtet - Prostitution in der frühneuzeitlichen Stadt
Wertedopplung in der Politik
In der Stadt der Frühen Neuzeit war auch die Prostituierte ein Bestandteil des Stadtbildes und galt als legitime Einwohnerin. Laut Peter Schuster besaß im 15. Jahrhundert jede größere Stadt ein städtisches Bordell. Er beschreibt diese Frauenhäuser als Plätze der gesellschaftlichen Zusammenkunft, an denen sich nicht ausschließlich mit dem Gedanken an Geschlechtsverehr getroffen wurde. Ähnlich stellt Lotte van de Pol dies für die Amsterdamer Spielhäuser dar, hier waren die Prostituierten häufig vom Wirt eingeladen, um die Gäste zu animieren, und nicht vordergründig, um ihrem Geschäft nachzugehen.
Bernd Roeck stellt in seinem Buch „Das Frauenhaus“ den Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung einer Stadt und der Zahl der darin tätigen Prostituierten dar. Je größer die Stadt, desto höher die Anzahl der Prostituierten. Auch Franz Irsigler und Arnold Lassotta beschreiben die Prostitution als ein Phänomen, das in jeder entwickelten Gesellschafft vorhanden war, des Weiteren zählen sie die fortschreitende Urbanisierung zu den Ausgangspunkten für die wachsende Prostitution.
Im Folgenden werde ich die Prostitution im städtischen Umfeld der Frühen Neuzeit beleuchten. Dabei werde ich auf die doppelwertige Haltung der Räte und der Einwohner gegenüber den Prostituierten eingehen. Denn wie waren die gesellschaftliche Eingliederung und die soziale Ausgrenzung der Prostituierten gleichzeitig möglich? Dazu werde ich mich insbesondere mit der Schutzpolitik, die zur Sicherheit der Frauen angestrebt wurde, befassen. Auch die sozialtopographische Ansiedlung der Prostituierten und die Kleidungsvorschriften denen sie unterworfen waren, werden einen Einblick in die ambivalente Haltung der Stadträte geben.
Gesellschaftlicher Nutzen und soziale Verachtung
Am Ende des 15. Jahrhunderts legten die Stadträte eine zwiespältige Politik gegenüber den Prostituierten an den Tag. Einerseits verfolgten sie eine Integrations- andererseits eine Ausgrenzungspolitik ihnen gegenüber. Der Rat befand sich, wie unter anderem Beate Schuster schildert, in der Rolle des Friedenssicherers in der Stadt. Das bedeutet, dass allen Einwohnern (nicht nur den Bürgern!) ein friedliches Leben gesichert werden sollte. Zu diesem Zweck wurden zahlreiche Regeln und Normen festgelegt, für deren Befolgung der Rat Sorge zu tragen hatte. Die frühneuzeitliche Stadt beherbergte viele Einwohner. Darum dürfte es, auch aus Mangel an genügend Ordnungskräften, ein schwieriges Unterfangen gewesen sein, diese Sicherheit zu gewährleisten.
Frauen betraf dieser Schutz in zweifacher Weise. Zum Einen sollte Übergriffen auf „ehrbare“ Frauen, das heißt vor allem auf bürgerliche und Jungfrauen, vorgebeugt werden. Denn auf Grund der langen Gesellenzeit war das Heiratsalter der Männer in der Frühen Neuzeit sehr hoch, da sie zunächst eine gewisse ökonomische Grundlage erwirtschaften mussten, bevor eine Heirat und Familiengründung möglich war. Irsigler und Lassotta rechnen die Zahl der Bevölkerung, die keine Möglichkeiten zum Heiraten besaß auf 30 Prozent. In der Frühen Neuzeit galt die Ehe als einzig legitimer Platz, an dem Geschlechtsverkehr stattfinden durfte, in Frauenhäusern konnten die Männer ihren sexuellen Trieben somit ein Ventil geben. Die institutionalisierte Prostitution hatte ihren hohen gesellschaftlichen Wert erhalten, weil die Frauen nicht belästigt oder sogar vergewaltigt werden würden, so der Plan der Stadträte. Das Frauenhaus galt als Ort zur Erziehung der Jugend, da hier die Sexualität kontrolliert werden konnte. Deshalb durften Gesellen, unverheiratete Männer, Fremde und Studenten auch unbescholten ins Bordell gehen.
Die zweite Frauengruppe, die vor allem gegen Gewalttaten geschützt werden sollte, waren die Prostituierten. Die Städte nahmen sie dazu unter ihren Schutz und unterstellten sie zunächst dem Scharfrichter oder einem Bediensteten der Stadt, dieser erhielt einen Teil des Gewinnes oder eine festgelegte Summe von den Prostituierten als Lohn. Der Scharfrichter (bzw. der Bedienstete) war gleichzeitig für die Instandhaltung des Gebäudes und für die Versorgung der Prostituierten zuständig. Später wurden Frauenwirte und Wirtinnen eingestellt, die vor dem Rat einen Eid ablegen mussten, der unter anderem diese Aufgaben mit einschloss. Vorschriften des Rates, die aussagten, dass Prostituierte nicht vergewaltigt, verletzt oder misshandelt werden durften und ein Anrecht auf ihren Lohn hatten, existierten ebenfalls. Dennoch sind Gewalttaten gegen Frauenhäuser und gegen Prostituierte überliefert, was Peter Schuster mit einigen Beispielen belegt. Das untermauert die Vermutung, dass weder der städtischen Schutzmaßnahmen, noch die Frauenwirte in der Lage waren, die Prostituierten wirklich zu schützen. Auch zeigen Irsigler und Lassotta, dass sich die Prostituierten außerhalb des Frauenhauses in Gruppen organisierten, wodurch sie einigermaßen sicher waren.
Auch wenn, wie die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, die Prostituierten in das Rechtssystem der Städte integriert waren, so wurden sie Sozialtopographisch dennoch ausgegrenzt.
Der Platz der Frauenhäuser befand sich fast immer am Rande der Stadt, meist nahe dem Scharfrichterhaus oder sogar darin. Ziel dieser abgegrenzten Lage war einerseits, dass die Prostituierten somit von den ehrbaren Bewohnern der Stadt abgeschottet waren und diese nicht belästigen konnten. Andererseits senkte ein Bordell in der Nachbarschaft den Wohnwert der entsprechenden Gebiete, woran die Stadt sicher nicht interessiert war. Doch die zunehmende Bebauung der Städte verringerte den Abstand der Wohnungen zu den Frauenhäusern, oftmals rückten diese dadurch doch aus der Peripherie der Stadt.
Die Bürger, die an zentralen Orten der Stadt wohnten, zeigten mit ihrer Wohnlage ihre hohe soziale Stellung in der städtischen Hierarchie. Je weiter die Wohnsitze von diesen Orten entfernt lagen, desto geringer war die gesellschaftliche Stellung der in diesen Haushalten lebenden Personen. Im Falle der Scharfrichter und der Prostituierten zeigt die komplette Randlage die verachtete gesellschaftliche Position, die beide Gruppen innehatten.
Trotz der Frauenhäuser gelang es der Obrigkeit nicht, die Prostitution an einen festgelegten Ort zu zentralisieren. Immer wieder wurden freie oder heimliche Prostituierten aus der Stadt oder in das Frauenhaus verwiesen. Es gab auch viele private Bordelle in den Städten, doch deren dauerhafte Entfernung hätte mehr Ordnungshüter gebraucht, als zur Verfügung standen. Diese Einrichtungen waren auch gerade deshalb ein Dorn im Auge der Obrigkeit, weil sie sich nicht kontrollieren ließen. Zu Konzilen, Reichstagen, Jahrmärkten und anderen Großereignissen kamen viele Prostituierte in die Stadt geströmt, diese wurden dann unter die Aufsicht des Frauenwirts gestellt und mussten Abgaben an ihn leisten. Anschließend mussten sie die Stadt wieder verlassen, wurden aber vor den Stadttoren toleriert.
Die Frauenhäuser hatten sich an die Schließungszeiten aller öffentlichen Einrichtungen zu halten, an kirchlichen Feiertagen und zur Fastenzeit mussten sie geschlossen bleiben. Das verdeutlicht, dass die Frauenhäuser in das gesellschaftliche Leben der Stadt eingegliedert waren und keine Sonderstellung einnahmen, denn diese Normen galten für alle Einwohner.
Zur Unterscheidung von den ehrbaren Frauen der Stadt wurden den Prostituierten Kleiderordnungen auferlegt, sie waren zwar territorial und zeitlich verschieden, doch stigmatisierend wirkten die darin enthaltenen Bestimmungen immer. In ihnen waren bestimmte Farben vorgesehen, mit denen sich die Prostituierten kennzeichnen mussten (meistens rot, gelb oder grün oder das Wappen der jeweiligen Stadt), später gingen jedoch auch viel Städte dazu über, ihnen lediglich eine einfache Kleidung vorzuschreiben (meist einen kurzen Mantel). Luxusartikel, das heißt das Tragen von Gold- oder Silberschmuck, sowie aufwändige Kleiderverzierungen, waren für sie verboten. Dies wertet Beate Schuster als äußerliche Diskriminierung, die die Prostituierten gesellschaftlich hinab setzte.
Integriert und Ausgegrenzt – Eine Zusammenfassung
Mit den Frauenhausgründungen um 1400 institutionalisierten die Städte die Prostitution und verorteten sie an bestimmte Plätze in der Stadt. Obrigkeitliche Bestimmungen sollten den Schutz der Gäste und der Prostituierten in den Frauenhäusern sichern. Das sollte sowohl Fremde als auch unverheiratete Einwohner und Bürger der Stadt animieren, die Frauenhäuser aufzusuchen.
Im Zuge der reformatorischen Sozialdisziplierung der Bevölkerung wurde dann ab dem 16. Jahrhundert die Prostitution verboten. Dennoch gelang es nirgendwo, die Prostituierten aus der Stadt zu vertreiben, denn diese agierten im Verborgenen weiter. Beate Schuster schreibt, dass die Bevölkerung die Frauenhäuser nie in Frage gestellt hatte, und belegt das damit, dass keine Aktionen gegen die Einrichtungen überliefert sind, die den Rat zu einer Schließung gedrängt hätten. Doch waren es auch die Bürger, die eine Abgrenzung der Prostitution gefordert hatten, denen mittels Kleidervorschriften und Zentralisierungen auf bestimmte, vorwiegend abgelegene, Orte nachgekommen wurde. Dennoch waren sie in das städtische Rechtssystem integriert und standen unter städtischen Schutz. Dass die Prostituierten, wie jeder andere Einwohner, Pflichten nachkommen mussten, wie Hilfe bei der Heuernte oder bei Stadtbränden, bestätigt die Tatsache, dass sie als legitime Einwohner behandelt wurden. Letztendlich gehörten sie zwar in das städtische System, doch nicht in die städtische Gemeinschaft, denn durch zahlreiche Maßnahmen wurden sie öffentlich Gebrandmarkt und ausgegrenzt.
Weiterführend wäre eine Analyse darüber interessant, wie die Städte auf dennoch vorkommende Vergewaltigungen „ehrbarer“ Frauen reagierten, da die Räte dem ja durch die Institutionalisierung der Prostitution vorbeugen wollten. Auch eine Studie aus heutiger Sicht wäre denkbar, indem die Gerichtsakten auf diese Fälle hin untersucht und ausgewertet werden, um zu sehen wie hoch die Vergewaltigungszahlen dennoch waren.
Literaturverzeichnis
Irsigeler, Franz/ Lassotta, Arnold: Bettler und Dirnen, Dirnen und Henker: Randgruppen und Außenseiter in Köln 1300-1600. Köln, 1984.
Schuster, Beate: Die freien Frauen. Dirnen und Frauenhäuser im 15. und 16. Jahrhundert. (=„Geschichte und Geschlechter“, Band 12). Frankfurt/Main, New York, 1995.
Schuster, Peter: Das Frauenhaus. Städtische Bordelle in Deutschland 1350 bis 1600. Paderborn, München, Wien, Zürich, 1992.
Pol, Lotte van de: Der Bürger und die Hure. Das sündige Gewerbe im Amsterdam der Frühen Neuzeit. (=„Geschichte und Geschlechter“, Sonderband). Frankfurt/Main, 2006.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Textes "Geduldet und geächtet - Prostitution in der frühneuzeitlichen Stadt"?
Der Text untersucht die Rolle der Prostitution in Städten der Frühen Neuzeit, insbesondere die ambivalente Haltung der städtischen Räte und Einwohner gegenüber Prostituierten. Er beleuchtet, wie Prostituierte sowohl gesellschaftlich integriert als auch ausgegrenzt wurden.
Welche Argumente werden für die Duldung der Prostitution in Städten der Frühen Neuzeit angeführt?
Die Duldung der Prostitution wurde oft mit dem Argument der Friedenssicherung begründet. Man glaubte, dass Frauenhäuser Übergriffe auf "ehrbare" Frauen verhindern und unverheirateten Männern ein Ventil für ihre sexuellen Triebe bieten würden. Prostitution galt als Mittel zur Kontrolle der Sexualität und zur Erziehung der Jugend.
Wie wurden Prostituierte in der städtischen Gesellschaft integriert?
Prostituierte waren in das Rechtssystem der Städte integriert und standen unter städtischem Schutz. Es gab Vorschriften, die sie vor Gewalt schützten und ihr Recht auf Lohn garantierten. Sie mussten auch Pflichten wie Hilfe bei der Heuernte oder bei Stadtbränden erfüllen, was ihre Anerkennung als legitime Einwohner unterstreicht.
Wie wurden Prostituierte in der städtischen Gesellschaft ausgegrenzt?
Trotz ihrer Integration ins Rechtssystem wurden Prostituierte sozialtopographisch ausgegrenzt. Frauenhäuser befanden sich meist am Stadtrand, und Prostituierte unterlagen Kleiderordnungen, die sie stigmatisierten und von "ehrbaren" Frauen unterschieden.
Welche Rolle spielten Frauenhäuser in der frühneuzeitlichen Stadt?
Frauenhäuser waren institutionalisierte Bordelle, die von der Stadt betrieben oder beaufsichtigt wurden. Sie dienten als Orte der gesellschaftlichen Zusammenkunft und der kontrollierten Sexualität. Die Stadträte erhofften sich, dadurch Ordnung und Sicherheit in den Städten zu gewährleisten.
Welche Kleidungsvorschriften galten für Prostituierte?
Prostituierte mussten sich durch bestimmte Farben (rot, gelb, grün oder das Wappen der Stadt) oder einfache Kleidung von "ehrbaren" Frauen unterscheiden. Luxusartikel und aufwändige Kleiderverzierungen waren ihnen verboten.
Wann wurde die Prostitution verboten und welche Auswirkungen hatte das Verbot?
Im Zuge der reformatorischen Sozialdisziplierung wurde die Prostitution ab dem 16. Jahrhundert verboten. Das Verbot konnte die Prostitution jedoch nicht vollständig beseitigen, sondern trieb sie in den Untergrund.
Welche weiterführenden Forschungsfragen werden im Text angedeutet?
Der Text schlägt vor, die Reaktionen der Städte auf Vergewaltigungen "ehrbarer" Frauen trotz der Institutionalisierung der Prostitution zu analysieren. Außerdem wird eine Untersuchung der Gerichtsakten aus heutiger Sicht vorgeschlagen, um die tatsächliche Häufigkeit von Vergewaltigungen zu ermitteln.
Welche Quellen werden im Literaturverzeichnis genannt?
Das Literaturverzeichnis nennt Werke von Franz Irsigler/ Arnold Lassotta, Beate Schuster, Peter Schuster, Lotte van de Pol und Bernd Roeck, die sich mit Prostitution, Frauenhäusern und Randgruppen in der Frühen Neuzeit auseinandersetzen.