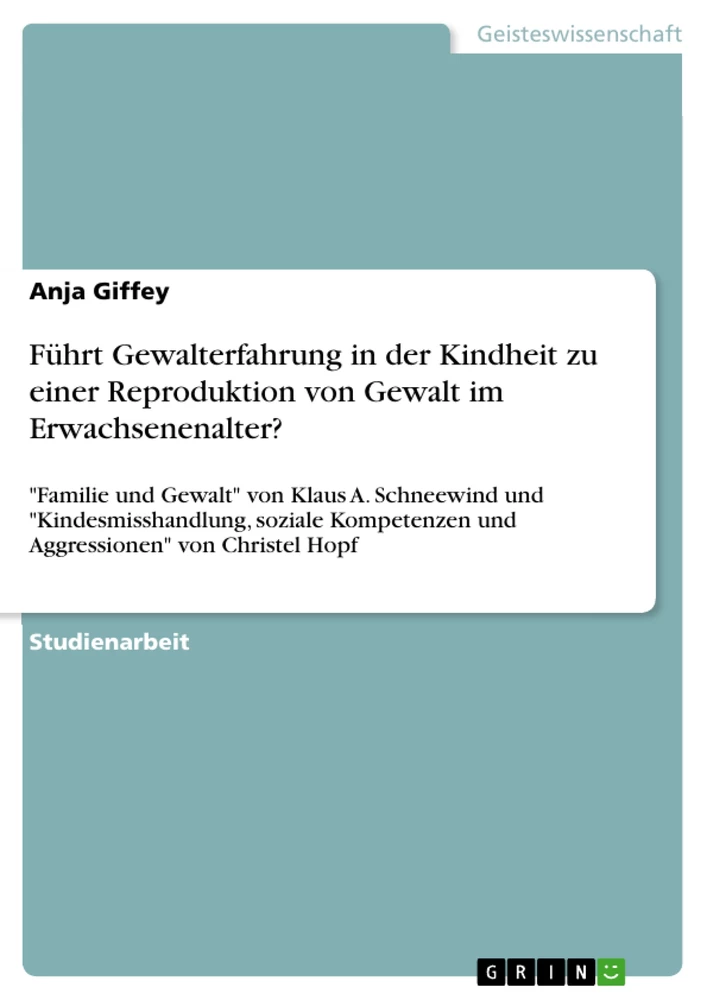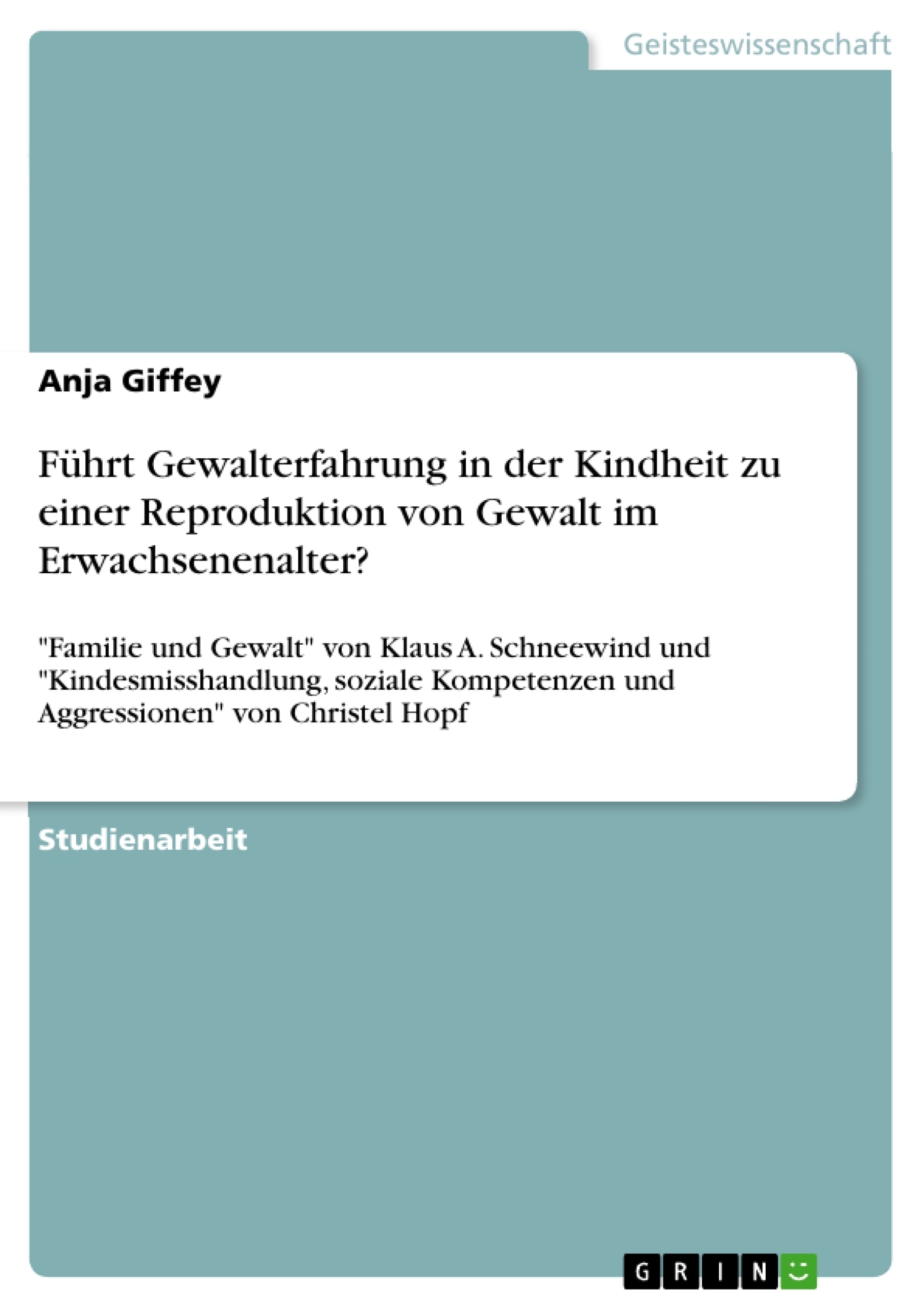Unter Verwendung von zwei ausgewählten Texten soll auf das aktuelle Phänomen Gewalt in der Familie eingegangen und das Problem Kindesmisshandlung thematisiert werden. Am Ende der Arbeit wird dann explizit der These nachgegangen, ob familiäre Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer Reproduktion von Gewalt im Erwachsenenalter beitragen und weitergehende Überlegungen zu dieser Thematik angestellt.
Fassungslos liest man Zeitungsberichte, die über Gewalt in der Familie informieren. Sie lösen umso mehr Betroffenheit aus, wenn der Missbrauch in unserem Bekannten- und Familienkreis stattfindet. Die Familie, die für uns der Ort der Vertrautheit, der Geborgenheit und der Sicherheit ist, wird plötzlich zum 'Tatort'. Vor allem Kinder werden Jahr für Jahr Opfer häuslicher Gewalt. Die Täter, bei denen es sich meistens um enge Bezugspersonen handelt, schlagen zu - mit Gürteln und Stöcken, Kleiderbügeln und Schuhen, mit der Handfläche oder mit der Faust. Die einen prügeln spontan und eruptiv, die anderen systematisch und rituell. Mit dem Ausdruck: „Mir ist die Hand ausgerutscht“ rechtfertigen sie dann ihr Vergehen und sprechen sich selbst von Schuld frei. Aber wir alle wissen: Hände rutschen nicht einfach aus. Die Gewalt gegen die wehrlosen Mädchen und Jungen hat viele Ursachen: Überforderung, Frustration, Hass, Sadismus, emotionale Not. Diese schwerwiegenden Erfahrungen, die in diesem Zusammenhang gemacht werden, haben auf die kindliche Sozialisation einen bedeutsamen Einfluss. Sie sind beispielsweise für die Entwicklung der kindlichen Kooperationsbereitschaft, der sozialen Kompetenzen und der moralischen Entwicklung von Kindern von größter Bedeutung. Ein Leben lang leiden die Opfer an ihren traumatischen Erlebnissen.
Um also zu verstehen, wie Kinder in unsere Gesellschaft hineinwachsen, ist es notwendig sich mit ihren frühen sozialen Erfahrungen und Beziehungen zu beschäftigen. Fragen, wie „Ist die 'gesunde Ohrfeige' eine autoritäre Erziehungsmaßnahme oder schon der erste Schritt in Richtung Gewalt gegen ein Kind?“, machen auf die Problematik dieses Phänomens aufmerksam. Viele Eltern, Erziehungsfachleute oder Kinderärzte kennen die Antwort.
“Wo aber liegt die Grenze zwischen 'autoritären Erziehungsmaßnahmen' und Kindesmisshandlung?“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zusammenfassung der Beiträge
- 2.1. „Familie und Gewalt“
- 2.2. „Kindesmisshandlung, soziale Kompetenzen und Aggressionen“
- 3. Reflexion
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen von Gewalt in der Familie, insbesondere Kindesmisshandlung. Ziel ist es, anhand zweier ausgewählter Texte das Problem zu beleuchten und die Frage zu beantworten, ob familiäre Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer Reproduktion von Gewalt im Erwachsenenalter beitragen.
- Gewalt in der Familie als gesellschaftliches Problem
- Formen und Ursachen von Kindesmisshandlung
- Der Einfluss von Gewalt in der Kindheit auf die spätere Entwicklung
- Differenzierung zwischen Erziehungsmaßnahmen und Misshandlung
- Theoretische Ansätze zur Erklärung familiärer Gewalt
Zusammenfassung der Kapitel
2.1. „Familie und Gewalt“: Klaus A. Schneewind analysiert die Zunahme von Jugendgewalt und deren Zusammenhang mit Desintegration der Familie und Defiziten in der Erziehung. Er unterscheidet zwischen struktureller und personaler Gewalt, wobei er sich auf letztere konzentriert und die unterschiedliche Intensität und gesellschaftliche Akzeptanz von gewalthaften Handlungen hervorhebt. Schneewind beleuchtet verschiedene Formen familiärer Gewalt (Partnergewalt, Eltern-Kind-Gewalt etc.) und präsentiert kontextualistisch-systemische Modelle und die Analyse biopychosozialer Risiko- und Schutzfaktoren als Erklärungsansätze. Der Schwerpunkt liegt auf Eltern-Kind-Gewalt, inklusive Kindesmisshandlung (körperlich, seelisch, sexuell, Vernachlässigung), wobei zwischen körperlicher Züchtigung und Misshandlung differenziert wird. Schließlich präsentiert er erschreckende empirische Befunde zur Prävalenz elterlicher Gewalt und deren weitreichenden Folgen für die Entwicklung von Kindern.
Schlüsselwörter
Gewalt in der Familie, Kindesmisshandlung, Jugendgewalt, Eltern-Kind-Gewalt, Partnergewalt, strukturelle Gewalt, personale Gewalt, Erziehungsmaßnahmen, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, soziale Kompetenzen, kognitive Entwicklung, Traumatisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Familie und Gewalt"
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Phänomen von Gewalt in der Familie, insbesondere Kindesmisshandlung. Sie analysiert anhand zweier Texte die Frage, ob familiäre Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer Reproduktion von Gewalt im Erwachsenenalter beitragen.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit bezieht sich auf zwei ausgewählte Texte. Ein Text wird explizit als "Familie und Gewalt" von Klaus A. Schneewind genannt, der die Zunahme von Jugendgewalt und deren Zusammenhang mit Desintegration der Familie und Defiziten in der Erziehung analysiert. Der zweite Text wird mit "Kindesmisshandlung, soziale Kompetenzen und Aggressionen" betitelt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte von Gewalt in der Familie, darunter: Gewalt in der Familie als gesellschaftliches Problem, Formen und Ursachen von Kindesmisshandlung, den Einfluss von Gewalt in der Kindheit auf die spätere Entwicklung, die Differenzierung zwischen Erziehungsmaßnahmen und Misshandlung, und theoretische Ansätze zur Erklärung familiärer Gewalt (kontextualistisch-systemische Modelle und die Analyse biopychosozialer Risiko- und Schutzfaktoren).
Was sind die zentralen Ergebnisse des Textes "Familie und Gewalt"?
Klaus A. Schneewind analysiert in diesem Text die Zunahme von Jugendgewalt im Kontext von familiärer Desintegration und Erziehungsmängeln. Er unterscheidet zwischen struktureller und personaler Gewalt, konzentriert sich auf letztere und hebt die unterschiedliche Intensität und gesellschaftliche Akzeptanz gewalthafter Handlungen hervor. Der Text beleuchtet verschiedene Formen familiärer Gewalt (Partnergewalt, Eltern-Kind-Gewalt) und präsentiert empirische Befunde zur Prävalenz elterlicher Gewalt und deren Folgen für die Entwicklung von Kindern. Es wird explizit zwischen körperlicher Züchtigung und Misshandlung differenziert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gewalt in der Familie, Kindesmisshandlung, Jugendgewalt, Eltern-Kind-Gewalt, Partnergewalt, strukturelle Gewalt, personale Gewalt, Erziehungsmaßnahmen, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, soziale Kompetenzen, kognitive Entwicklung, Traumatisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, eine Zusammenfassung der Beiträge ("Familie und Gewalt" und "Kindesmisshandlung, soziale Kompetenzen und Aggressionen"), eine Reflexion und ein Literaturverzeichnis.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, das Problem der Gewalt in der Familie, insbesondere der Kindesmisshandlung, anhand der ausgewählten Texte zu beleuchten und zu untersuchen, ob familiäre Gewalterfahrungen in der Kindheit zu einer Reproduktion von Gewalt im Erwachsenenalter beitragen.
- Quote paper
- Anja Giffey (Author), 2008, Führt Gewalterfahrung in der Kindheit zu einer Reproduktion von Gewalt im Erwachsenenalter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340956