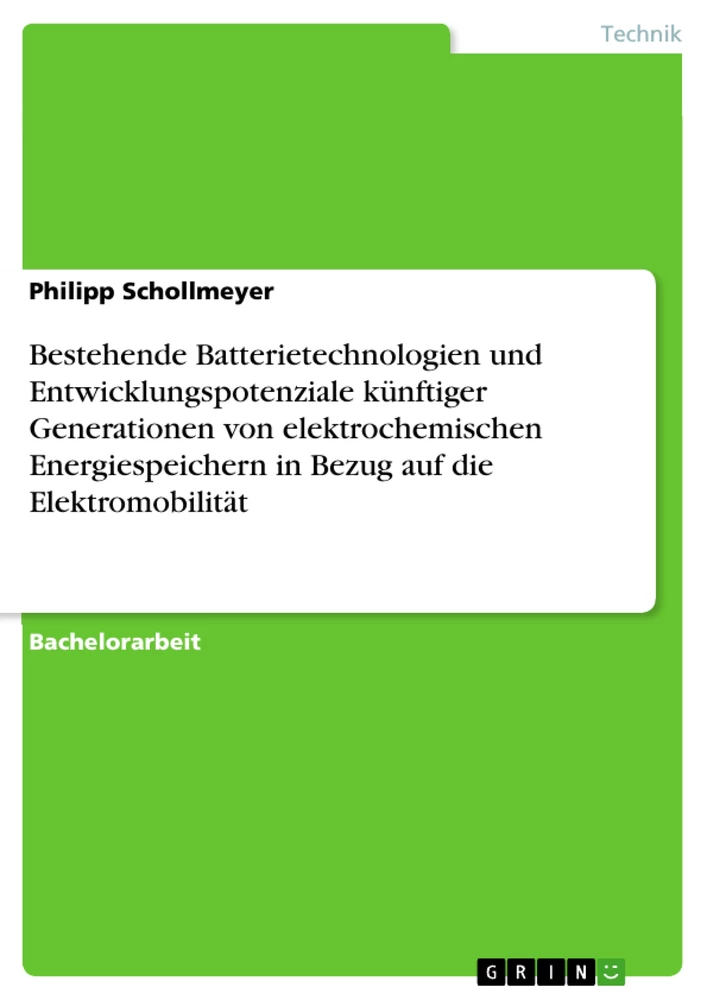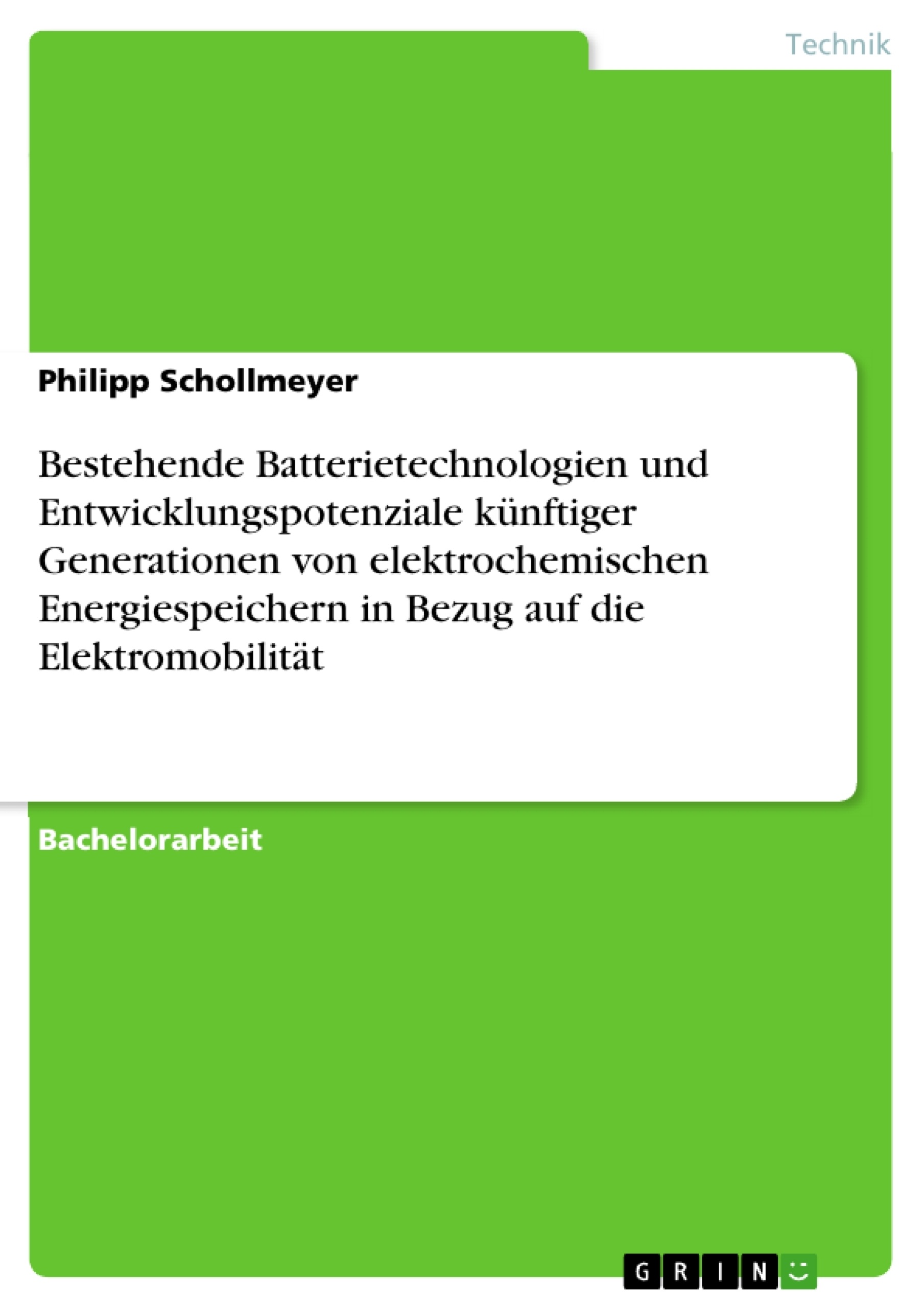Die kostengünstige Speicherung einer ausreichend großen Energiemenge stellt bzgl. einer breiten Marktdurchdringung der Elektromobilität eine große Hürde dar. Die vorliegende Arbeit setzt sich dabei zu Beginn mit den Anforderungen und Zielwerten für Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen auseinander, die es zu erreichen gilt. So wurde beispielsweise bei der Analyse der Zielwerte eine Lebensdauer von 1.500 Zyklen und eine spezifische Energiedichte von 350 Wh kg−1 auf Zellebene ermittelt.
Die Arbeit betrachtet ausschließlich elektrochemische Energiespeichertechnologien. Diese werden grundlegend vorgestellt und anhand der vorher bestimmten Anforderungszielwerte bewertet. Hierbei zeigten ausgewählte Lithium-Ionen-Systeme eine vorherrschende Stellung unter der Gesamtheit der verschiedenen Batterietechnologien. Die Verwendung von NMC, LFP oder NCA als Kathodenmaterial bietet aktuell die beste Kompromisslösung hinsichtlich der unterschiedlich geforderten Parametergrößen. Ab dem Jahr 2025 bzw. 2030 soll das Lithium-Schwefel- und das Lithium-Luft-System für eine sprunghafte Steigerung der spezifischen Energiedichte und damit auch der erzielbaren Reichweite von Elektrofahrzeugen sorgen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung und Umfang der Arbeit
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Grundlagen
- 2.1 Technologiebeschreibung
- 2.1.1 Primär- und Sekundärzellen
- 2.1.2 Aufbau und Funktionsweise einer elektrochemischen Zelle
- 2.1.3 Hochenergie- und Hochleistungszellen
- 2.1.4 Bauformen von Lithium-Ionen-Zellen
- 2.1.5 Traktionsbatteriesystem
- 2.2 Verfahren zur vergleichenden Bewertung von Fahrzeugen
- 2.2.1 "Neuer Europäischer Fahrzyklus" (NEFZ)
- 2.2.2 "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (WLTP)
- 2.3 Kenngrößen elektrochemischer Energiespeicher
- 2.3.1 Spannungslage, Energie- und Leistungskenndaten
- 2.3.2 C-Rate
- 2.3.3 Zustandsgrößen der Batterie
- 2.3.4 Lebensdauer der Batterie
- 2.4 Vorstellung der verschiedenen elektrochemischen Energiespeicher
- 2.4.1 Blei-Säure-Batterie (PbA)
- 2.4.2 Nickel-Cadmium-Batterie (NiCd)
- 2.4.3 Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH)
- 2.4.4 Lithium-Batteriesysteme
- 2.4.5 Natrium-Schwefel-Batterie (NaS) und Natrium-Nickelchlorid-Batterie (ZEBRA-Batterie)
- 2.4.6 Redox-Flow-Batteriesysteme (RFB)
- 3 Zielsystem
- 4 Vorgehen
- 5 Anforderungsaspekte an das Batteriesystem im Elektrofahrzeug
- 5.1 Einführung
- 5.2 Batterielebensdaueranforderungen von BEVs
- 5.3 Reichweitenanforderungen von BEVs - Energiedichte
- 5.4 Leistungsanforderungen von BEVs - Leistungsdichte und C-Rate
- 5.5 Kostenaspekte der Fahrzeugbatterie
- 5.6 Temperaturanforderungen
- 5.7 Sicherheitsaspekte der Fahrzeugbatterie
- 5.8 Umweltsaspekte
- 5.9 Übersicht der Anforderungsaspekte
- 6 Bewertung der verschiedenen elektrochemischen Energiespeicher
- 6.1 Wässrige Systeme
- 6.1.1 Blei-Säure-Batterie (PbA)
- 6.1.2 Nickel-Cadmium-Batterie (NiCd)
- 6.1.3 Nickel-Metallhydrid-Batterie (NiMH)
- 6.2 Organische Systeme - Lithium-Batteriesysteme
- 6.2.1 Lithium-Cobalt-Oxid-Kathodenmaterial (LCO)
- 6.2.2 Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Kathodenmaterial (NMC)
- 6.2.3 Lithium-Nickel-Cobalt-Aluminium-Kathodenmaterial (NCA)
- 6.2.4 Lithium-Mangan-Spinell-Kathodenmaterial (LMO)
- 6.2.5 Lithium-Eisen-Phosphat-Kathodenmaterial (LFP)
- 6.2.6 Lithium-Titanat-Anodenmaterial (LTO)
- 6.2.7 Lithium-Polymer-Batterie (Li-Po)
- 6.2.8 Lithium-Schwefel-Batterie (Li-S)
- 6.2.9 Lithium-Luft-Batterie (Li-Luft)
- 6.3 Hochtemperatursysteme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelorarbeit analysiert bestehende Batterietechnologien und untersucht das Entwicklungspotenzial zukünftiger Generationen elektrochemischer Energiespeicher im Kontext der Elektromobilität. Ziel ist es, einen Überblick über verschiedene Batterietechnologien zu geben und deren Eignung für den Einsatz in Elektrofahrzeugen zu bewerten.
- Analyse bestehender Batterietechnologien (Blei-Säure, Nickel-Metallhydrid, Lithium-Ionen etc.)
- Bewertung der jeweiligen Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Elektromobilität
- Untersuchung der Entwicklungspotenziale zukünftiger Batteriegenerationen
- Analyse relevanter Kenngrößen wie Energiedichte, Leistungsdichte und Lebensdauer
- Betrachtung von Anforderungsaspekten wie Kosten, Sicherheit und Umweltverträglichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der elektrochemischen Energiespeicher und deren Bedeutung für die Elektromobilität ein. Es beschreibt die Problemstellung, die Zielsetzung der Arbeit und den Aufbau der folgenden Kapitel.
2 Grundlagen: Dieses Kapitel liefert grundlegende Informationen über elektrochemische Zellen, deren Aufbau und Funktionsweise, verschiedene Batterietechnologien und relevante Kenngrößen. Es werden verschiedene Zelltypen detailliert beschrieben, von Blei-Säure-Batterien bis hin zu Lithium-Ionen-Batterien und fortschrittlichen Technologien wie Redox-Flow-Batterien. Ein Schwerpunkt liegt auf den Verfahren zur Bewertung von Elektrofahrzeugen, wie dem NEFZ und WLTP, und der Erläuterung relevanter Batterie-Kenngrößen wie Energiedichte, Leistungsdichte, C-Rate und Lebensdauer. Die umfassende Darstellung dient als Basis für die spätere Bewertung verschiedener Batteriesysteme.
3 Zielsystem: Dieses Kapitel beschreibt vermutlich das spezifische Zielsystem, das im weiteren Verlauf der Arbeit analysiert wird. Es spezifiziert wahrscheinlich die Anforderungen an den Energiespeicher im Hinblick auf ein konkretes Elektrofahrzeug oder eine Anwendung.
4 Vorgehen: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik und das Vorgehen bei der Analyse und Bewertung der verschiedenen Batteriesysteme. Es skizziert wahrscheinlich den methodischen Ansatz der Arbeit und die angewandten Kriterien für die Bewertung der verschiedenen Technologien.
5 Anforderungsaspekte an das Batteriesystem im Elektrofahrzeug: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Anforderungen, die an ein Batteriesystem in einem Elektrofahrzeug gestellt werden. Hier werden Aspekte wie Lebensdauer, Reichweite, Leistung, Kosten, Temperaturbeständigkeit, Sicherheit und Umweltverträglichkeit detailliert erörtert und deren Bedeutung für den erfolgreichen Einsatz im Elektrofahrzeug herausgestellt. Es liefert den Rahmen für die spätere Bewertung der einzelnen Batteriesysteme.
6 Bewertung der verschiedenen elektrochemischen Energiespeicher: Dieses Kapitel stellt eine detaillierte Bewertung verschiedener elektrochemischer Energiespeicher dar, unterteilt nach wässrigen, organischen und Hochtemperatursystemen. Für jede Batterietechnologie werden die spezifischen Eigenschaften, Vorteile und Nachteile im Kontext der Anforderungen aus Kapitel 5 ausführlich diskutiert. Die Synthese der Ergebnisse aus den einzelnen Abschnitten liefert ein umfassendes Bild der jeweiligen Eignung für den Einsatz in der Elektromobilität.
Schlüsselwörter
Elektromobilität, Batterietechnologien, elektrochemische Energiespeicher, Lithium-Ionen-Batterien, Energiedichte, Leistungsdichte, Lebensdauer, C-Rate, NEFZ, WLTP, Blei-Säure-Batterie, Nickel-Metallhydrid-Batterie, Kosten, Sicherheit, Umweltverträglichkeit.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Analyse elektrochemischer Energiespeicher für die Elektromobilität
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über elektrochemische Energiespeicher und deren Bedeutung für die Elektromobilität. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine detaillierte Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse bestehender und zukünftiger Batterietechnologien, ihrer Bewertung anhand relevanter Kenngrößen und der Berücksichtigung von Anforderungsaspekten wie Kosten, Sicherheit und Umweltverträglichkeit.
Welche Batterietechnologien werden behandelt?
Das Dokument behandelt eine breite Palette an Batterietechnologien, darunter Blei-Säure-Batterien, Nickel-Cadmium-Batterien, Nickel-Metallhydrid-Batterien, verschiedene Lithium-Batteriesysteme (LCO, NMC, NCA, LMO, LFP, LTO, Li-Po, Li-S, Li-Luft), Natrium-Schwefel-Batterien (NaS), Natrium-Nickelchlorid-Batterien (ZEBRA-Batterien) und Redox-Flow-Batteriesysteme (RFB). Die Technologien werden hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz in Elektrofahrzeugen analysiert.
Welche Kenngrößen werden zur Bewertung der Batterien herangezogen?
Zur Bewertung der verschiedenen Batteriesysteme werden wichtige Kenngrößen wie Energiedichte, Leistungsdichte, Lebensdauer, C-Rate, Spannungslage, sowie Kosten, Sicherheit und Umweltverträglichkeit herangezogen. Die Bedeutung dieser Kenngrößen im Kontext der Elektromobilität wird ausführlich erläutert.
Welche Anforderungen werden an Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen gestellt?
Das Dokument beschreibt detailliert die Anforderungsaspekte an Batteriesysteme in Elektrofahrzeugen. Diese umfassen die Batterielebensdauer, die Reichweitenanforderungen (Energiedichte), die Leistungsanforderungen (Leistungsdichte und C-Rate), Kostenaspekte, Temperaturanforderungen, Sicherheitsaspekte und Umweltsaspekte. Diese Anforderungen bilden die Grundlage für die Bewertung der verschiedenen Batterietechnologien.
Welche Testverfahren werden erwähnt?
Das Dokument erwähnt den "Neuen Europäischen Fahrzyklus" (NEFZ) und die "Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure" (WLTP) als Verfahren zur vergleichenden Bewertung von Fahrzeugen und deren Einfluss auf die Bewertung der Batteriesysteme.
Wie ist der Aufbau des Dokuments?
Das Dokument ist strukturiert in mehrere Kapitel: Einleitung, Grundlagen (inkl. Technologiebeschreibung, Bewertung von Fahrzeugen und Kenngrößen elektrochemischer Energiespeicher), Zielsystem, Vorgehen, Anforderungsaspekte an das Batteriesystem im Elektrofahrzeug und Bewertung der verschiedenen elektrochemischen Energiespeicher. Jedes Kapitel wird im Dokument zusammengefasst.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Zielsetzung der Arbeit ist die Analyse bestehender Batterietechnologien und die Untersuchung des Entwicklungspotenzials zukünftiger Generationen elektrochemischer Energiespeicher im Kontext der Elektromobilität. Ziel ist es, einen Überblick über verschiedene Batterietechnologien zu geben und deren Eignung für den Einsatz in Elektrofahrzeugen zu bewerten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die Schlüsselwörter umfassen: Elektromobilität, Batterietechnologien, elektrochemische Energiespeicher, Lithium-Ionen-Batterien, Energiedichte, Leistungsdichte, Lebensdauer, C-Rate, NEFZ, WLTP, Blei-Säure-Batterie, Nickel-Metallhydrid-Batterie, Kosten, Sicherheit und Umweltverträglichkeit.
- Quote paper
- Philipp Schollmeyer (Author), 2016, Bestehende Batterietechnologien und Entwicklungspotenziale künftiger Generationen von elektrochemischen Energiespeichern in Bezug auf die Elektromobilität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340979