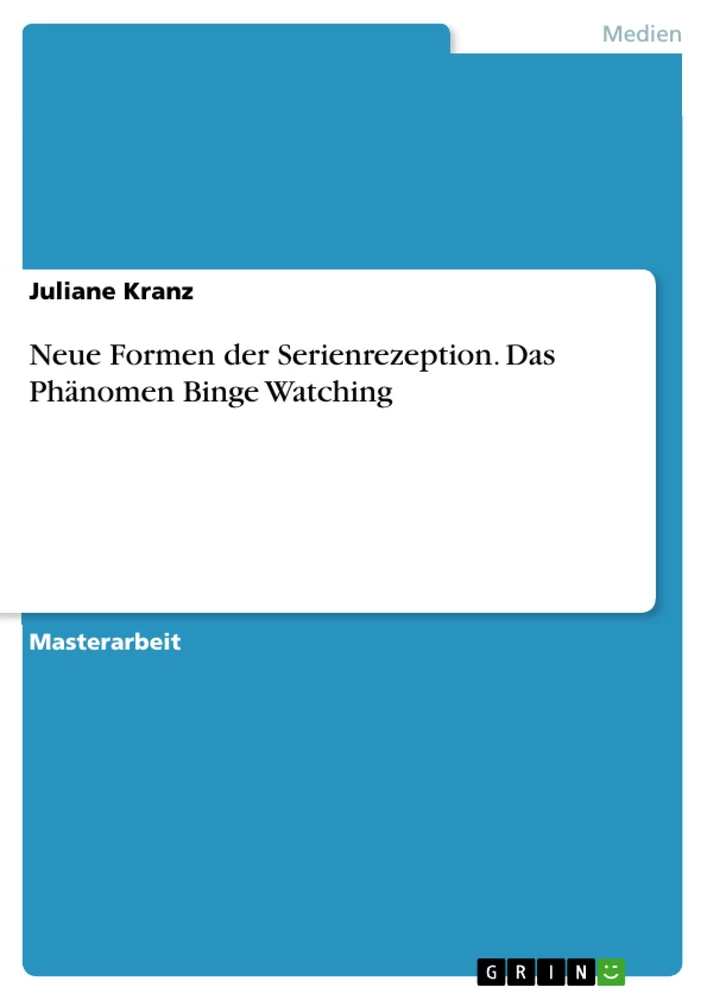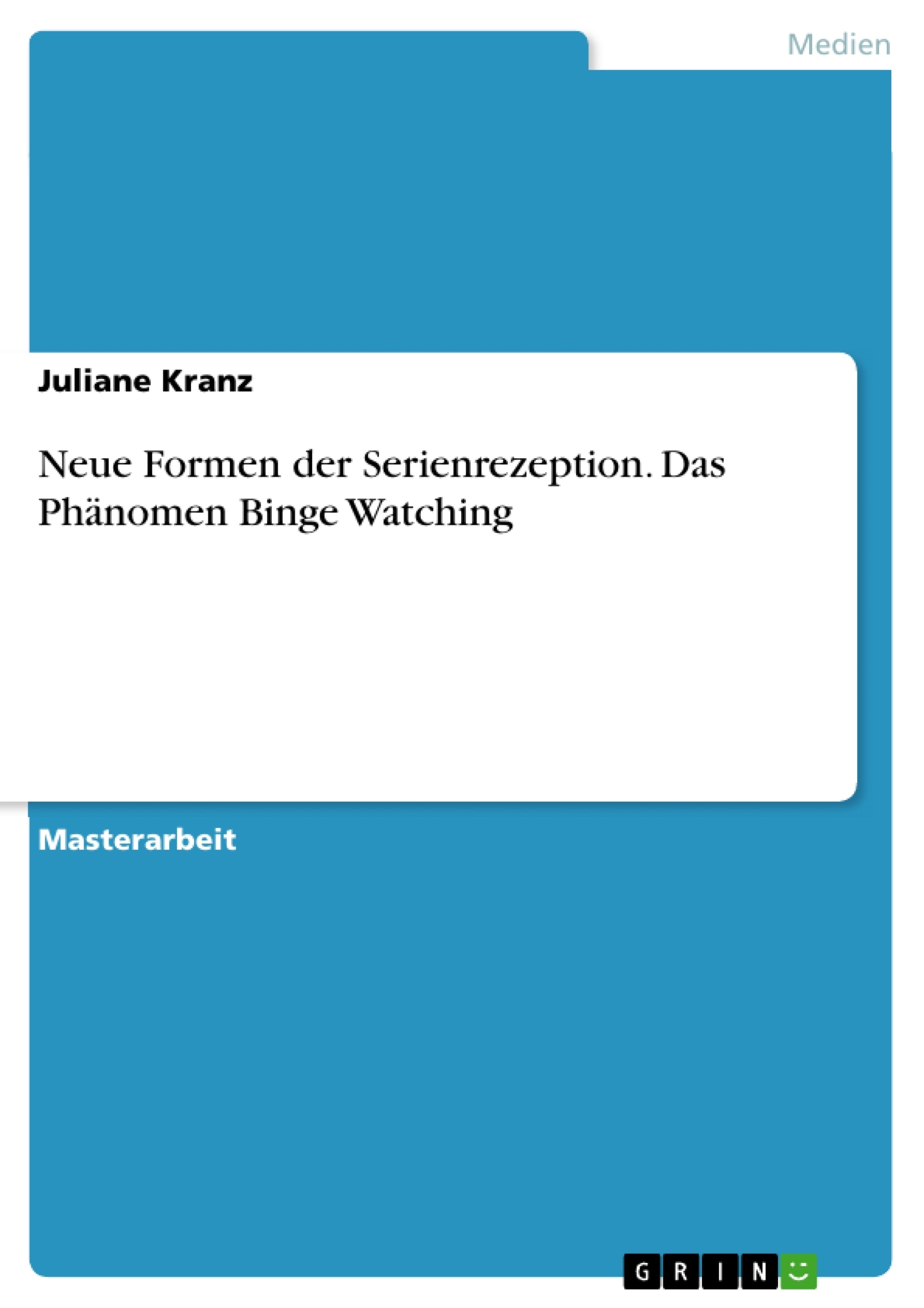Watchever, Amazon Prime und seit letztem Jahr auch Netflix beherrschen den deutschen VoD-Markt: Streaming-Portale steigern mit immer breitgefächerten Angeboten und günstigen Bezahlmodellen die Zuschauerakzeptanz und -nutzung von Video-on-Demand in Deutschland. Insbesondere serielle Formate profitieren von den uneingeschränkten Konsummöglichkeiten via Internet, denn der versierte Serienzuschauer muss nicht mehr auf die Fortsetzungsfolge warten, sondern kann seinen Konsum je nach Belieben selbst steuern und in einem regelrechten Serienexzess verfallen. Ein derart exzessives Serienkonsumverhalten beschreibt das Phänomen des Binge Watching. Im Rahmen einer Masterarbeit im Masterstudiengang der Medienwissenschaft an der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF wurde dieses neuartige Serienrezeptionsverhalten in Form einer qualitativen Studie näher untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 0 Einleitung
- 1 Die Fernsehnutzung in Deutschland
- 1.1 Allgemeine Nutzungsdaten
- 1.2 The New Age of Television
- 2 Der Video-On-Demand-Markt in Deutschland
- 2.1 Geschäftsmodelle
- 2.2 Nutzungspräferenzen
- 3 Fernsehserie vs. Serie im Fernsehen
- 3.1 Eingrenzung und Begriffsklärung
- 3.2 Strukturen und Funktionen seriellen Erzählens
- 3.3 Der Serienmarkt im Wandel - Quality-TV
- 3.4 Exkurs Netflix: Die All-You-Can-Watch-Strategie
- 4 Aktueller Forschungsstand zum Thema Binge Watching
- 4.1 Nationale Studien
- 4.2 Internationale Studien
- 4.3 Forschungslücken: Individuelle Serienrezeptionsmuster
- 4.4 Binge Watching – Versuch einer definitorischen Verortung
- 5 Studie: Neue Formen der Serienrezeption
- 5.1 Erkenntnisinteresse und Konkretisierung der Forschungsfrage
- 5.2 Forschungsdesign
- 5.3 Methodenwahl
- 5.3.1 Entwicklung des Leitfadens – Kategorienbildung
- 5.3.2 Auswahl der Teilnehmer
- 5.3.3 Durchführung der Gruppendiskussion und Interviews
- 5.4 Auswertung der Daten
- 6 Auswertungen der Ergebnisse – Das Binge Watching-Phänomen
- 6.1 Allgemeine Mediennutzung
- 6.2 Allgemeine Serienrezeption – Quality-TV
- 6.2.1 Bewertung von Quality-TV-Serien
- 6.3 Serien im Alltag
- 6.3.1 Bedeutung von Serien im Alltag
- 6.3.2 Mehrwert der seriellen Formate
- 6.4 Reflektion des eigenen Rezeptionsverhaltens
- 6.5 Individuelle Rezeptionsmuster
- 6.5.1 Serienrezeption als Paar- und Gruppenhandlung
- 6.5.2 Kommunikation innerhalb einer Rezeptionsgemeinschaft
- 6.5.3 Geschlechtsspezifische Rezeptionsunterschiede
- 6.6 Erhöhter Serienkonsum oder exzessive Rezeption?
- 6.6.1 Ausdruck exzessiven Konsums
- 6.6.2 Physische und Psychische Grenzen vs. Kontrollverlust
- 6.6.3 Rezeptionsfokus und Aufmerksamkeitsverteilung
- 6.7 Weitere Konsumfördernde Einflüsse
- 7 Zusammenfassung und Fazit: WE ARE STILL WATCHING
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Veränderungen im Serienrezeptionsverhalten im Kontext der digitalen Medienlandschaft. Die Arbeit zielt darauf ab, neue Rezeptionsmuster zu identifizieren und das Phänomen des „Binge Watching“ zu definieren. Die qualitative Studie beleuchtet die individuellen Motive und Praktiken des Serienkonsums.
- Wandel der Fernsehnutzung durch Digitalisierung und Internet
- Entwicklung des Video-on-Demand-Marktes in Deutschland
- Veränderung des Serienmarktes durch Quality-TV
- Einfluss von Netflix und der „All-You-Can-Watch“-Strategie auf das Rezeptionsverhalten
- Definition und Analyse des Phänomens „Binge Watching“
Zusammenfassung der Kapitel
0 Einleitung: Die Arbeit untersucht individuelle Serienrezeptionsmuster im Kontext der Digitalisierung und des wachsenden Video-on-Demand-Marktes, insbesondere das Phänomen des Binge Watching. Die mangelnde Forschungslage zu diesem Thema bildet die zentrale Motivation.
1 Die Fernsehnutzung in Deutschland: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Fernsehnutzung in Deutschland, zeigt die stabile Nutzung des klassischen Fernsehens trotz steigender Onlinenutzung und analysiert die komplementäre Nutzung beider Medien. Die Konvergenz von Internet und Fernsehen wird im Kontext des „New Age of Television“ beleuchtet.
2 Der Video-On-Demand-Markt in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklung des Video-on-Demand-Marktes in Deutschland und die verschiedenen Geschäftsmodelle (EST, T-VoD, S-VoD, A-VoD). Der Fokus liegt auf den Nutzungspräferenzen und dem zunehmenden Erfolg des Abonnementmodells (S-VoD).
3 Fernsehserie vs. Serie im Fernsehen: Dieses Kapitel differenziert zwischen Fernsehserien und Serien im Allgemeinen, beleuchtet Strukturen und Funktionen des seriellen Erzählens und analysiert den Wandel im Serienmarkt mit dem Fokus auf Quality-TV. Ein Exkurs zu Netflix und dessen „All-You-Can-Watch“-Strategie wird vorgenommen.
4 Aktueller Forschungsstand zum Thema Binge Watching: Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Binge Watching, unterscheidet zwischen nationalen und internationalen Studien, zeigt Forschungslücken auf und versucht, den Begriff „Binge Watching“ zu definieren.
5 Studie: Neue Formen der Serienrezeption: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der durchgeführten qualitativen Studie (Gruppendiskussionen und Interviews), die Auswahl der Teilnehmer und die Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Grounded Theory.
6 Auswertungen der Ergebnisse – Das Binge Watching-Phänomen: Hier werden die Ergebnisse der Studie im Hinblick auf die aufgestellten Thesen ausgewertet. Die Analyse umfasst die allgemeine Mediennutzung, die Serienrezeption, die Bedeutung von Serien im Alltag, individuelle Rezeptionsmuster, das Ausmaß des exzessiven Serienkonsums (Binge Watching), sowie weitere konsumfördernde Einflüsse.
Schlüsselwörter
Binge Watching, Serienrezeption, Video-on-Demand, Quality-TV, Medienkonvergenz, Qualitative Medienforschung, Serienkonsumverhalten, Rezeptionsmotive, Online-Streaming, Netflix, individuelle Nutzungsmuster.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: Neue Formen der Serienrezeption
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht Veränderungen im Serienrezeptionsverhalten im Kontext der digitalen Medienlandschaft. Der Fokus liegt auf der Identifizierung neuer Rezeptionsmuster und der Definition des Phänomens „Binge Watching“. Eine qualitative Studie beleuchtet die individuellen Motive und Praktiken des Serienkonsums.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der Fernsehnutzung durch Digitalisierung, die Entwicklung des Video-on-Demand-Marktes in Deutschland, die Veränderung des Serienmarktes durch Quality-TV, den Einfluss von Netflix und der „All-You-Can-Watch“-Strategie, die Definition und Analyse von „Binge Watching“ sowie die Ergebnisse einer qualitativen Studie zu individuellen Serienrezeptionsmustern.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Fernsehnutzung in Deutschland, Video-on-Demand-Markt in Deutschland, Fernsehserie vs. Serie im Fernsehen, Aktueller Forschungsstand zum Thema Binge Watching, Studie: Neue Formen der Serienrezeption und Zusammenfassung und Fazit.
Wie ist die Studie aufgebaut?
Die Studie verwendet eine qualitative Forschungsmethode mit Gruppendiskussionen und Interviews. Die Auswahl der Teilnehmer und die Auswertung der Daten mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Grounded Theory werden detailliert beschrieben.
Welche Ergebnisse liefert die Studie?
Die Studie analysiert die allgemeine Mediennutzung, die Serienrezeption, die Bedeutung von Serien im Alltag, individuelle Rezeptionsmuster (inklusive Paar-/Gruppenrezeption und geschlechtsspezifische Unterschiede), das Ausmaß exzessiven Serienkonsums (Binge Watching) und weitere konsumfördernde Einflüsse.
Was ist „Binge Watching“ im Kontext der Arbeit?
Die Arbeit versucht, den Begriff „Binge Watching“ zu definieren und analysiert, inwieweit es sich um erhöhten Serienkonsum oder exzessive Rezeption handelt. Es wird untersucht, wie sich „Binge Watching“ auf das physische und psychische Wohlbefinden auswirkt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Binge Watching, Serienrezeption, Video-on-Demand, Quality-TV, Medienkonvergenz, Qualitative Medienforschung, Serienkonsumverhalten, Rezeptionsmotive, Online-Streaming, Netflix, individuelle Nutzungsmuster.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, basierend auf Gruppendiskussionen und Interviews. Die Datenanalyse erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse und Grounded Theory.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit basiert auf einer Kombination aus Literaturrecherche zu den Themengebieten Fernsehnutzung, Video-on-Demand, Quality-TV und Binge Watching, sowie auf den Ergebnissen der durchgeführten qualitativen Studie.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, neue Rezeptionsmuster im Kontext des Serienkonsums zu identifizieren und das Phänomen „Binge Watching“ zu definieren. Die individuellen Motive und Praktiken des Serienkonsums sollen beleuchtet werden.
- Quote paper
- Juliane Kranz (Author), 2015, Neue Formen der Serienrezeption. Das Phänomen Binge Watching, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341093