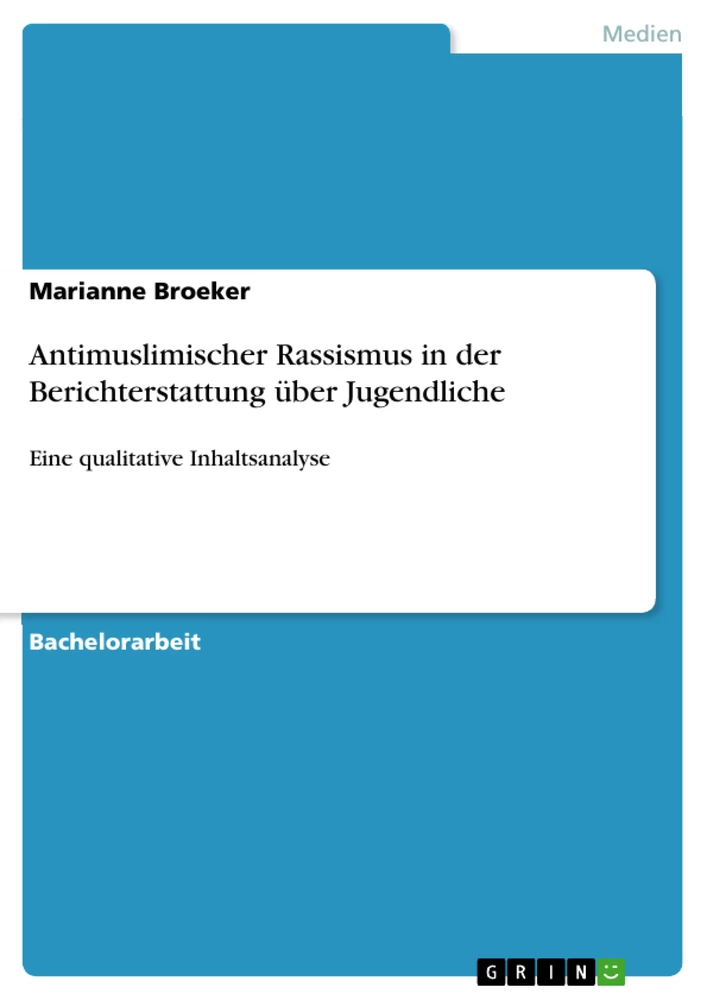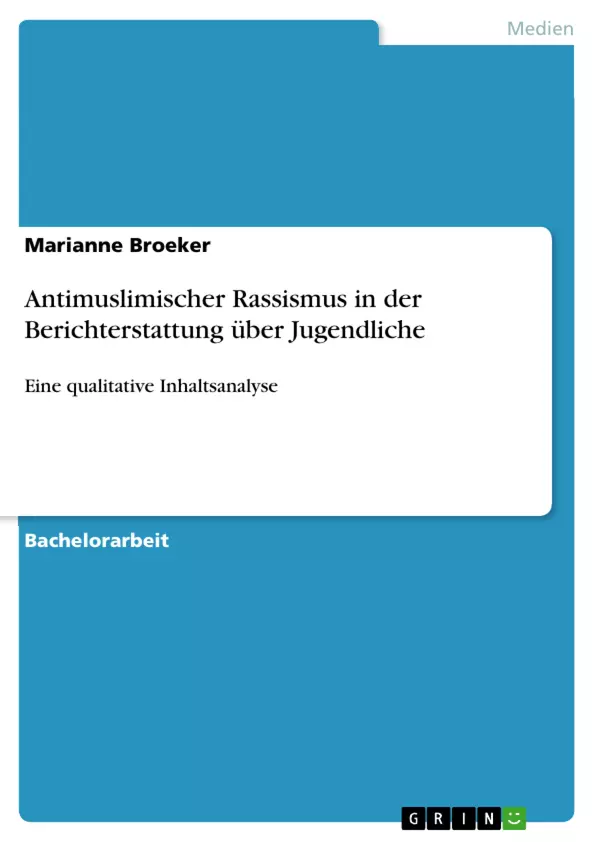In dieser Bachelorarbeit gehe ich der Fragestellung nach, welche inhaltlichen Merkmale die Berichterstattung über Jugendliche mit muslimischem Migrationshintergrund aufweist.
Migration gehört, besonders in Zeiten globaler Krisen und Zuwanderung, zu unserer Gesellschaft. Deutschland mit einem Anteil von 16,4 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund sollte sich dabei als Einwanderungsland begreifen.
Migranten werden jedoch nicht selbstverständlich als Teil der Gesellschaft wahrgenommen. Erhebungen zeigen, dass gerade Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus zunehmende Tendenzen in der Gesellschaft sind. Dies verdeutlicht sich auch im Assimilationsparadox, das besagt, die Herkunftsdeutschen würden Einwanderern gegenüber zwar toleranter gegenübertreten, auf der anderen Seite jedoch fordern sie immer radikaler deren Anpassung an die hiesigen Verhältnisse. Dies trifft insbesondere auf Menschen mit muslimischem Migrationshintergrund zu, die derzeit einen Anteil von 3,8 bis 4,3 Millionen Menschen in Deutschland ausmachen.
Medien haben die Aufgabe, gesellschaftlichen Wandel mitzugestalten und sehen sich mit Forderungen nach besserer Integration, Normalität und Gleichwertigkeit in der Darstellung verschiedener Teilgesellschaften konfrontiert. Auch haben Medien eine hohe gesellschaftliche Deutungsmacht, da nur wenige Herkunftsdeutsche direkten Kontakt zu muslimischen und muslimisierten Menschen haben und sowohl ihr Wissen über diese Gruppe als auch ihr Islambild durch mediale Sekundärerfahrungen geprägt wird.Die gesellschaftliche Macht der Medien muss einer ständigen Beobachtung unterzogen werden, um zu reflektieren, wie und durch welche Bilder bestimmte gesellschaftliche Gruppen und Minderheiten repräsentiert werden. Die Berichterstattung über Menschen mit muslimischem und muslimisiertem Migrationshintergrund ist bereits umfassend untersucht worden.
Die Gruppe muslimischer und muslimisierter Jugendlicher wurde von der Forschung bisher jedoch kaum beachtet. Aufgrund der zunehmenden Flüchtlingszahlen aus Syrien und anderen muslimisch geprägten Ländern sowie der hohen Anzahl minderjähriger Flüchtlinge (BAMF 2015), wird diese Gruppe auch in Zukunft vermehrt mediale Aufmerksamkeit finden. Die mediale Repräsentation junger muslimischer und muslimiserter Personen spielt auch im Hinblick auf die Integration dieser Gruppe eine wichtige Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Das Konzept der Cultural Media Studies
- Die Funktionen der Medien
- Medien als Wissensvermittler
- Die Repräsentationsfunktion der Medien
- Die Integrationsfunktion der Medien
- Die Zeigefunktion der Medien
- Die Identitätsfunktion der Medien
- Rassismus in heutigen Diskursen
- Antimuslimischer Rassismus in der deutschen Gesellschaft
- Merkmale von antimuslimischen Diskursen
- Effekte und Funktionen von antimuslimischen Diskursen
- Forschungsstand zu Migrant_innen in den Medien
- Forschungsstand zu Muslim_innen in den Medien
- Empirische Untersuchung
- Die Forschungsfrage
- Das Untersuchungsinstrument: Die qualitative Inhaltsanalyse
- Materialauswahl und Materialbeschreibung
- Theoriegeleitete Differenzierung und Operationalisierung
- Ablauf der Analyse
- Ergebnisse der Untersuchung
- Formale Aspekte der Analyseneinheiten
- Markierung der Jugendlichen als „Andere“
- Eigenschaftszuschreibungen und Attribute
- Argumentative Zusammenhänge
- Diskussion und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die mediale Repräsentation von Jugendlichen mit muslimischem Migrationshintergrund und analysiert, welche inhaltlichen Merkmale die Berichterstattung über diese Gruppe aufweist. Die Arbeit zielt darauf ab, die Rolle der Medien bei der Konstruktion von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber muslimischen Jugendlichen zu beleuchten.
- Antimuslimischer Rassismus in der Medienberichterstattung
- Die Konstruktion von „Andersartigkeit“ in Bezug auf muslimische Jugendliche
- Die Rolle der Medien bei der Integration von muslimischen Jugendlichen in die Gesellschaft
- Die Bedeutung der Medien für die Bildung von gesellschaftlichen Meinungen und Einstellungen
- Die Herausforderungen der medialen Berichterstattung über Minderheiten und marginalisierte Gruppen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den aktuellen Forschungsstand zum Thema antimuslimischer Rassismus in den Medien dar und erläutert die Relevanz der Thematik im Kontext der zunehmenden Migrationsbewegungen und der gesellschaftlichen Debatte über Integration.
- Theorie: Dieses Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Arbeit, insbesondere das Konzept der Cultural Media Studies und die Funktionen der Medien in der Gesellschaft. Zudem wird der Begriff des antimuslimischen Rassismus definiert und seine Erscheinungsformen in der deutschen Gesellschaft analysiert.
- Empirische Untersuchung: In diesem Kapitel wird die Forschungsfrage der Arbeit präzisiert und die methodische Vorgehensweise der qualitativen Inhaltsanalyse erläutert. Zudem werden die Materialauswahl, die Operationalisierung der Kategorien und der Ablauf der Analyse detailliert beschrieben.
- Ergebnisse der Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse und untersucht die formalen Aspekte der Analyseneinheiten, die Markierung der Jugendlichen als „Andere“, die Eigenschaftszuschreibungen und Attribute sowie die argumentativen Zusammenhänge in der Berichterstattung.
Schlüsselwörter
Antimuslimischer Rassismus, Medienberichterstattung, Jugendliche, Migrationshintergrund, Stereotypisierung, Integration, Cultural Media Studies, Qualitative Inhaltsanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 'Assimilationsparadox' in Bezug auf Migranten?
Es besagt, dass Herkunftsdeutsche zwar toleranter auftreten, aber gleichzeitig immer radikaler die Anpassung von Einwanderern an hiesige Verhältnisse fordern.
Welche Rolle spielen Medien für das Islambild in Deutschland?
Da nur wenige Herkunftsdeutsche direkten Kontakt zu Muslimen haben, wird ihr Wissen und ihr Bild maßgeblich durch mediale Sekundärerfahrungen geprägt.
Was ist antimuslimischer Rassismus in der Berichterstattung?
Es bezeichnet mediale Diskurse, die muslimische Menschen (insbesondere Jugendliche) als „Andere“ markieren und ihnen negative Attribute zuschreiben.
Welche Funktionen haben Medien laut Cultural Media Studies?
Medien fungieren als Wissensvermittler sowie als Instanzen für Repräsentation, Integration, Identitätsbildung und soziale Zeigefunktion.
Warum wurde die Gruppe muslimischer Jugendlicher bisher kaum erforscht?
Die Forschung konzentrierte sich bisher meist allgemein auf erwachsene Migranten; Jugendliche rücken erst durch aktuelle Fluchtbewegungen stärker in den Fokus.
Welche Methode wurde für die empirische Untersuchung genutzt?
In der Bachelorarbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse zur Untersuchung der Berichterstattung angewendet.
- Citar trabajo
- Marianne Broeker (Autor), 2015, Antimuslimischer Rassismus in der Berichterstattung über Jugendliche, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341151