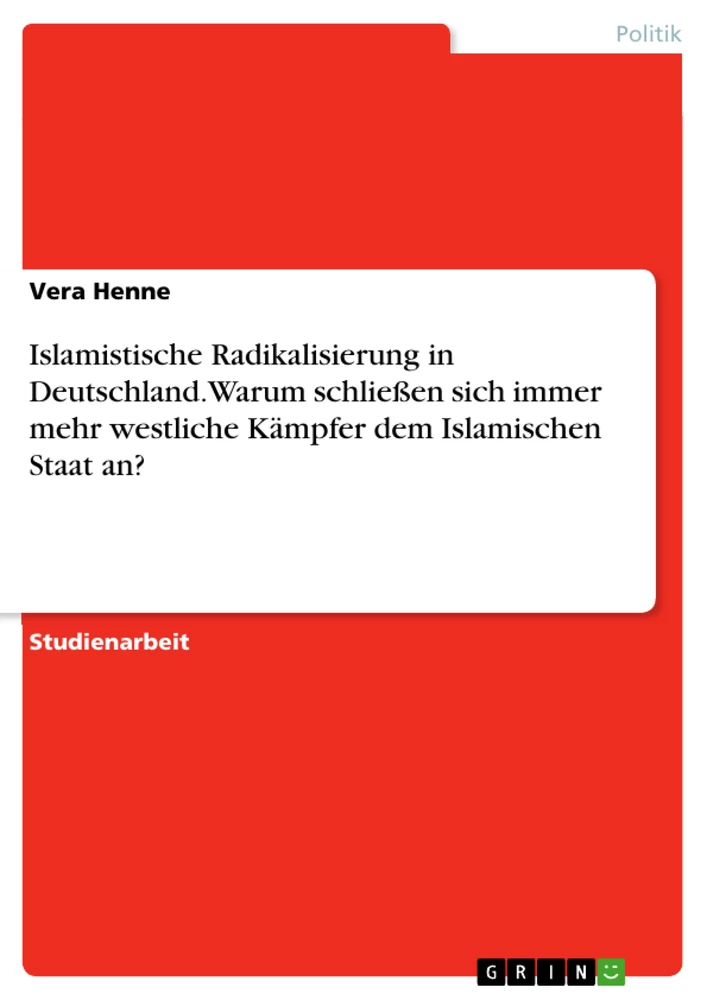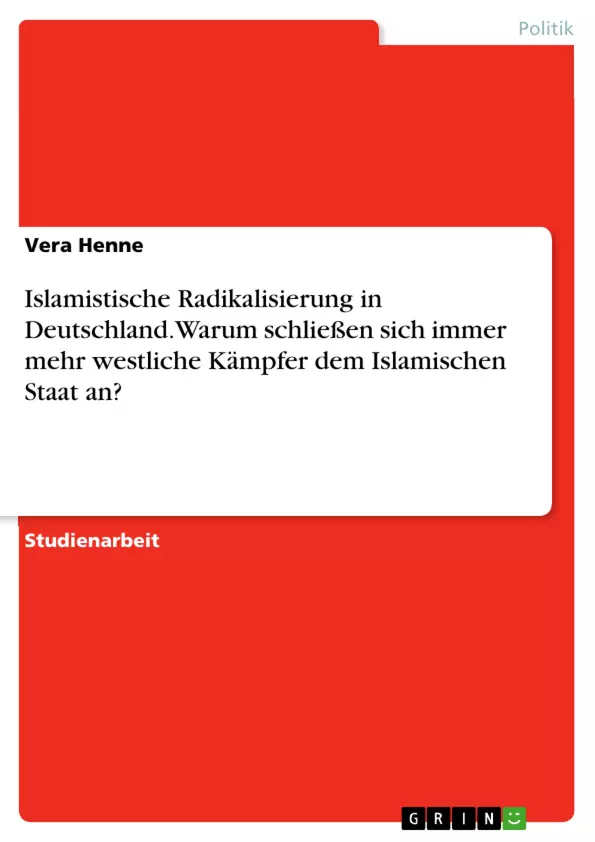Diese Arbeit möchte die islamistische Radikalisierung in Deutschland näher beleuchten. Zunächst werden begriffliche Grundlagen wie Islamismus als ein Aspekt von internationalem Terror und der „Islamische Staat“ erklärt. Darauf werden theoretische Grundlagen wie die Gültigkeit der Theorie der „Kampf der Kulturen“ und Push und Pull Faktoren der islamistischen Radikalisierung erläutert. Zudem sollen im zweiten Teil dieser Arbeit die Rolle des westlichen Kämpfers und seine strategische Bedeutung für den „Islamischen Staat“ erläutert werden. Deutschland wird auf politische und gesetzliche Besonderheiten untersucht, die Deutschland zu einem Rekrutierungsland machen oder dies zu verhindern suchen. Die Radikalisierungsprozesse werden nach den Motiven der Radikalisierung und deren Wege analysiert. Ein kurzer Exkurs wird das relativ neue Phänomen der weiblichen IS-Kämpferinnen erläutern. Abschließend werden bereits existierende und geforderte Präventionsprojekte vorgestellt.
Im Fall Deutschland muss nicht mehr diskutiert werden, ob und inwiefern der Islam einen berechtigten Platz in der deutschen Gesellschaft hat. Am 3. Oktober 2010 in der Rede zum Jahrestag der deutschen Einheit bezeichnete der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff den „Islam als Teil von Deutschland“. Die Zahl der in Deutschland lebenden Muslime wurde 2009 auf 4,0 bis 4,5 Mio. Menschen geschätzt, wobei der Trend dieser Anzahl steigt.
Auf der einen Seite wird eine öffentliche Abneigung des Islams durch Parteien wie die AfD, Gruppierungen wie „Pegida“ in Deutschland oder des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in den USA populär. Auf der anderen Seite ist zudem ein Anstieg der Verbindungen westlicher Personen zu islamistischen Gruppierungen und insbesondere von Ausreisen nach Syrien und in den Irak um sich dem „Heiligen Krieg“ anzuschließen zu verzeichnen.
Immer mehr westliche Kämpfer schließen sich dem „Islamischen Staat“ an. Wie ist diese Entwicklung zu erklären? Es stellt sich die Frage, wie meist junge Menschen sich bewusst für den religiösen Fundamentalismus entscheiden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufbau der Arbeit
- Grundlagen
- Begriffliche Grundlagen
- Islamismus
- Der „Islamische Staat“
- Theoretische Grundlagen
- Ein Kampf der Kulturen?
- Push und Pull Faktoren des Islamismus
- Die Rolle westlicher Kämpfer im „Islamischen Staat“
- Kategorisierung von Dschihad Kämpfern im „Islamischen Staat“
- Strategische Bedeutung für den „Islamischen Staat“
- Deutschland als Rekrutierungsland
- Quantitative Betrachtung
- Politische Besonderheiten
- Gesetzliche Besonderheiten
- Radikalisierungsprozesse
- Motive der Radikalisierung
- Push Faktoren der Radikalisierung
- Pull-Faktoren der Radikalisierung
- Trend: Weibliche IS-Kämpferinnen
- Institutionelle Radikalisierungsprävention
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die islamistische Radikalisierung in Deutschland. Sie untersucht die Ursachen und Motivationsfaktoren, die Menschen dazu bewegen, sich dem „Islamischen Staat“ anzuschließen, und beleuchtet die Rolle Deutschlands als Rekrutierungsland. Darüber hinaus werden die Radikalisierungsprozesse und die Präventionsmaßnahmen in Deutschland betrachtet.
- Begriffliche Klärung von Islamismus und „Islamischem Staat“
- Analyse von Push und Pull Faktoren der islamistischen Radikalisierung
- Untersuchung der Rolle westlicher Kämpfer im „Islamischen Staat“
- Bedeutung Deutschlands als Rekrutierungsland
- Erläuterung von Radikalisierungsprozessen und Präventionsmaßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit vor. Im zweiten Kapitel werden die begrifflichen und theoretischen Grundlagen behandelt, einschließlich der Definition von Islamismus, des „Islamischen Staates“ und der Theorie des „Kampfes der Kulturen“. Das dritte Kapitel fokussiert auf Deutschland als Rekrutierungsland und analysiert politische und gesetzliche Besonderheiten. Kapitel vier untersucht die Motive und Prozesse der Radikalisierung, inklusive des Phänomens der weiblichen IS-Kämpferinnen. Abschließend werden im fünften Kapitel institutionelle Präventionsmaßnahmen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Islamismus, „Islamischer Staat“, Radikalisierung, Terrorismus, Push- und Pull-Faktoren, Rekrutierung, Deutschland, Prävention, Dschihad, Scharia, „Kampf der Kulturen“.
Häufig gestellte Fragen
Warum schließen sich junge Menschen in Deutschland dem IS an?
Die Radikalisierung wird durch eine Kombination aus Push-Faktoren (wie soziale Ausgrenzung) und Pull-Faktoren (wie das Versprechen von Gemeinschaft und religiöser Identität) getrieben.
Welche Rolle spielen westliche Kämpfer für den „Islamischen Staat“?
Westliche Kämpfer haben eine hohe strategische Bedeutung für die Propaganda des IS, da sie helfen, neue Rekruten in Europa anzuwerben und Angst zu verbreiten.
Gibt es auch weibliche IS-Kämpferinnen aus Deutschland?
Ja, die Arbeit beleuchtet das Phänomen weiblicher IS-Anhängerinnen, die oft aus ideologischen Gründen oder zur Heirat von Kämpfern in die Konfliktgebiete ausreisen.
Was ist die Theorie vom „Kampf der Kulturen“?
Diese Theorie wird als möglicher Erklärungsansatz für die Radikalisierung diskutiert, wobei hinterfragt wird, ob religiöse Differenzen die Hauptursache für globale Konflikte sind.
Welche Präventionsmaßnahmen gibt es gegen Radikalisierung?
Es existieren verschiedene institutionelle Projekte, die durch Aufklärung, Beratung und Deradikalisierungsprogramme versuchen, den Rekrutierungserfolg des IS zu mindern.
- Quote paper
- Vera Henne (Author), 2016, Islamistische Radikalisierung in Deutschland. Warum schließen sich immer mehr westliche Kämpfer dem Islamischen Staat an?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341152