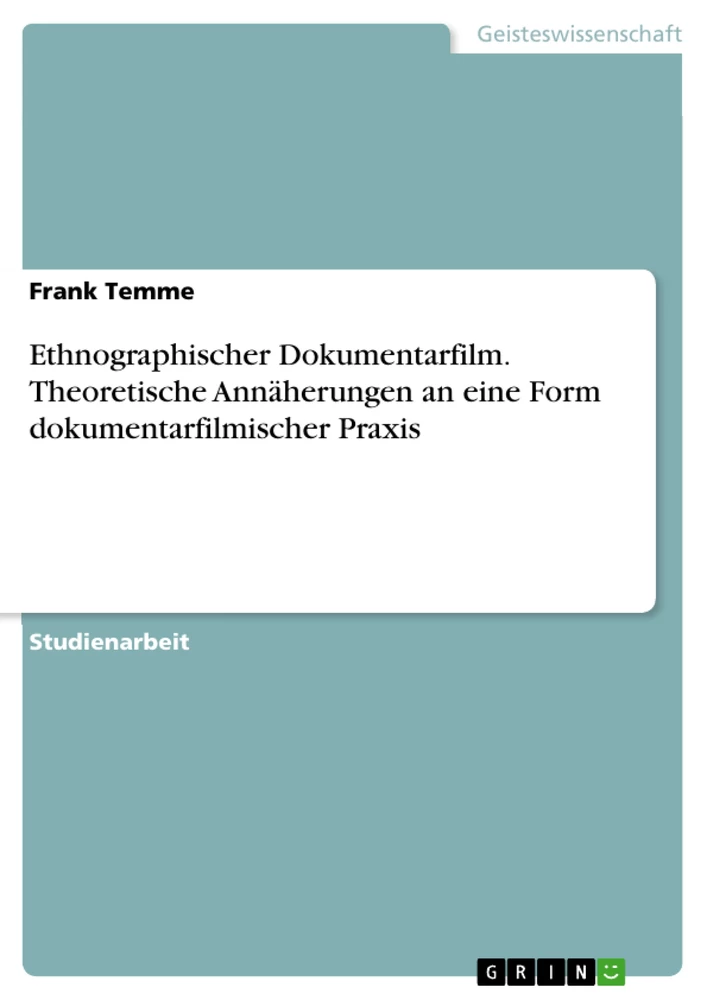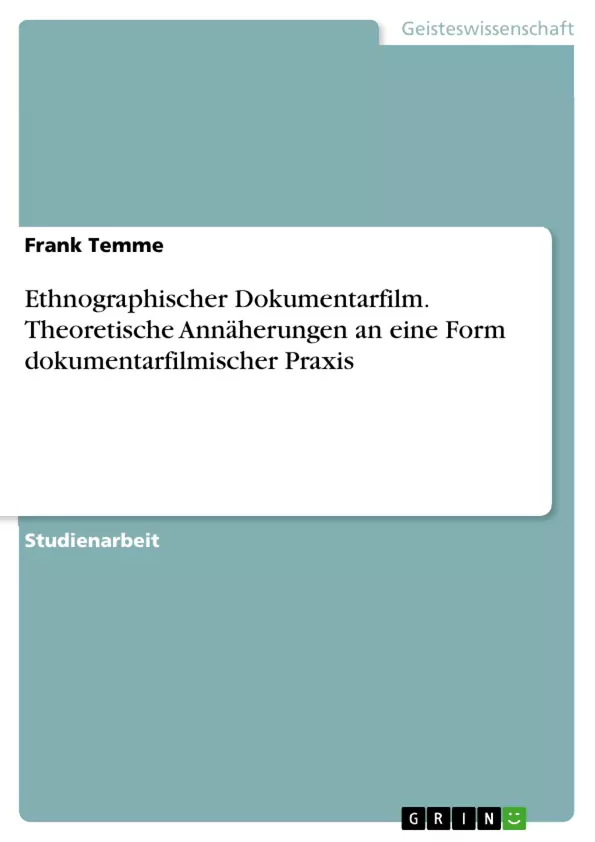Im 19. Jahrhundert nutzten Ethnologen diverse Medien, um Daten zu erheben und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Mit dem linguistic turn in den 1930er Jahren wurden Fotografie und Film als dekontextualisiert, populärwissenschaftlich und subjektiv abgetan und durch Diagramme und andere objektive visuelle Darstellungen ersetzt, die zum repräsentativen Standard erhoben wurden. So schärfte die Anthropologie ein wissenschaftliches Profil, das sich durch Feldforschung, Kulturrelativismus, Vergleichbarkeit und Textproduktion auszeichnete. In den 1980er und -90er Jahren geriet dieses Profil in die Krise: In der Writing-Culture-Debatte wurde der Text als Repräsentationsmittel in Frage gestellt und mit alten Dogmen gebrochen. Über die Rolle des Bildes wird bis dato erneut diskutiert.
Welchen wissenschaftlichen Beitrag können Bilder leisten? Noch immer herrscht Unklarheit. Zwischen Wort und Bild gibt es fundamentale Gegensätze. Innerhalb der Ethnologie opponieren sie miteinander. Immer wieder wurde in Debatten versucht, Bild und Film gegenüber dem Text zu diskreditieren. Was genau Bild und Film sind, verblieb dabei oftmals im Unklaren.
Um ein Verständnis dessen zu entwickeln, widmet sich der Autor in dieser Arbeit zunächst dem allgemeinen Begriff des Dokumentarfilms. Es wird erörtert, was, wie und wann ein Film ein Dokumentarfilm ist; denn es existieren die unterschiedlichsten dokumentarischen Formen, die mit dem populären Verständnis und seiner scheinbaren Eindeutigkeit wenig zu tun haben. Der ethnographische Dokumentarfilm soll als eine Form der dokumentarfilmischen Praxis begriffen werden. Es wird ein Verständnis dieser bestimmten Form ausgearbeitet, auf welches sich im weiteren Verlauf berufen wird, um das spezifische Potential des Films zu benennen. Wort und Bild beruhen auf verschiedenen Erfahrungszugängen und stehen in keinem Konkurrenzverhältnis zueinander. Durch ihre spezifischen Qualitäten können sie unterschiedliche Beiträge zur Disziplin leisten. Der ethnografische Dokumentarfilm soll als eigenständige Repräsentationsmodalität, nicht als Konkurrenz zum ethnographischen Schreiben verstanden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Dokumentarfilm
- Was ist ein Dokumentarfilm?
- Wie ist ein Dokumentarfilm?
- Wann ist ein Dokumentarfilm?
- Idealtypen des Dokumentarfilms
- Was ist ethnographischer Dokumentarfilm?
- Das spezifische Potential des Films
- Das Visuelle in der Ethnologie
- Die Angst vor dem Visuellen und ihre Entkräftung
- Wissen durch Film
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit widmet sich dem ethnographischen Dokumentarfilm und untersucht sein spezifisches Potential als wissenschaftliches Instrument in der Ethnologie. Sie hinterfragt die Rolle des Visuellen in der Forschung und analysiert die Debatte um die Relevanz von Bild und Film im Vergleich zum Text.
- Der Dokumentarfilm als wissenschaftliches Instrument
- Die Rolle des Visuellen in der Ethnologie
- Die Debatte um Bild und Film im Vergleich zum Text
- Das spezifische Potential des ethnographischen Dokumentarfilms
- Die Bedeutung der Filmästhetik für die wissenschaftliche Aussagekraft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung der Ethnologie und die Rolle von Bild und Film in der wissenschaftlichen Praxis. Es wird deutlich, dass der Text lange Zeit als dominierendes Repräsentationsmittel galt, während Bild und Film als subjektiv und dekontextualisiert betrachtet wurden. Die Arbeit argumentiert, dass diese Sichtweise überholt ist und dass der ethnographische Dokumentarfilm ein wertvolles Instrument der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung sein kann.
Kapitel 2 widmet sich dem Begriff des Dokumentarfilms. Es werden verschiedene Definitionsversuche vorgestellt und die Frage nach der Konstruktion der Wirklichkeit im Dokumentarfilm diskutiert. Es wird deutlich, dass der Dokumentarfilm kein reines Abbild der Realität ist, sondern ein Produkt der Entscheidungen des Filmemachers.
Kapitel 3 erörtert den ethnographischen Dokumentarfilm als eine spezielle Form der dokumentarfilmischen Praxis. Es wird seine spezifische Bedeutung für die Ethnologie herausgearbeitet und seine Fähigkeit, neue Perspektiven auf kulturelle Phänomene zu eröffnen, betont.
Kapitel 4 beleuchtet das spezifische Potential des ethnographischen Dokumentarfilms. Es wird argumentiert, dass der Film eine einzigartige Möglichkeit bietet, kulturelle Prozesse und soziale Interaktionen zu visualisieren und damit neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Ethnographischer Dokumentarfilm, Ethnologie, Visuelle Anthropologie, Filmästhetik, Repräsentation, Wissenschaftlichkeit, Konstruktion der Wirklichkeit, Bild und Text, Kulturrelativismus, Feldforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein ethnographischer Dokumentarfilm?
Es ist eine Form der filmischen Praxis, die kulturelle Phänomene visuell dokumentiert und als eigenständige Repräsentationsmodalität in der Ethnologie dient.
Welchen wissenschaftlichen Beitrag leisten Bilder in der Forschung?
Bilder bieten einen spezifischen Erfahrungszugang, der soziale Interaktionen und visuelle Kulturen oft unmittelbarer erfassbar macht als rein textliche Diagramme.
Steht der Film in Konkurrenz zum ethnographischen Text?
Nein, Wort und Bild beruhen auf verschiedenen Zugängen und ergänzen einander; der Film sollte nicht als Konkurrenz zum Schreiben verstanden werden.
Was war die „Writing-Culture-Debatte“?
In den 1980er Jahren wurde der ethnographische Text als objektives Repräsentationsmittel hinterfragt, was den Weg für neue Medien wie den Film ebnete.
Ist ein Dokumentarfilm ein objektives Abbild der Realität?
Nein, jeder Dokumentarfilm ist eine Konstruktion der Wirklichkeit, die durch die Entscheidungen und die Ästhetik des Filmemachers geprägt ist.
- Quote paper
- Frank Temme (Author), 2016, Ethnographischer Dokumentarfilm. Theoretische Annäherungen an eine Form dokumentarfilmischer Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341210