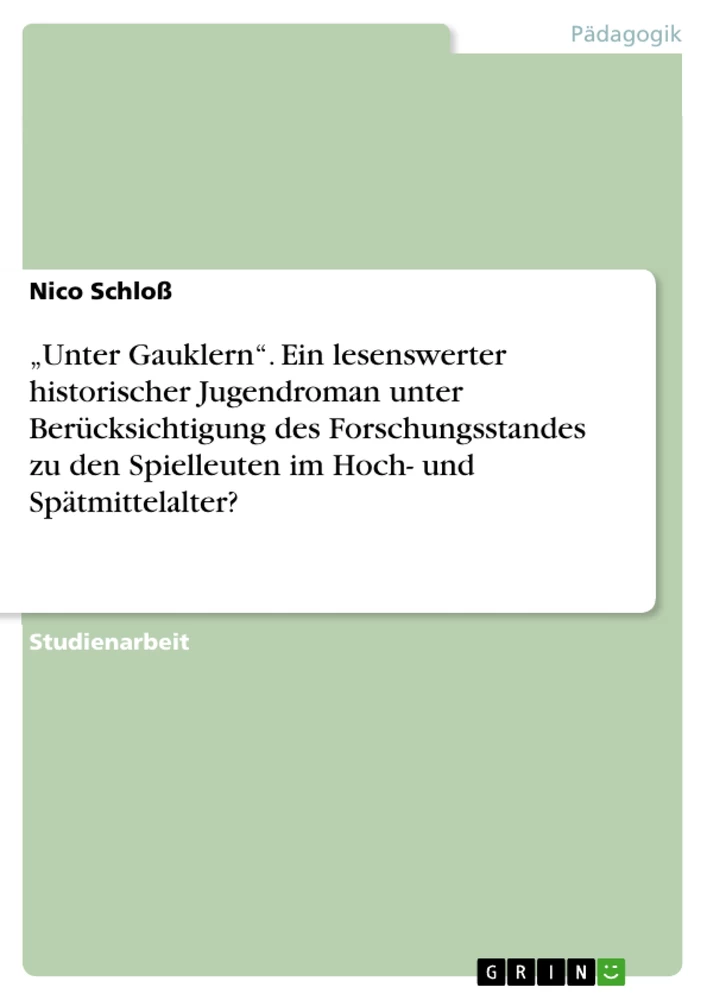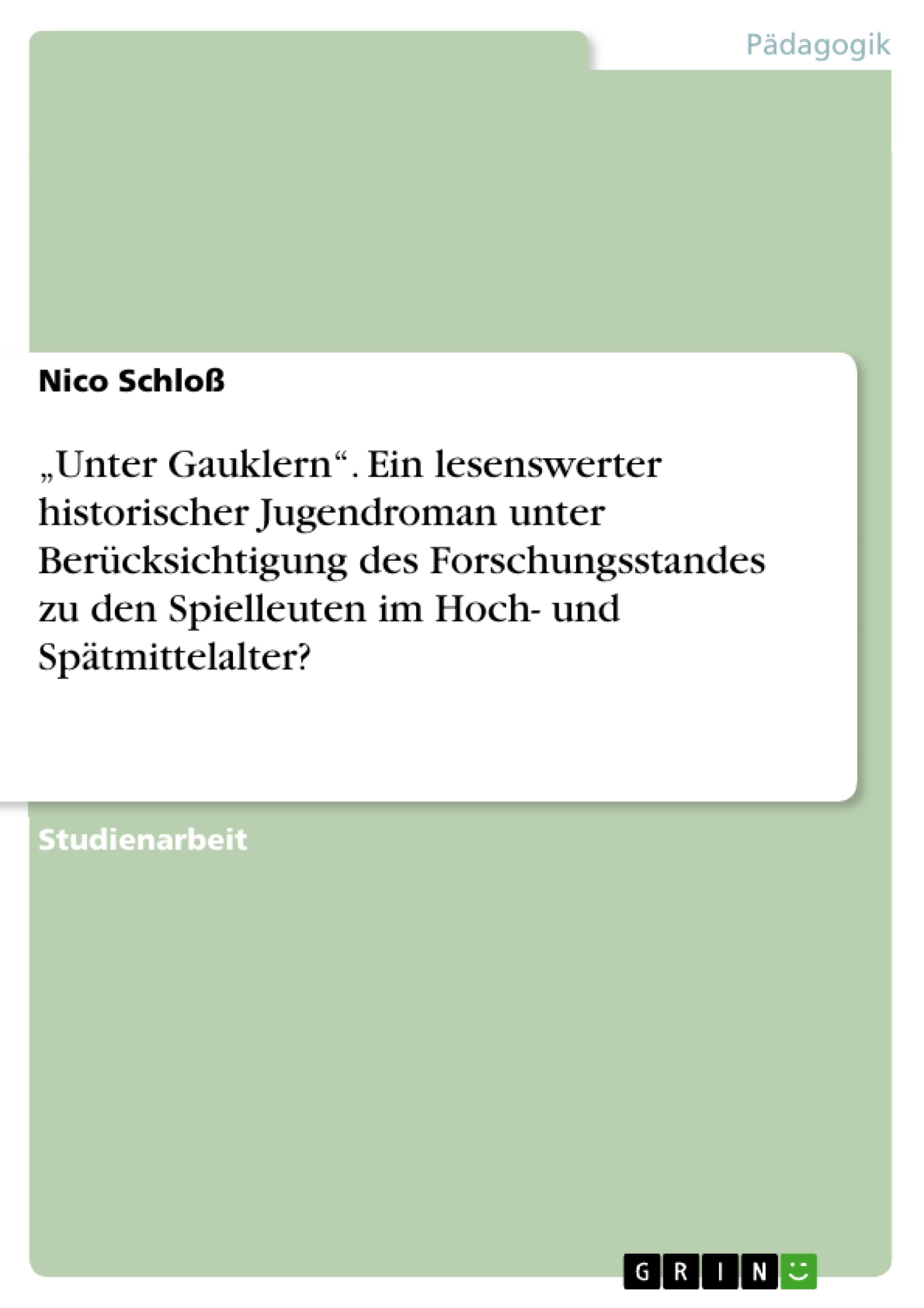Der Roman „Unter Gauklern“ ist laut Lichy „[…]eine gelungene Mischung aus leseförderndem Potenzial und Notwendigkeit zur Akkommodation bestehender Verstehensschemata […]“. Damit ist gemeint, dass die besonders adressatengerechten, thematisch-inhaltlichen und sprachlichen Gestaltungsmittel und die angemessene sowie verantwortungsbewusste Verwendung historischer, geschichtsdidaktischer sowie ethisch-moralischer Darstellungsformen das Werk zu einem idealen Zugang für Jugendliche zur mittelalterlichen Lebenswelt machen.
Einschlägige wissenschaftlich-geschichtsdidaktische Foren empfehlen ebenfalls den Einsatz des Romans, beispielsweise auch als Baustein für den Aufbau einer Klassenbibliothek für den Geschichtsunterricht. Da der Roman mit diversen emotional-bildlichen Mitteln und oftmals mit nicht unbedingt realitätsnahen, sondern eher phantastischen Beschreibungen durchzogen ist, wie beispielsweise die Textstelle „Ja, er stand da vor dem Teich und lernte das Lied, mit dem die Frösche lobpreisen.“, erstaunen diese Reverenzen durchaus, da viele Romancharakteristika eher auf fehlende Akkommodation schließen lassen.
Aufgrund dieses Eindrucks geht diese Ausarbeitung daher der Frage nach, ob der Roman „Unter Gauklern“ unter Beachtung historischer Lernansprüche, vor allem auch vor dem Hintergrund der Umgangsweisen mit dem wissenschaftlichen Forschungsstand zu den Spielleuten im Hoch- und Spätmittelalter, lesenswert für Jugendliche ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inhaltsüberblick über den Roman „Unter Gauklern“
- 3. Bewertung des Romans unter Nutzung des Kriterienkatalogs nach Reeken
- 3.1. Analyse der Protagonisten in Hinblick auf Identifikationsmöglichkeiten für den historischen Kontext
- 3.2. Abgleich des historischen Romangeschehens mit dem wissenschaftlichen Forschungsstand zum Lebenskreis der Spielleute im Hoch- und Spätmittelalter
- 3.2.1. Klärung des Begriffs „Spielleute“ und Arten von Spielleuten
- 3.2.2. Raum-zeitliche Dimensionen der Interaktionen der Spielleute
- 3.2.3. Besitz, Aussehen und Kleidung der Spielleute
- 3.2.4. Herkunft von Spielleuten und Motive für das Leben als Spielmann
- 3.2.5. Lebensstil und Einstellung von Spielleuten
- 3.2.6. Haltung der Gesellschaft gegenüber den Spielleuten
- 3.3. Beurteilung des Umgangs mit gesellschaftlich relevanten Problemdimensionen im Kontext der dargestellten mittelalterlichen Lebenskreise
- 3.4. Bewertung der dramaturgischen Gestaltung des Romans in Hinblick auf die jugendliche Leserschaft und Besprechung der Umsetzung formal-geschichtswissenschaftlicher Grundsätze
- 4. Resümee zur Eignung des Romans für das historische Lernen
- 5. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den historischen Jugendroman „Unter Gauklern“ von Arnulf Zitelmann hinsichtlich seiner Eignung für das historische Lernen. Dabei wird der Fokus auf die Darstellung der Spielleute im Hoch- und Spätmittelalter gelegt.
- Identifikationsmöglichkeiten für den Leser mit den Protagonisten im historischen Kontext
- Abgleich des Romans mit dem wissenschaftlichen Forschungsstand zu den Spielleuten
- Beurteilung des Umgangs mit gesellschaftlich relevanten Problemdimensionen im mittelalterlichen Lebenskreis
- Bewertung der dramaturgischen Gestaltung des Romans in Hinblick auf die jugendliche Leserschaft
- Eignung des Romans für das historische Lernen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt den Leser in die Geschichte des elternlosen Martis ein, der im 13. Jahrhundert in verschiedenen Lebenskreisen, wie dem Klosterleben und dem der Spielleute, seine Erfahrungen sammelt. Der Roman beleuchtet Themen wie Adoleszenz, Liebe und Randgruppen des Mittelalters.
Im zweiten Kapitel setzt Martis seine Suche nach dem Roma-Mädchen Linori fort. Er begegnet verschiedenen Personen und Lebenswelten, die ihm Einblicke in die Gesellschaft des Mittelalters gewähren.
Im dritten Kapitel erfährt Martis die Härte der mittelalterlichen Gesellschaft. Nach einer Auspeitschung durch Inquisitoren schließt er sich einer Spielmannstruppe an und findet Linori wieder.
Das vierte Kapitel beschreibt Martis' Einleben bei den Spielleuten. Er genießt das Leben mit den Gauklern und entwickelt eine positive Neigung zu dieser Lebensweise.
Schlüsselwörter
Historischer Jugendroman, Spielleute, Hoch- und Spätmittelalter, Randgruppen, Adoleszenz, Lebenswelten, historisches Lernen, Identifikationsmöglichkeiten, Forschungsstand, gesellschaftliche Problemdimensionen, dramaturgische Gestaltung, jugendliche Leserschaft.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Roman „Unter Gauklern“ historisch korrekt?
Die Arbeit gleicht den Roman mit dem wissenschaftlichen Forschungsstand zu Spielleuten ab und bewertet, inwieweit Fiktion und historische Realität übereinstimmen.
Was erfährt man über das Leben der Spielleute im Mittelalter?
Der Roman thematisiert den Lebensstil, die Kleidung, die soziale Ausgrenzung und die Motive der Spielleute, die oft als Randgruppe der Gesellschaft galten.
Eignet sich das Buch für den Geschichtsunterricht?
Trotz phantastischer Elemente bietet der Roman gute Identifikationsmöglichkeiten für Jugendliche und wird als Baustein für historisches Lernen empfohlen.
Welche Themen werden neben der Geschichte der Spielleute behandelt?
Zentrale Themen sind Adoleszenz, die Suche nach Identität, Liebe und der Umgang der mittelalterlichen Gesellschaft mit Randgruppen.
Wer ist der Protagonist des Romans?
Der Protagonist ist Martis, ein elternloser Junge im 13. Jahrhundert, der zwischen Klosterleben und der Welt der Gaukler seinen Weg sucht.
- Quote paper
- Nico Schloß (Author), 2016, „Unter Gauklern“. Ein lesenswerter historischer Jugendroman unter Berücksichtigung des Forschungsstandes zu den Spielleuten im Hoch- und Spätmittelalter?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341228