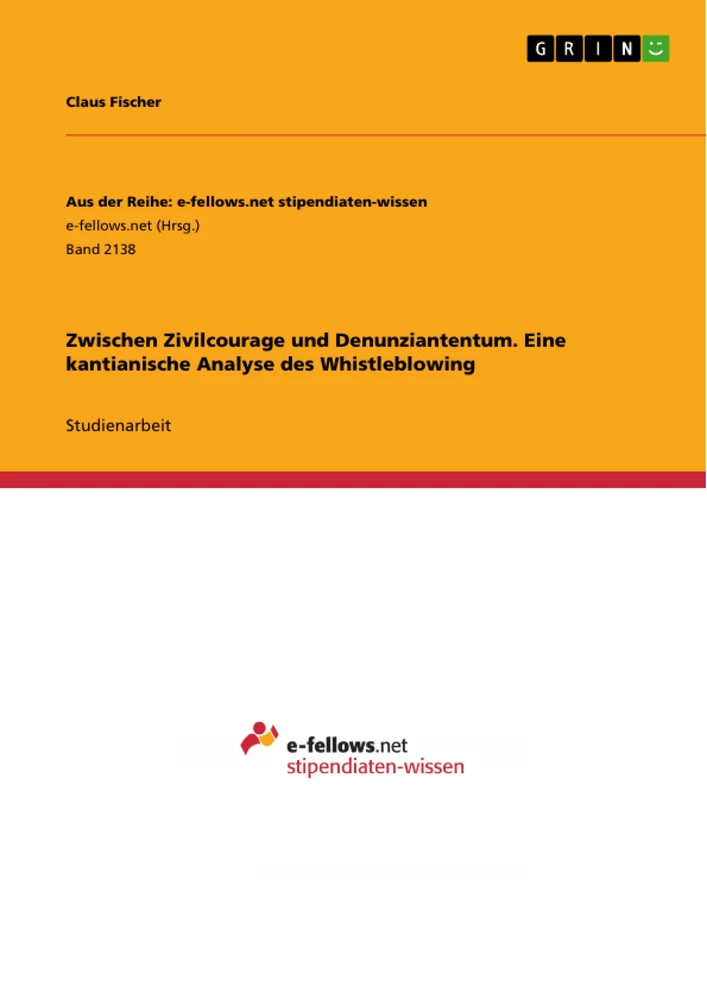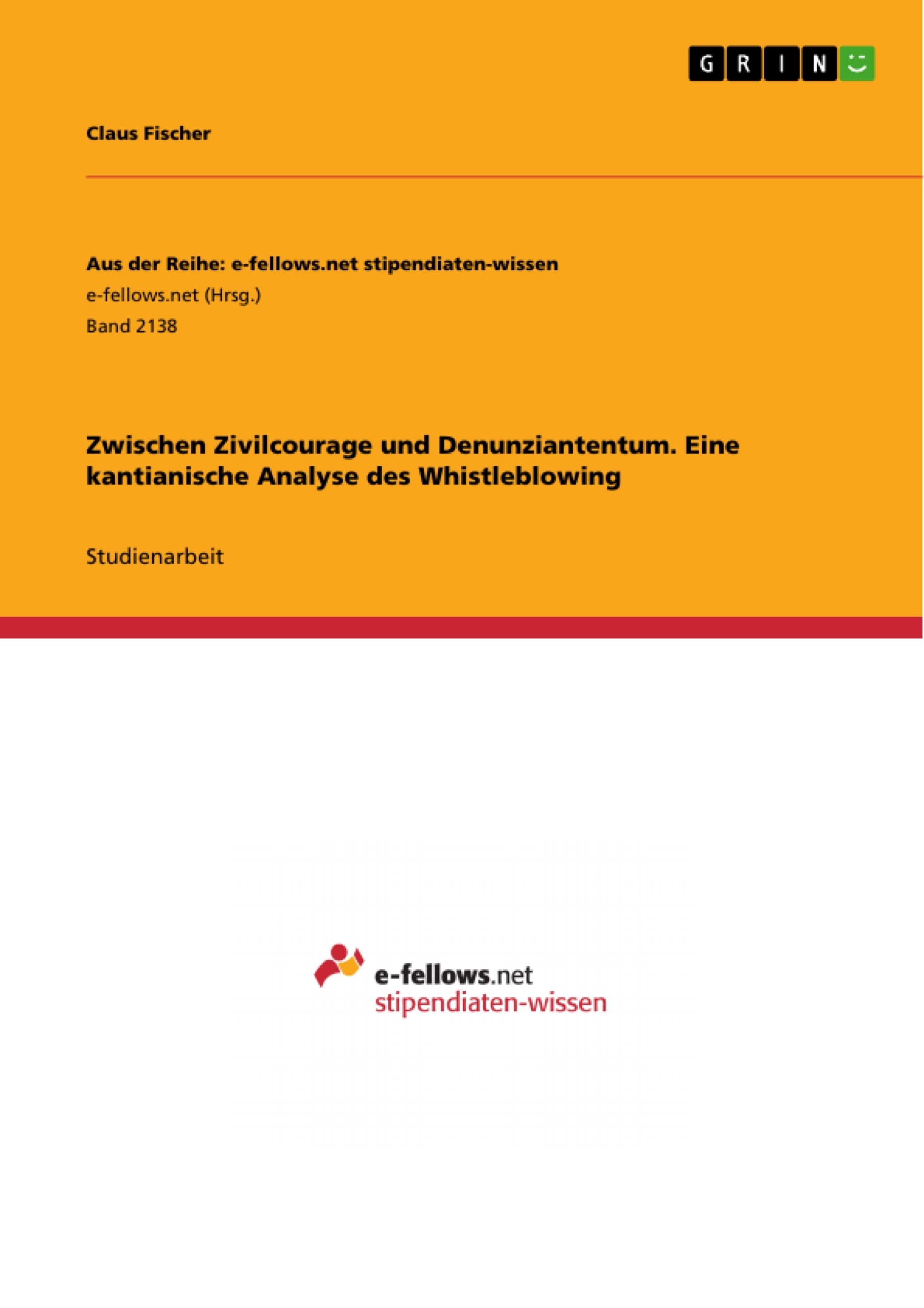Es ist der 17. Juni 1972. Von einem Wachmann des Watergate-Gebäudekomplexes wird die Polizei alarmiert: Fünf Personen in Anzug und Krawatte hatten versucht in das Wahlkampfbüro der Demokratischen Partei einzubrechen und dort Wanzen anzubringen. Der Auftakt für die Watergate-Affäre und der Anfang vom Ende für Richard Nixons Präsidentschaft.
Heute herrscht allgemein die Meinung vor, zwei Reporter der „Washington Post“ – Bob Woodward und Carl Bernstein – hätten mit Ihren Ermittlungen Präsident Nixon zu Fall gebracht. Weniger bekannt ist jedoch, dass sie bei ebendiesen erheblich unterstützt wurden. Sie hatten einen bis zum heutigen Tage anonymen Informanten aus Nixons eigenen Reihen, der sie mit den pikanten Details ihrer Ermittlungsarbeit versorgte und so zu dem Amtsenthebungsverfahren gegen Nixon und dessen Rücktritt führte.
Ein Zeitsprung in den Juni 2013. Ex-NSA-Mitarbeiter Edward Snowden enthüllt prekäre Details über großangelegte, weltweite Spionage ausgehend von US-amerikanischen Geheimdiensten. Selbst befreundete Staaten wurden auf allen Ebenen abgehört und durchleuchtet – Ein internationaler Spionage-Thriller wird aufgedeckt. Weder Snowden noch der mysteriöse Watergate-Informant können als einfache Informanten, als Kriminelle oder gar als Hochverräter betrachtet werden. Sie genießen einen Sonderstatus. Sie sind so genannte „Whistleblower“.
Bereits diese beiden Beispiele werfen einen schier unüberschaubaren Komplex an Fragen auf. Was genau zeichnet einen Whistleblower vor einem schlichten Informanten aus? Ist Whistleblowing legal bzw. legitim? Existiert vielleicht sogar eine moralische Verpflichtung die Öffentlichkeit über etwaig unmoralische Tätigkeiten einer Organisation in Kenntnis zu setzen? Diese und weitere Fragen werden in dem Paper "Zwischen Zivilcourage und Denunziantentum" beantwortet. Hierin wird im Anschluss an eine Beleuchtung des Phänomens "Whistleblowing" und seiner Auslöser, basierend auf einer kantianischen Theorie nach Norman E. Bowie eine Abwägung bezüglich des moralischen Status des Phänomens getroffen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Abgrenzung des Whistleblowing
- 3 Wie kommt es zum Whistleblowing?
- 4 Rechtlicher Status des Whistleblower in den USA
- 5 Kantianische Interpretation des Whistleblowing
- 6 Konklusion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen des Whistleblowings, indem sie zunächst den Begriff definiert und von Informantentätigkeit abgrenzt. Im Anschluss werden die Ursachen und Umstände beleuchtet, die zum Whistleblowing führen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere in den USA, werden analysiert, um den ethischen und moralischen Aspekt zu beleuchten. Schließlich wird eine kantianische Perspektive auf das Whistleblowing angewendet, um dessen normativen Status zu bewerten.
- Definition und Abgrenzung von Whistleblowing
- Ursachen und Konsequenzen von Whistleblowing
- Rechtliche Rahmenbedingungen des Whistleblowings in den USA
- Ethische Bewertung des Whistleblowings aus kantianischer Perspektive
- Die Rolle von Loyalität im Kontext von Whistleblowing
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung präsentiert die Fälle Watergate und Edward Snowden als paradigmatische Beispiele für Whistleblowing und stellt zentrale Fragen nach der Definition, Legalität, Legitimität und moralischen Bewertung des Whistleblowings. Sie kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an, die eine Abgrenzung von Informanten, die Analyse der Auslöser von Whistleblowing, die rechtlichen Rahmenbedingungen in den USA und eine kantianische ethische Bewertung umfasst.
2 Abgrenzung des Whistleblowing: Dieses Kapitel widmet sich der Definition von Whistleblowing und grenzt es von Informantentätigkeit ab. Es werden Extrembeispiele (Kronzeuge vs. Whistleblower) herangezogen, um die Unterschiede aufzuzeigen. Der Fokus liegt auf dem Unterschied der Organisationen: Verbrecherische Organisationen versus Organisationen mit einem Nimbus der moralischen Makellosigkeit. Die Bedeutung der Reputationsschädigung und die Frage der Loyalität werden eingeführt und diskutiert. Die Definition von Loyalität im Sinne von Kleinig (2013) wird erläutert, um den ethischen Konflikt zu kontextualisieren.
3 Wie kommt es zum Whistleblowing?: Aufbauend auf der Definition wird dieses Kapitel die Umstände beleuchten, die Whistleblowing in einer Organisation auslösen. Es werden sowohl die Faktoren erörtert, die zum Whistleblowing motivieren, als auch die potenziellen negativen Konsequenzen für den Whistleblower. Die Analyse berücksichtigt die Entscheidungsprozesse des Whistleblowers und Strategien, um negative Konsequenzen zu minimieren. Die Bedeutung der möglichen negativen Folgen für Unbeteiligte wird auch untersucht.
4 Rechtlicher Status des Whistleblower in den USA: Dieses Kapitel untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen des Whistleblowings in den USA, um die rechtlichen Aspekte im Kontext der moralischen Bewertung zu berücksichtigen. Die Analyse der US-amerikanischen Gesetzgebung verdeutlicht die komplexen rechtlichen Implikationen für den Whistleblower und die Organisation. Es werden Beispiele herangezogen, um die Auswirkungen von Gesetzen zu veranschaulichen, die das Whistleblowing sowohl fördern als auch einschränken.
Schlüsselwörter
Whistleblowing, Informant, Loyalität, ethische Bewertung, kantianische Ethik, Rechtlicher Rahmen, USA, Watergate, Edward Snowden, moralische Verpflichtung, Reputation, Konsequenzen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Whistleblowing - Eine ethisch-rechtliche Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert das Phänomen des Whistleblowing umfassend. Sie definiert den Begriff, grenzt ihn von Informantentätigkeit ab und untersucht die Ursachen und rechtlichen Konsequenzen. Ein besonderer Fokus liegt auf der ethischen Bewertung des Whistleblowings, insbesondere aus kantianischer Perspektive.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Whistleblowing, Ursachen und Konsequenzen, rechtliche Rahmenbedingungen in den USA, ethische Bewertung (kantianisch), die Rolle der Loyalität im Kontext von Whistleblowing, und die Analyse von Fallbeispielen wie Watergate und Edward Snowden.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Abgrenzung des Whistleblowings, Ursachen von Whistleblowing, Rechtlicher Status in den USA, Kantianische Interpretation und Konklusion. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt des Themas Whistleblowing detailliert.
Welche Fallbeispiele werden verwendet?
Die Fälle Watergate und Edward Snowden dienen als paradigmatische Beispiele für Whistleblowing und werden zur Illustration verschiedener Aspekte verwendet.
Welche ethische Perspektive wird eingenommen?
Die Arbeit analysiert Whistleblowing aus einer kantianischen ethischen Perspektive, um den moralischen Status dieses Phänomens zu bewerten.
Welches Rechtssystem wird betrachtet?
Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Whistleblowings werden im Detail für die USA untersucht.
Wie wird Whistleblowing von Informantentätigkeit abgegrenzt?
Die Arbeit legt Wert auf eine klare Abgrenzung zwischen Whistleblowing und Informantentätigkeit. Dabei werden die Unterschiede in den beteiligten Organisationen (kriminelle vs. moralisch einwandfrei scheinende Organisationen) und die Rolle der Reputationsschädigung hervorgehoben.
Welche Rolle spielt Loyalität?
Die Rolle der Loyalität wird im Kontext des ethischen Konflikts, der durch Whistleblowing entsteht, ausführlich diskutiert. Die Definition von Loyalität nach Kleinig (2013) wird dabei herangezogen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Die Konklusion des letzten Kapitels wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht explizit genannt, sondern muss aus der Lektüre der gesamten Arbeit erschlossen werden.)
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Whistleblowing, Informant, Loyalität, ethische Bewertung, kantianische Ethik, rechtlicher Rahmen, USA, Watergate, Edward Snowden, moralische Verpflichtung, Reputation, Konsequenzen.
- Arbeit zitieren
- Claus Fischer (Autor:in), 2014, Zwischen Zivilcourage und Denunziantentum. Eine kantianische Analyse des Whistleblowing, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341230