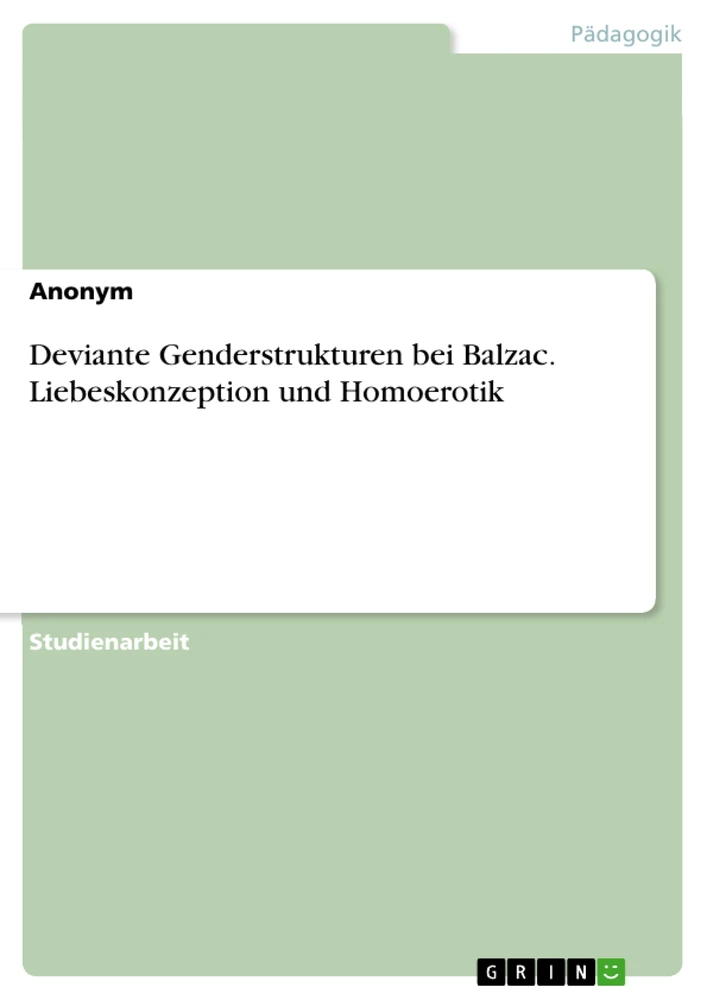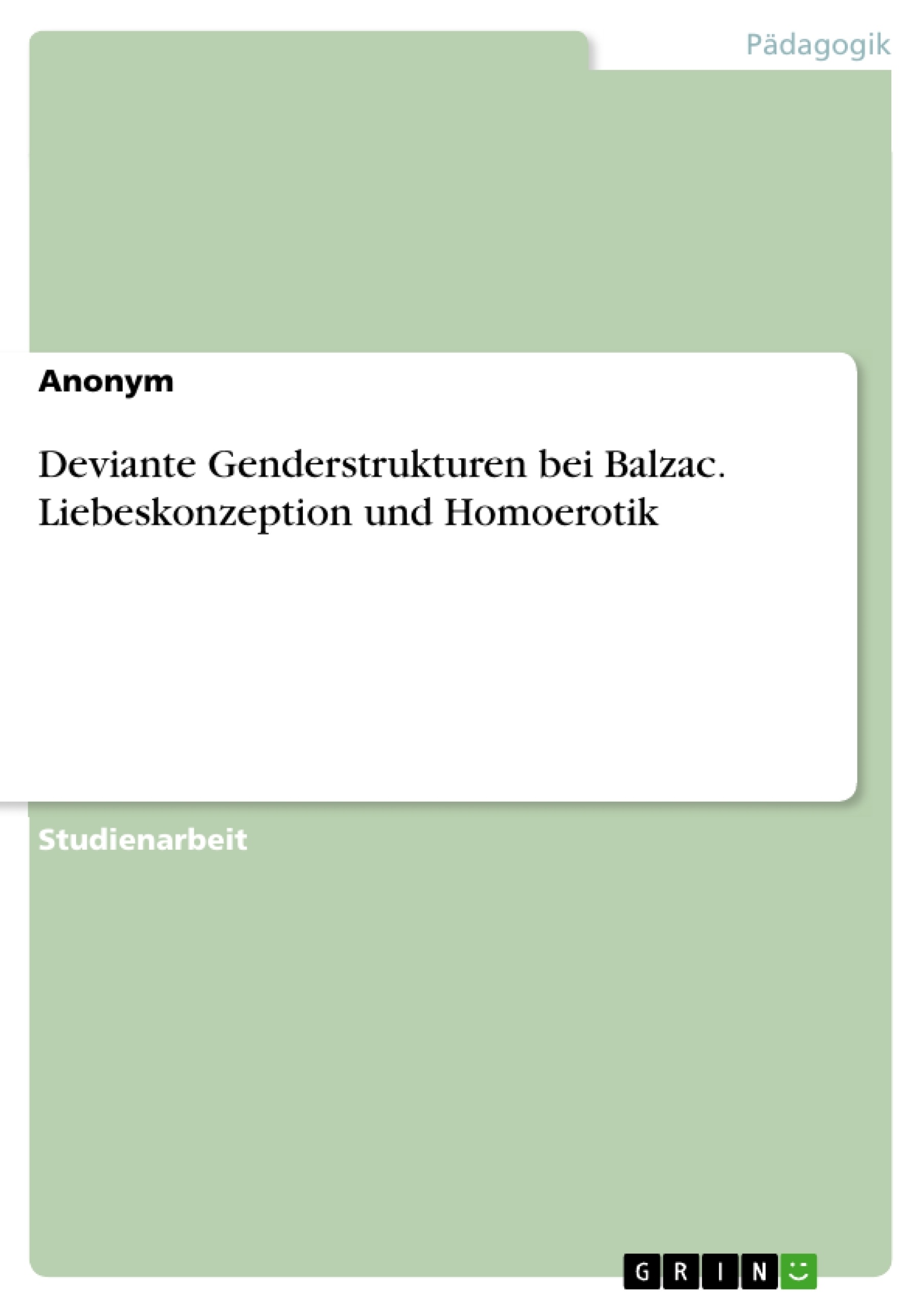Ist die Männlichkeit aufgrund der gesellschaftlichen Umstrukturierung vom Aussterben bedroht oder befindet sie sich in einer anhaltenden Krise?
Anhand der Theorie „El examen de los ingenios para las sciencias“ von Juan Huarte de San Juan, werden die unterschiedlichen Geschlechtertypen näher beleuchtet. Im Vordergrund stehen dabei die beiden biologisch gegebenen Geschlechter von Mann und Frau, sowie das Dritte Geschlecht des Hermaphroditen bzw. des heutigen Transgender.
Nachfolgend wird das Männlichkeitsideal der Antike, beginnend mit Adam und dessen Wandel hin zur Moderne im 19. Jahrhundert aufgezeigt.
Dabei sollen vor allem die Aspekte von Homosexualität in der höfischen Gesellschaft, Verkleidungskult und sexuelle Rollenspiele, sowie der homosoziale Männerbund und deren exklusive Heterotope untersucht werden. Des Weiteren wird der Aufbruch der patriarchalen Struktur und die Umstrukturierung der Familie nach dem Tod des Vaters, sowie die Konsequenzen der Absenz des patrias potestas, eingehend untersucht und anhand von Beispielen aus den Werken Le Cousin Pons, Le Père Goriot und La fille aux yeux d’or belegt. Neben den ebenen genannten Untersuchungskriterien widmen wir uns anschließend dem inzestuösen und libidinösen Begehren der Vater- Tochter- Struktur im Père Goriot, sowie dem mimetischen Begehren.
Im Zuge der fortlaufenden Progression von Biopolitik, der Emanzipation der Frau, kollektiver Integration von vermeintlich notwendigen und „gendergerechten“ Begrifflichkeiten in den alltäglichen Sprachgebrauch und dem gesellschaftlichen Lebenswandel, stellt sich die Frage inwieweit die Umstrukturierung der Geschlechterrollen von diesen Neuerungen beeinflusst werden. Bereits Siegmund Freund, der Begründer der Psychoanalyse, setzt sich in seiner Weiblichkeitstheorie mit der expliziten Frage nach „der Weiblichkeit und der kastrierten Sexualität der Frau“ auseinander.
Gegenüber der anatomischen Entwicklung des Mädchens zur Frau stellt er den Entwicklungsprozess des Knaben zum Mann als eher geradlinig an. Den Heranreifungsprozess des Mädchens zur Frau sieht Freud als eher schwankenden und unstetigen Prozess. Aus dieser Feststellung resultieren zwei defizitäre Entwicklungen, die die biologisch gegebenen Geschlechter abgrenzen.
Daher rück die Frage „Wann ist ein Mann ein Mann“ und „Wodurch konstituiert sich Männlichkeit überhaupt?“ immer weiter in den Fokus der sogenannten Men-Studies. Zu Überprüfen bleiben auch die Konsequenzen für das „Mannbild“.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Liebe, Ehe, Homoehe und Liebesobjekte
- Was ist Liebe?
- Liebesheirat und Vernunftsehe
- Wer wird als Liebesobjekt gesehen?
- Madame Cibot – une portière à moustache et ses enfants
- Pons und Schmucke - eine Homoehe?
- Die Kunstsammlung als Frauenersatz
- Was ist Kunst und worin besteht der Wert des Sammelns?
- Vautrin und Rastignac: Männlichkeit und Maske
- Ein homosozialer Männerbund
- Trugbilder der Sexualität
- ,,[D]ans la société la femme ne se trouve pas toujours être la femelle du mâle“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Analyse ist es, die Konzeption von Liebe und Sexualität in den Werken Honoré de Balzacs im Kontext des 19. Jahrhunderts zu untersuchen. Dabei wird besonders auf die subversive Darstellung von Geschlechterrollen, die Bedeutung der Homoerotik sowie die Frage nach der Veränderung des Männlichkeitsbildes im Wandel der Zeit eingegangen.
- Veränderungen des Männlichkeitsbildes im 19. Jahrhundert
- Homoerotik als Ausdruck von verschwindender Männlichkeit
- Subversion von Geschlechterrollen in Balzacs Werken
- Liebe und Sexualität als soziale Konstrukte
- Die Rolle von Kunst und Besitz im Kontext von Liebesbeziehungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Geschlechterrollen und deren Veränderung im 19. Jahrhundert ein. Sie beleuchtet die Relevanz von Balzacs Werken in diesem Kontext und stellt die zentralen Forschungsfragen der Analyse vor.
Kapitel 2: Liebe, Ehe, Homoehe und Liebesobjekte
Dieses Kapitel untersucht verschiedene Aspekte von Liebe und Ehe im 19. Jahrhundert. Es analysiert, wie der Begriff der Liebe definiert wurde, welche Formen von Liebe existierten und welche Kriterien für die Wahl eines Ehepartners entscheidend waren.
Kapitel 3: Madame Cibot – une portière à moustache et ses enfants
Dieses Kapitel analysiert die Figur der Madame Cibot und ihre Rolle in den Werken Balzacs.
Kapitel 4: Pons und Schmucke - eine Homoehe?
Dieses Kapitel befasst sich mit der Beziehung zwischen Pons und Schmucke und stellt die Frage, ob diese als eine Form von Homoehe verstanden werden kann. Es untersucht außerdem die Bedeutung der Kunstsammlung für die beiden Männer.
Kapitel 5: Vautrin und Rastignac: Männlichkeit und Maske
Dieses Kapitel analysiert die Beziehung zwischen Vautrin und Rastignac und untersucht, wie sich die Frage von Männlichkeit und Maskulinität in ihrem Verhältnis spiegelt. Es beleuchtet auch den homosozialen Männerbund, dem beide Männer angehören.
Kapitel 6: Trugbilder der Sexualität
Dieses Kapitel untersucht die Frage, wie die Sexualität in den Werken Balzacs dargestellt wird, insbesondere im Kontext von Verkleidungskult und sexuellen Rollenspielen. Es analysiert, wie Macht und Dominanz in diesem Kontext eine Rolle spielen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind: Honoré de Balzac, Geschlechterrollen, Homoerotik, Männlichkeit, Liebe, Ehe, Homoehe, Sexualität, Kunst, Besitz, Subversion, Maskulinität, Verkleidungskult, Societé, Gender, 19. Jahrhundert, Französische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit bezüglich der Männlichkeit im 19. Jahrhundert?
Die Arbeit analysiert, ob sich die Männlichkeit in den Werken Balzacs aufgrund gesellschaftlicher Umstrukturierungen in einer Krise befindet oder gar vom Aussterben bedroht ist.
Was versteht man unter "devianten Genderstrukturen" bei Balzac?
Es bezieht sich auf die Abweichung von traditionellen Geschlechternormen, wie z.B. sexuelle Rollenspiele, Verkleidungskult und die Darstellung von Homoerotik und Hermaphroditismus.
Wird die Beziehung zwischen Pons und Schmucke als "Homoehe" interpretiert?
Ja, die Arbeit untersucht, ob die enge Bindung zwischen den beiden Charakteren in "Le Cousin Pons" als eine Form von Homoehe oder homosozialer Männerbund verstanden werden kann.
Welche Rolle spielt die Kunstsammlung in Balzacs Werken?
Die Kunstsammlung wird oft als "Frauenersatz" oder als libidinöses Objekt dargestellt, das den Wert des Sammelns über zwischenmenschliche Beziehungen stellt.
Wie wird die Figur des Vautrin im Kontext von Männlichkeit analysiert?
Vautrin wird als Figur untersucht, die mit Masken und Identitäten spielt und einen homosozialen Männerbund anführt, was patriarchale Strukturen untergräbt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2013, Deviante Genderstrukturen bei Balzac. Liebeskonzeption und Homoerotik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341449