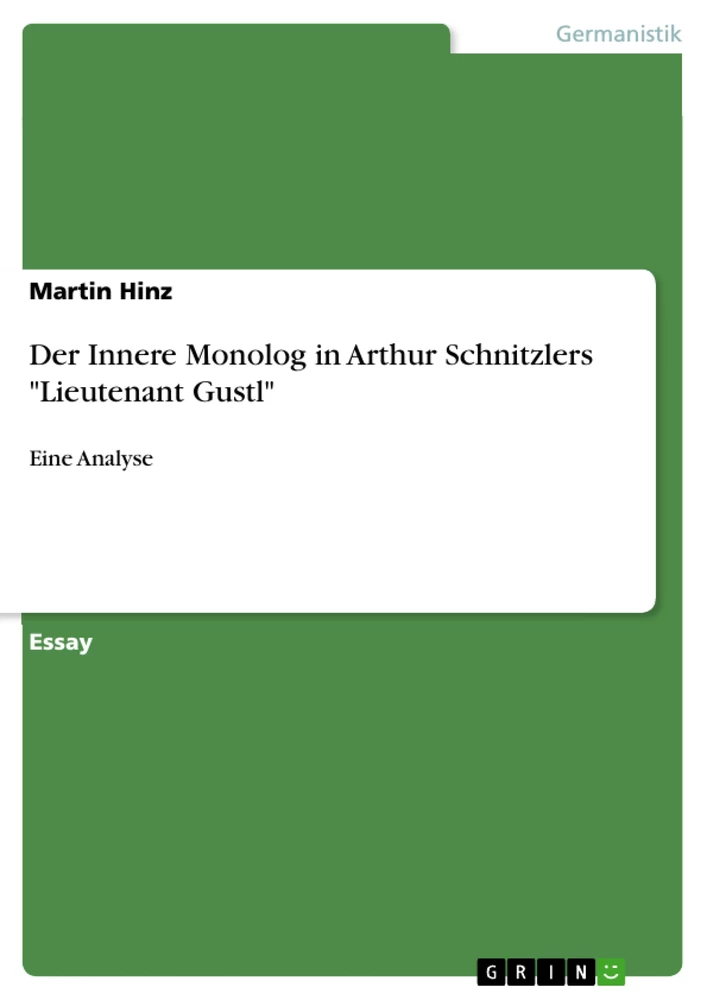In den Fokus des folgenden Essays möchte ich Arthur Schnitzlers Novelle "Lieutenant Gustl" stellen, die ich hinsichtlich des in ihr angewandten sogenannten Inneren Monologs untersuchen werde.
Dies geschieht zum Einen durch eine erzähltheoretische Betrachtung, zum Anderen durch ein Aufzeigen der Einflüsse und Referenzen, die zur Entwicklung dieses narrativen Modus führten. Auf diese Weise stelle ich damals zeitgenössische literaturtheoretische Ansätze und Vorbilder vor, zeige aber auch interdisziplinäre Strömungen des Zeitgeistes, wie die der Psychoanalyse, auf, und wie diese sich gegenseitig bedingt haben.
Inhaltsverzeichnis
- Der Innere Monolog in Arthur Schnitzlers Lieutenant Gustl
- Erzähltheoretische Betrachtung
- Fokalisierung
- Erzählmodus
- Einflüsse und Referenzen
- Literarische Vorbilder
- Literaturkritische Theorien
- Psychoanalytische Modelle
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit Arthur Schnitzlers Novelle "Lieutenant Gustl" und untersucht den in ihr angewandten inneren Monolog. Die Analyse betrachtet die erzähltheoretischen Aspekte sowie die Einflüsse und Referenzen, die zur Entwicklung dieses narrativen Modus führten. Dabei werden zeitgenössische literaturtheoretische Ansätze und Vorbilder vorgestellt, aber auch interdisziplinäre Strömungen des Zeitgeistes, wie die der Psychoanalyse, aufgezeigt und deren gegenseitige Bedingtheit beleuchtet.
- Erzähltheoretische Analyse des Inneren Monologs in "Lieutenant Gustl"
- Einfluss literarischer Vorbilder auf die Entwicklung des Inneren Monologs
- Bedeutung literaturkritischer Theorien für die Entstehung des Inneren Monologs
- Wechselwirkungen zwischen Psychoanalyse und Literatur, insbesondere in Bezug auf den Inneren Monolog
- Das "nervöse Zeitalter" um 1900 als Kontext für den Inneren Monolog
Zusammenfassung der Kapitel
- Der Essay beginnt mit einer erzähltheoretischen Betrachtung des Inneren Monologs in Schnitzlers Novelle. Dabei wird die Fokalisierung und der Erzählmodus analysiert und festgestellt, dass der Text aus der Perspektive der Figur erzählt wird, mit einem "personalen Erzählverhalten, fixiert auf eine Figur (autonomer innerer Monolog)".
- Im zweiten Teil werden die Einflüsse und Referenzen beleuchtet, die zur Entwicklung des Inneren Monologs führten. Hierbei werden literarische Vorbilder wie Edouard Dujardins "Les lauriers sont coupés" und Hermann Bahrs literaturkritische Theorien zur "Neuen Psychologie" vorgestellt.
- Der dritte Abschnitt untersucht die Wechselwirkungen zwischen Psychoanalyse und Literatur, insbesondere in Bezug auf den Inneren Monolog. Dabei wird das Verhältnis zwischen Sigmund Freud und Arthur Schnitzler beleuchtet und die Parallelen zwischen ihren Modellen der menschlichen Psyche herausgestellt.
Schlüsselwörter
Innerer Monolog, Arthur Schnitzler, Lieutenant Gustl, Erzähltheorie, Fokalisierung, Erzählmodus, literarische Vorbilder, Literaturkritik, Psychoanalyse, Sigmund Freud, "nervöses Zeitalter", Mittelbewusstsein, unbewusste Triebregungen, Wünsche, Phantasien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein innerer Monolog?
Es ist ein erzählerischer Modus, der die Gedanken und Gefühle einer Figur unmittelbar und ungefiltert in der ersten Person wiedergibt (autonomer innerer Monolog).
Warum ist „Lieutenant Gustl“ literaturgeschichtlich bedeutend?
Arthur Schnitzlers Novelle gilt als einer der ersten bedeutenden Texte im deutschsprachigen Raum, der konsequent die Technik des inneren Monologs nutzt.
Welchen Einfluss hatte die Psychoanalyse auf Schnitzler?
Es gibt starke Parallelen zwischen Schnitzlers Darstellung des Bewusstseins und Sigmund Freuds Modellen der Psyche, insbesondere hinsichtlich unbewusster Triebe und Wünsche.
Was versteht man unter dem „nervösen Zeitalter“?
Es bezeichnet die Zeit um 1900, die durch psychologische Instabilität und eine neue literarische Konzentration auf das Innenleben der Figuren geprägt war.
Wer waren Schnitzlers literarische Vorbilder?
Ein wichtiges Vorbild war Edouard Dujardin mit seinem Werk „Les lauriers sont coupés“, das bereits ähnliche narrative Techniken anwandte.
- Arbeit zitieren
- Martin Hinz (Autor:in), 2013, Der Innere Monolog in Arthur Schnitzlers "Lieutenant Gustl", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341481