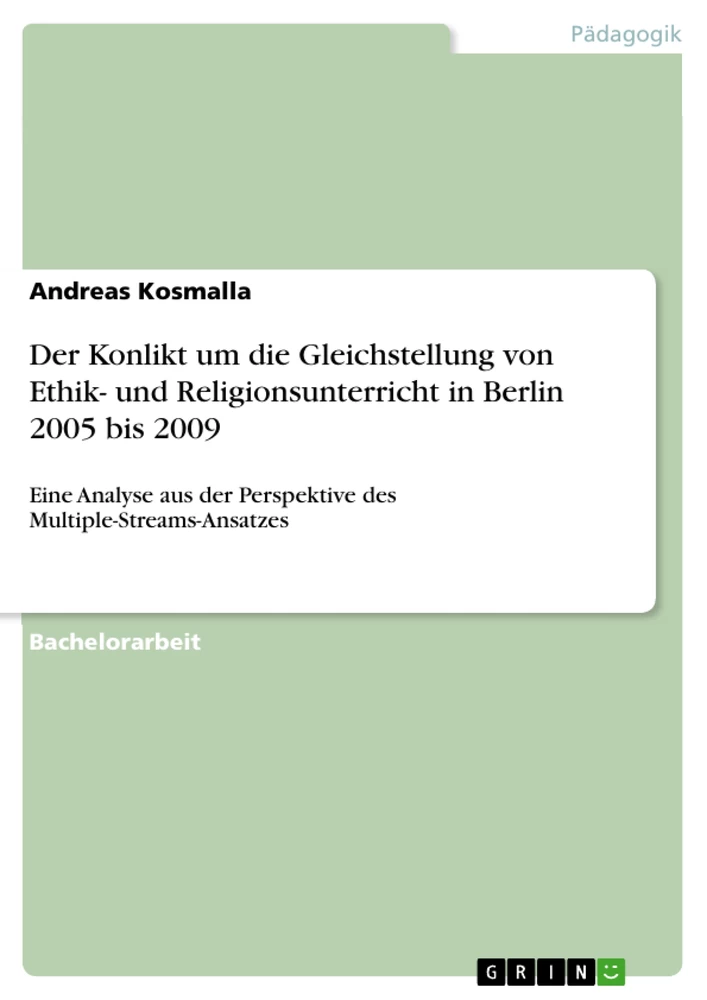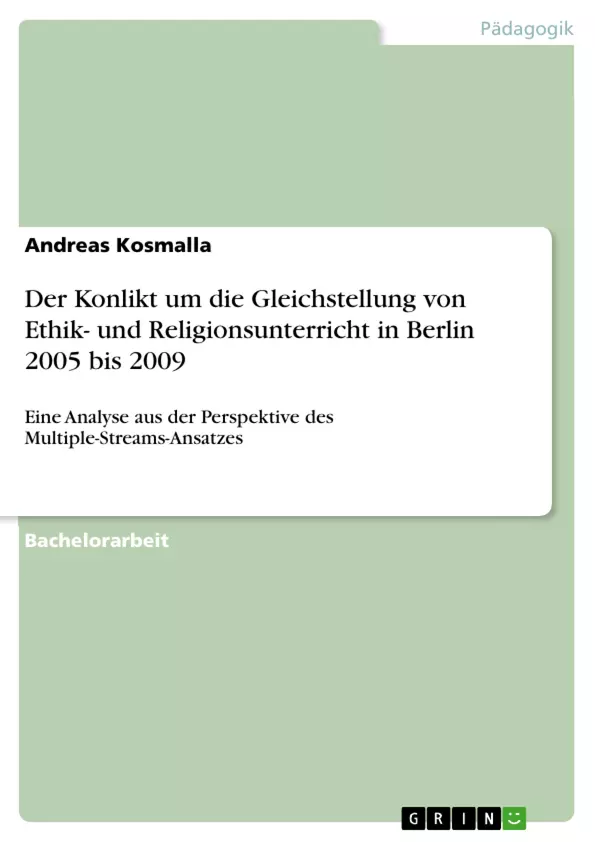Die vorliegende Arbeit widmet sich der Analyse eines politischen Problems innerhalb des Politikfeldes „Schulpolitik“ im Bundesland Berlin, das sich im Verlauf der 1990er Jahre entwickelte, in den Jahren um die Jahrtausendwende öffentlichkeitswirksam zutage trat und im Zeitraum zwischen 2005 und 2009 zu einer bemerkenswerten (schul)politischen Auseinandersetzung innerhalb der Berliner politics führte.
Es ging um die Ausgestaltung der ethisch-religiösen Bildung für Kinder und Jugendliche innerhalb des Berliner Schulsystems. Das seit der Nachkriegszeit etablierte Berliner Sondermodell von eigenständig durchgeführten, jedoch in den regulären Schulbetrieb integrierten freiwilligen Unterrichtsangeboten der großen Kirchen und des Humanistischen Verbandes war nach zehn Jahren Einwanderung und Multikulturalisierung in die Krise geraten, da es seinen inhaltlichen Zielstellungen immer weniger gerecht wurde und mit Beginn der 2000er Jahre sogar vollends in Widerspruch zu diesen Zielen zu geraten drohte.
Daraufhin wurde im Jahr 2005 von der regierenden Koalition aus SPD und PDS eine umstrittene bildungspolitische Entscheidung getroffen (die Einführung eines neuen, für alle verbindlichen Schulfaches „Ethik“), die unmittelbar darauf zu einer längeren schulpolitischen Auseinandersetzung unter Nutzung des für Berlin relativ neuen politischen Instruments „Volksentscheid“ führte und erst im Jahr 2009 endete.
Der Autor hat diesen Konflikt in Berlin selbst miterlebt, darin auch auf der kirchlichen Seite Partei ergriffen und kennt einige beteiligte Akteure persönlich. Daher erschien das Vorhaben lohnend, diese Vorgänge noch einmal selbst einer wissenschaftlichen Politikfeldanalyse zu unterziehen und dabei gleichzeitig ein bisher nicht auf diesen Fall angewandtes politikwissenschaftliches Analysemodell auf seine Erklärungskraft zu testen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Multiple-Streams-Ansatz als Analyserahmen für einen wertebasierten politischen Konflikt
- Grundannahmen des Multiple-Streams-Ansatzes
- Prozesse und Akteure im politischen Entscheidungsprozess
- Politikwissenschaftliche Rezeption und Kritik
- Berliner Polity und Politics: Der Verlauf der Auseinandersetzung zum Religions- und Ethikunterricht 2005-2009
- Zur Geschichte des „, Berliner Sonderweges“ beim Religionsunterricht
- Der Konflikt um die Einführung eines verpflichtenden Ethikunterrichts
- Die Volksabstimmung vom 26. April 2009
- Werte, Gott und Volksabstimmung: Berliner Religions- und Bildungspolitik zwischen Rationalität und Kontingenz
- Das Verhältnis von Religion, Schule und Gesellschaft als politischer,,Problemstrom“
- Konzepte und Wertvorstellungen im „, Optionsstrom“
- Interessen und Ideologien im schulpolitischen Konflikt
- Ein Volksentscheid als neue Chance für „politisches Unternehmertum“
- Fazit: „Ideas“ und „Pressure“ im politischen Wertekonflikt
- ,,Entscheidungsfenster auf\": Religions- und Schulpolitik im Kontext einer multikulturellen Metropole
- Konflikt..........\n,,Entscheidungsfenster zu“: Volksentscheide als „zweischneidiges\" Unternehmen im schulpolitischen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Konflikt um die Gleichstellung von Ethik- und Religionsunterricht in Berlin zwischen 2005 und 2009. Sie untersucht diesen Konflikt aus der Perspektive des Multiple-Streams-Ansatzes und beleuchtet dabei die Entstehung, Entwicklung und den Verlauf des Konflikts sowie die Faktoren, die zu dessen Eskalation führten.
- Das Berliner Modell der Religions- und Schulpolitik und seine Krise im Kontext von Einwanderung und Multikulturalisierung
- Die Einführung eines neuen, für alle verbindlichen Schulfaches „Ethik“ als umstrittene bildungspolitische Entscheidung
- Die Rolle des politischen Instruments „Volksentscheid“ in der schulpolitischen Auseinandersetzung
- Die Anwendung des Multiple-Streams-Ansatzes als analytisches Instrument zur Erklärung des Konfliktverlaufs
- Die Spezifika des politischen Instrumentes „Volksbegehren“ im Handlungsrahmen des MSA und dessen Konsequenzen für die Auslösung von policies
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Forschungsfrage und das Vorgehen. Kapitel 2 widmet sich der theoretischen Fundierung der Arbeit und stellt den Multiple-Streams-Ansatz als analytischen Rahmen vor. Kapitel 3 beschreibt den Verlauf des Konflikts um die Gleichstellung von Ethik- und Religionsunterricht in Berlin zwischen 2005 und 2009. Kapitel 4 analysiert den Konfliktverlauf mit Hilfe des Multiple-Streams-Ansatzes und beleuchtet die verschiedenen „Ströme“ (Problemstrom, Optionsstrom, Politikstrom) und deren Interaktion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themenfeldern Religions- und Schulpolitik, Multiple-Streams-Ansatz, Wertekonflikt, Volksentscheid, Berliner Modell, Multikulturalisierung, Ethikunterricht, Religionsunterricht, Bildungspolitik, Politikfeldanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde in Berlin ein verpflichtender Ethikunterricht eingeführt?
Die Regierung reagierte damit auf die zunehmende Multikulturalisierung und die Krise des alten Modells, um eine gemeinsame Wertebasis für alle Schüler zu schaffen.
Was war das Ziel des Volksentscheids im Jahr 2009?
Die Initiative wollte erreichen, dass Religionsunterricht dem Ethikunterricht gleichgestellt wird und Schüler zwischen beiden Fächern wählen können.
Was ist der „Multiple-Streams-Ansatz“?
Ein politikwissenschaftliches Modell, das analysiert, wie Probleme, politische Lösungen und politische Ereignisse in „Fenstern der Gelegenheit“ zusammenkommen.
Wie endete die Auseinandersetzung im Jahr 2009?
Der Volksentscheid scheiterte am erforderlichen Quorum, wodurch der verpflichtende Ethikunterricht in Berlin bestehen blieb.
Welche Rolle spielten die Kirchen in diesem Konflikt?
Die Kirchen und der Humanistische Verband waren zentrale Akteure, die ihre Position im Berliner Schulsystem durch die Reform bedroht sahen.
- Quote paper
- Andreas Kosmalla (Author), 2015, Der Konlikt um die Gleichstellung von Ethik- und Religionsunterricht in Berlin 2005 bis 2009, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341518