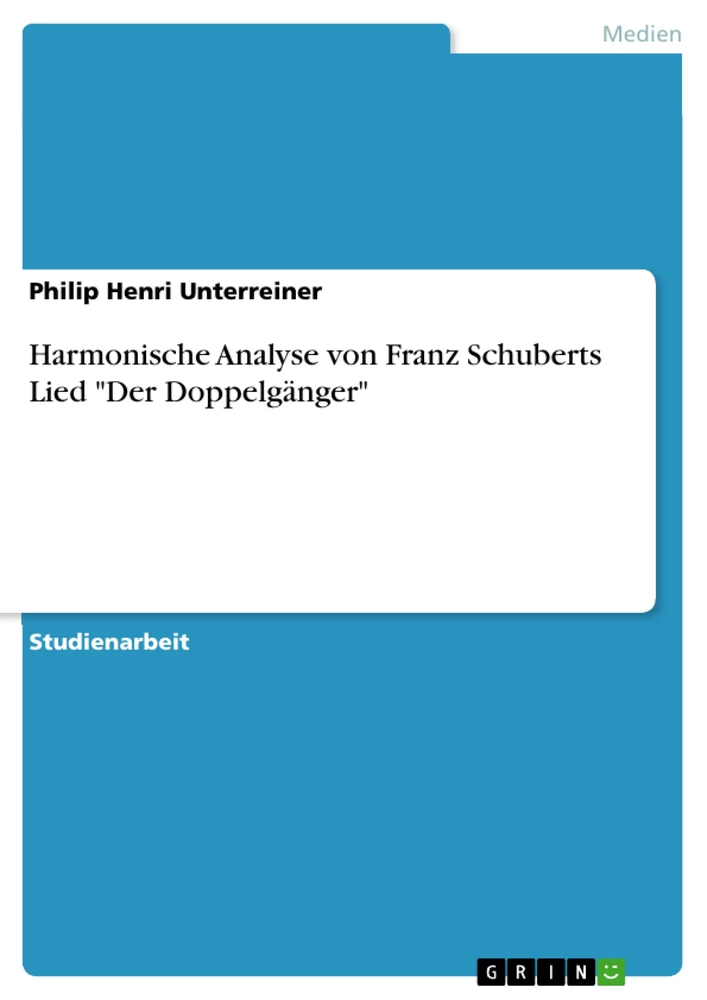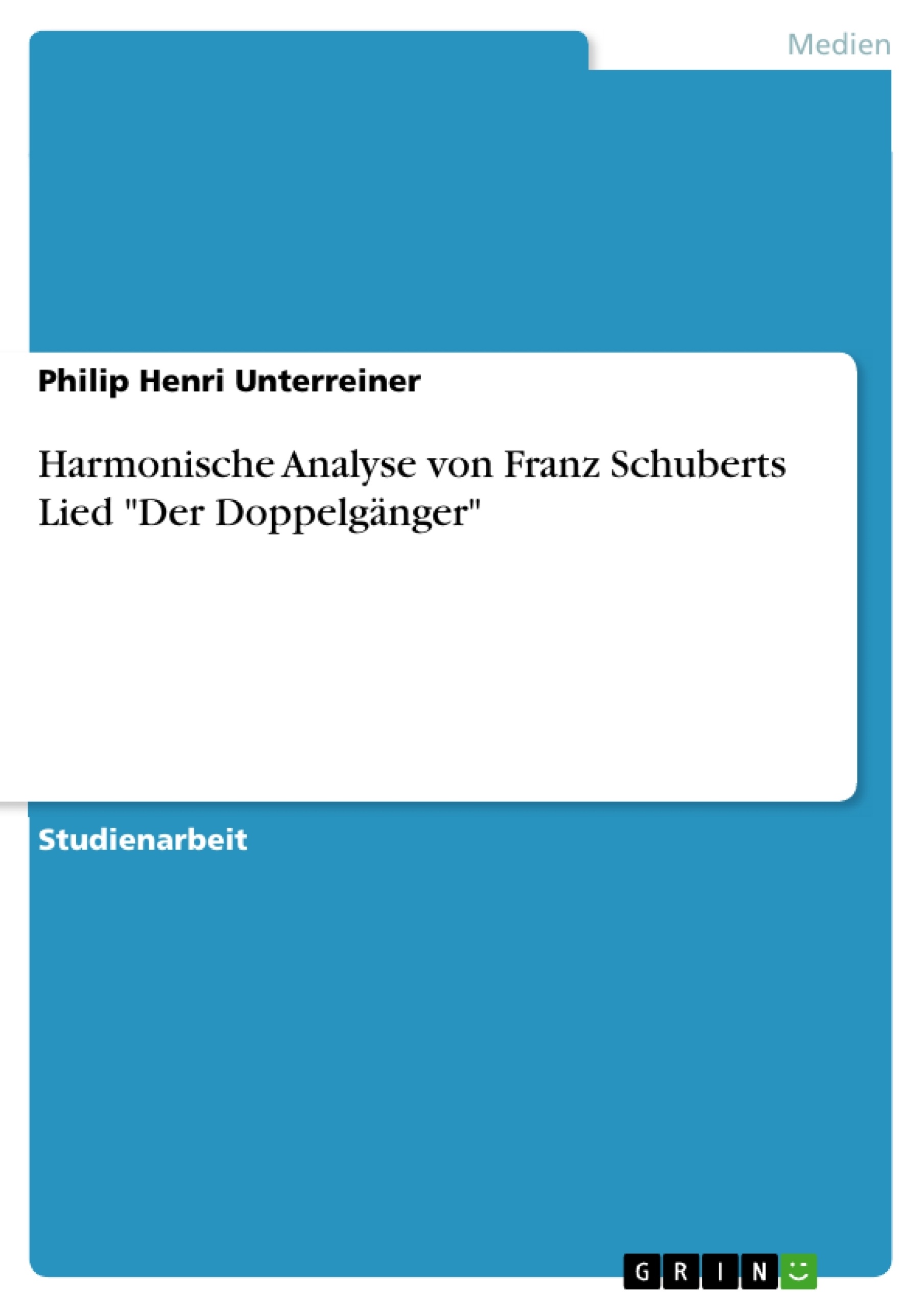Als Voraussetzung für eine harmonische Analyse des Liedes „Der Doppelgänger“ von Franz Schubert kann zunächst eine grobe Gliederung der Formteile vorgenommen werden.
Einen ersten Aspekt stellt das zugrundegelegte gleichnamige Gedicht von Heinrich Heine dar. Dieses ist in drei Strophen, zu je vier Versen gegliedert und besitzt das Reimschema aba, wobei die Kadenzen alternieren. Schubert vertonte das Gedicht als durchkomponiertes Lied. Allerdings lässt sich in der Klavierbegleitung eine große Ähnlichkeit zwischen erster und zweiter Strophe feststellen, die mit der dritten Strophe kontrastiert.
Das Klavier beginnt mit einem 4-taktigen Vorspiel (T. 1-4).
Anschließend wird die erste Strophe in zwei 8-taktigen Phrasen (A1 und A2) für jeweils ein Verspaar gegliedert, nach welchem jeweils ein 2-taktiges Zwischenspiel folgt. Während die Singstimme nur ornamentale Veränderungen erfährt, ist die Klavierbegleitung beider Verspaare identisch, sodass sie den einzelnen Versen entsprechend, weiter in 4-taktige Phrasen, die als Vorder- und Nachsatz beschreibbar sind, unterteilt werden kann, wodurch das Reimschema aba quasi musikalisch nachvollzogen wird. Die erste Gedichtstrophe kann somit als Abschnitt A bezeichnet werden.
In der zweiten Strophe wird das aba-Prinzip variiert fortgesetzt. In der Singstimme findet in Vers 1 und 3 eine Aufwärtsbewegung von d bis ais statt. Dem entspricht in Vers 2 und 4 eine Bewegung, die jedoch erst beim zweiten Mal am Zielton g ankommt. In der Klavierbegleitung wird das 4-taktige Schema der ersten Strophe fortgesetzt, allerdings wird das 2-taktige Zwischenspiel von A durch einen ausgehaltenen Akkord ersetzt (T. 33, 41) und der letzte Akkord des Schemas (T.41) verändert. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Grundstruktur der Begleitung erhalten, wodurch sich dieser Abschnitt als A‘ bezeichnen lässt.
Die dritte Strophe ist musikalisch neu gestaltet und durch Chromatik und Rückungen vom Ausgangsmodell verschieden. Während das erste Verspaar noch eine 8-taktige Phrase erhält, besteht das zweite Verspaar der dritten Strophe nur aus 6 Takten. Diese Strophe kann im Lied als Abschnitt B bezeichnet werden.
Ein 8-taktiges Nachspiel, das sich wiederum in zwei Teile gliedern lässt beendet das Lied.
Inhaltsverzeichnis
- Aufbau
- Harmonik Klavierstimme
- Singstimme
- Semantik und Textdeutungen
- Tonartencharakteristik
- Heines Gedicht „der Doppelgänger“
- Schuberts „Doppelgänger“
- Tabellarische Darstellung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die harmonische Struktur des Liedes „Der Doppelgänger“ von Franz Schubert, das auf dem gleichnamigen Gedicht von Heinrich Heine basiert. Sie untersucht die Form des Liedes, die Tonarten und Kadenzen, sowie die Rolle der Klavierbegleitung und deren Beziehung zur Singstimme.
- Harmonische Analyse der Klavierbegleitung und der Singstimme
- Untersuchung der Tonarten und Kadenzen
- Beziehung zwischen Musik und Text
- Analyse der Form des Liedes
- Rolle der Klavierbegleitung und deren Einfluss auf die Singstimme
Zusammenfassung der Kapitel
Aufbau
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des Aufbaus des Liedes, die die Formteile des Liedes und die Beziehung zwischen Musik und Text untersucht. Dabei wird die Struktur des Gedichtes von Heine und dessen Umsetzung durch Schubert beleuchtet.
Harmonik Klavierstimme
Dieser Abschnitt befasst sich mit der harmonischen Analyse der Klavierbegleitung. Es werden die Tonarten, Kadenzen und die Rolle der Akkordfolge im Stück untersucht.
Singstimme
Dieser Teil widmet sich der harmonischen Analyse der Singstimme und untersucht die Beziehung zwischen Singstimme und Klavierbegleitung.
Semantik und Textdeutungen
Dieser Abschnitt analysiert die semantischen Aspekte des Liedes und untersucht die Beziehung zwischen Musik und Text.
Tonartencharakteristik
Dieser Teil beleuchtet die Charakteristik der verwendeten Tonarten und deren Bedeutung für die Stimmung und den Ausdruck des Liedes.
Heines Gedicht „der Doppelgänger“
Dieser Abschnitt widmet sich dem Gedicht von Heinrich Heine und dessen Bedeutung für die musikalische Umsetzung durch Schubert.
Schuberts „Doppelgänger“
Dieser Teil analysiert die musikalische Umsetzung des Gedichtes durch Schubert und untersucht die spezifischen Merkmale des Liedes.
Schlüsselwörter
Schubert, „Der Doppelgänger“, Harmonische Analyse, Klavierbegleitung, Singstimme, Tonarten, Kadenzen, Form, Textdeutung, Semantik, Gedicht, Heine.
Häufig gestellte Fragen
Auf welchem Gedicht basiert Schuberts „Der Doppelgänger“?
Das Lied basiert auf dem gleichnamigen Gedicht von Heinrich Heine aus seinem Werk „Buch der Lieder“.
Wie ist die musikalische Form des Liedes gestaltet?
Schubert vertonte das Gedicht als durchkomponiertes Lied, wobei die Klavierbegleitung der ersten beiden Strophen sehr ähnlich ist und die dritte Strophe musikalisch kontrastiert.
Welche Rolle spielt die Klavierbegleitung in diesem Stück?
Das Klavier übernimmt eine tragende Rolle, beginnend mit einem 4-taktigen Vorspiel, und spiegelt durch harmonische Rückungen und Chromatik die düstere Stimmung des Textes wider.
Wie wird das Reimschema des Gedichts musikalisch umgesetzt?
Das aba-Reimschema der Verse wird durch die Gliederung in 4-taktige Phrasen (Vorder- und Nachsatz) in der Klavierbegleitung musikalisch nachvollzogen.
Was zeichnet die Harmonik der dritten Strophe aus?
Die dritte Strophe ist durch starke Chromatik und harmonische Rückungen geprägt, was den dramatischen Höhepunkt des Textes unterstreicht.
- Citation du texte
- Philip Henri Unterreiner (Auteur), 2012, Harmonische Analyse von Franz Schuberts Lied "Der Doppelgänger", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341556